ANALYTISCHE STUDIEN
ZUR METRIK DES MUOTATALER JUUZ
Diplomarbeit zur Erlangung des
Magistergrades der Philosophie
eingereicht an der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien
von
Hermann FRITZ
Wien, am 17. April 1997
Vorwort zur Online-Auflage
Magistergrades der Philosophie
eingereicht an der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien
von
Hermann FRITZ
Das Metrum ist eine Response und ein Konzept des Hörers und nicht eine objektive Eigenschaft des Schalles. In der Jodelforschung hat sich das noch kaum herumgesprochen, punkto Rhythmusforschung ist sie hinter der Afromusikologie mittlerweile mehrere Jahrzehnte im Rückstand. Der Glaube, man verstehe die Musik stets richtig, weil man ja in der ‚eigenen’ Kultur forsche, der Glaube, Jodelgesang sei stets simpel, ohne Polyrhythmik und ohne gewitzte Dissonanzbehandlung, der Glaube der Transkribierenden, sie könnten ohne Befragung der Jodelnden und ohne musikalische Analyse Taktvorschreibungen und Taktstriche methodenlos nach ihrem subjektiven Empfinden setzen, der Glaube, man könne ohne die Erforschung der Schwerzeitempfindungen der Überlieferungsträger über das Metrum wissenschaftliche Aussagen machen, ist in der Jodelfoschung nach wie vor - und gerade im heutigen Wissenschaftsbetrieb wieder - verbreitet. Noch die neueste Jodelforschung gründet Taktstrichsetzung und Taktvorschreibung auf subjektivem Empfinden statt auf musikalischer Analyse, Variantenvergleich und der Befragung der Jodelnden. Sie gelangt dadurch zu fehlerhaften Notationen. Dazu kommt, dass in der Jodelforschung die metrische Missdeutung theoretische Implikationen hat. Die schriftlich entstellten Formen werden ‚empirische’ Basis für größere Fehleinschätzungen. Meine nun 23 Jahre alte Arbeit ist aktueller denn je.
Meine Arbeit enthält Informationen und Untersuchungen, die nicht in der im Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft (1999: 305-408) veröffentlichten kurzen Zusammenfassung enthalten sind, nämlich:
- Grundsätzliche Überlegungen zu Rhythmus und Metrum,
- Elemente einer Theorie der metrischen Variantenbildung,
- Meine Metrumdefinition (S. 88),
- Jodelmetrum und Ideologie,
- Vergleich zwischen dem Juuzen von Kinder und Erwachsenen 1936,
- Rhythmusanalyse eines walzerhaften Juuz 1979,
- Ausschnitt aus einem Bericht über das Älplerfest in Schwyz 1855,
- Bewertungen des Vortrags von Anton Büeler in Jodlerfestberichten.
Wolfgang Sichardts Tonaufnahmen, die damals noch nicht zugänglich waren, befinden sich jetzt in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Würde ich das Buch heute noch einmal schreiben, würde ich die von der schwedischen Rhythmusforschung übernommene Terminologie ändern. Statt Ausführungsprofil
und Normdauern
würde ich Transkriptionsprofil
und Durchschnittsdauern
schreiben, um zu verdeutlichen, dass es um die Abweichung der Notation von der Musik geht und nicht umgekehrt. (An den Messwerten würde sich nichts ändern außer den Vorzeichen). Besonders stört mich heute der Ausdruck Normdauer
. Zudem würde ich verstärkt darauf hinweisen, dass die traditionelle Notenschrift überfordert ist mit der Aufgabe, sowohl die Dauer als auch die Schwere auszudrücken. Offensichtlich intendierte Frau Suter-Gwerder in einem ihrer Jüüz den von mir als |Halbe - Viertel| notierten Rhythmus nicht im Verhältnis nahe 2:1, auch nicht im Verhältnis nahe 3:2, sondern in einem dazwischenliegenden irrationalen Verhältnis (S. 187 ff.).
Simon Wascher danke ich für die Idee und die arbeitsaufwendige Realisierung der Online-Edition meines Buches. Hermann Haertel danke ich für die Umschrift der Notenbeispiele in ABC-Notation, wodurch sie mit Mausklick hörbar werden. Mein besonderer Dank gilt Peter Betschart. Ohne seine selbstlose Unterstützung bei meiner Feldforschung und ohne seine wertvollen Hinweise wäre meine Arbeit um einige wesentiche Datails ärmer.
Linz, 14. November 2020
Hermann Fritz
3
Vorbemerkungen
Das Muotatal im schweizerischen Kanton Schwyz gilt heute wohl unbestritten als eine der interessantesten Jodellandschaften des Alpenraums und zwar nicht nur in der vergleichenden Musikwissenschaft, sondern auch in der Volksliedforschung und neuerdings sogar in der Kulturindustrie, die die Musik dieses Hochgebirgstals als Urmusik
entdeckt hat. Die Musikwissenschaft, die derlei populäre Mythenbildungen gewohnt ist zu belächeln oder ihnen mittels rationaler Durchdringung des Gegenstandes aufklärend und aufklärerisch den Boden zu entziehen trachtet, tut sich in diesem Fall schwer. War sie es doch selbst, die als erste von der Außergewöhnlichkeit des Muotataler Jodels sprach und ihm hohes Alter bescheinigte.
Volksliedforschung, Populärwissenschaft und Kulturindustrie sind ihr darin bloß – mit Zeitverzögerung – gefolgt. Zum anderen erweist sich der Gegenstand dem wissenschaftlichen Zugriff gegenüber als sperrig. Auch die neuere Forschung stellt im Muotataler Jodel Besonderheiten fest, die sich in die europäische Musikgeschichte schwer einordnen lassen. Zwar ist die Musikwissenschaft heute in der Hypothesenbildung vorsichtig geworden, sie insistiert auf empirische Abstützung und sucht Spekulation zu vermeiden. Doch hat das andererseits zur Folge, daß in der Populärwissenschaft die früheren Hypothesen in Kraft bleiben, solange kein besserer Ersatz für sie angeboten wird. Und ein entscheidender Durchbruch, der das Denken über den Muotataler Jodel auf eine völlig neue Grundlage stellte, konnte bislang nicht erzielt werden.
Die Besonderheiten dieses Jodels bzw. des Juuz
, wie die Muotataler selbst ihn nennen, sieht die Musikwissenschaft in der von der gleichmäßig temperierten Stimmung weit abweichenden Gebrauchsleiter (Sichardt 1939, Zemp 1979/90 und 1987, Födermayr & Deutsch 1994) sowie im irregulären, in kein System zu fassenden Metrum (Sichardt 1939, Leuthold 1981) und in einigen Charakteristika der Ausführungsweise (Sichardt 1939, Zemp 1979, 1987 und 1990, Födermayr & Deutsch 1994). Auf die Eigenschaften, die heutige Forschung als für den Muotataler Juuz charakteristisch ansieht, hat bereits Wolfgang Sichardt (Sichardt 1939) hingewiesen. Physikalische Messungen der Gebrauchsleiter (Zemp 1979, 1987; Födermayr & Deutsch 1994) haben Sichardts mittels Tonbandtranskription gemachte Beobachtungen bestätigt und präzisiert. Die Konfiguration einer Gebrauchsleiter zu eruieren ist ein mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln leicht lösbares Problem. Schwieriger ist die Frage des Tonsystems, weil die sinnhaften Beziehungen zwischen den Tönen nicht gemessen, nur gedeutet werden können. Hier nimmt Hypothesenbildung und Spekulation einen breiten Raum ein.
Während Sichardt im Altstil des Muotatals
eine vorgregorianische Schicht
erkannte, in der die großen Sprungintervalle [...] keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion
haben und in dem die Quart [...] als Melodieschritt, das Tetrachord als Melodierahmen und Gerüstbeziehung besondere Bedeutung
4
[gewinnt]
(Sichardt 1939: 29 f.), betont Zemp den neuzeitlichen Charakter: Trotz gewisser Archaismen gehört der Muotataler Juuz zum tonalen Tonsystem. Die Tonleiter ist in Dur, mit gelegentlichen Veränderungen bestimmter Stufen (hauptsächlich III, IV und VII)
, wobei er allerdings den Begriff des Dur in der Folge stark relativiert: Die Erhöhung der IV. Stufe der Tonleiter ist charakteristisch für bestimmte Muotataler Jüüzli [...] Man bemerkt bei gewissen Jüüzli eine neutrale Intonation der Terz.
(Zemp 1990).
Ein zweites ungelöstes und kontroversiell diskutiertes Problem ist die metrische Struktur. Dieses Problem, dem sich die vorliegende Arbeit zuwendet, ist ungleich schwerer zu bearbeiten, weil der Zusammenhang zwischen der Ebene der naturwissenschaftlich meßbaren Fakten und der Ebene der musikalischen Konzepte ungleich komplexer ist. Tonsystemforschung kann von physikalischen Meßwerten ausgehen und dann fragen, durch welche melodischen und harmonischen Konzepte sie bedingt und verursacht sind. Die meßbaren Lautstärkeimpulse sind bestenfalls bei Tanzmusik ein guter Indikator für Metrisches. Beim Jodel muß die Metrumforschung ein ganzes Bündel von Indikatoren in Betracht ziehen, darunter Größen, die nicht meßbar, sondern nur verstehbar sind wie melodische Sinnakzente und die hinter einer Melodie stehenden harmonischen Vorstellungen. Das zu Deutende hängt hier von einem anderen zu Deutenden ab und damit steht die Erforschung des Jodelmetrums in der ständigen Gefahr, in reine Spekulation abzudriften.
Dies wirft die Frage nach einer methodischen Vorgehensweise auf. Der Metrum-Forscher kann nicht einfach Taktstriche setzen mit der Begründung: Ich verstehe das so
. Das wäre ein Argument in der Kunst, nicht jedoch in der Wissenschaft.
Denn es geht hier um die Frage, wie die Muotataler selbst das Metrum ihrer Jüüz' auffassen. Der Metrumforscher kann sich daher auch nicht wie die frühere Aufzeichnungs‐ und Transkriptionspraxis damit begnügen, ein vermutlich intendierte[s]
Metrum (Lubej 1992: 106) zu notieren. Zumindest müßte er seine Vermutungen ausführlich begründen. Und die beste und sicherste Begründung ist die Kenntnis der metrischen Vorstellungen der Juuzerinnen und Juuzer. Um sich diese Kenntnisse zu verschaffen, muß der Forscher die Ausführenden befragen und und er muß eine Methode entwickeln, die es ihnen ermöglicht, ihre metrischen Vorstellungen auch zu äußern.
Eine repräsentative Anzahl von Juuzern zu ihren metrischen Auffassungen zu befragen und das hinsichtlich möglichst vieler Jüüz' hätte eine längere und kostenaufwendige Feldarbeit im Muotatal bedeutet. Deshalb entschied ich mich für eine methodenpluralistische Vorgangsweise: Mithilfe der naturwissenschaftlichen und der historisch-vergleichenden Methode wurden zunächst Hypothesen gewonnen, die dann ethnomethodisch überprüft wurden. Zur Bildung solcher Hypothesen maß ich Spektrogramme aus und untersuchte sie auf die Passung mathematischer Raster.
5Ein zweiter Zugang war die statistische Auswertung der Transkriptionen anderer Autoren. Als eine zur Hypothesengewinnung sehr fruchtbare Methode erwies sich die historisch-vergleichende. Besonders brachte der bislang kaum angestellte Vergleich des Juuz mit der Tanzmusik überraschende Ergebnisse. (Ansätze dazu gibt es in Hugo Zemps Film Kopfstimme, Bruststimme
). Die Hypothesen wurden sodann in der Befragung zweier Informanten überprüft, wofür mit Absicht solche Stücke ausgewählt wurden, deren metrische Deutung umstritten war und bei denen auch meine Hypothesen eine Zweideutigkeit offenließen.
Zuletzt wurde in einer Reflexion des Gesamtergebnisses die Theorie der metrischen Variantenbildung und der historischen Abstammung der metrisch-formalen Struktur der alpenländischen Jodelmelodien von der Tanzmusik gebildet. Diese Theorie, das möchte ich gleich an dieser Stelle betonen, ist keine Theorie über die Entstehung des Jodelns und hat mit den zahlreichen Theorien dieser Art nichts zu tun. Sie versucht weder, über den Ursprung dieser Gesangstechnik generell etwas auszusagen noch über den Ursprung des alpenländischen Jodelns speziell. Sie versucht nicht, Hypothesen darüber zu bilden, was in vorhistorischer Zeit vielleicht einmal gewesen sein könnte. Sie zielt nicht auf das Jodeln als Gesangstechnik ab, sondern auf das Repertoire der Jodler. Sie will die viel bescheidenere Frage beantworten, wie das alpenländische Jodelrepertoire zu den heute vorfindlichen Formschemata gelangte sowie die Zusatzfrage, warum es mitunter Abweichungen von diesen Formschemata gibt.
Die gewählte Reihenfolge der einzelnen Kapitel versucht, die mit den verschiedenen Methoden gewonnenen Erkenntnisse zu einer stringenten Argumentation zu verzahnen.
Dabei wurden die zwingendsten Argumente an den Anfang gestellt. Sie sollen eine feste Basis abgeben für die mehr interpretatorischen und hypothetischen Erwägungen. Auf diese folgt der Bericht über die Feldforschung, in dem die aufgestellten Hypothesen überprüft und teilweise revidiert werden. Am Ende steht die Theorie über die Herkunft des rezententen Jodlermetrums. An den Beginn der Darstellung wurde ein Abriß über die divergierenden Auffassungen der einzelnen Forscher gesetzt, um die Problematik sichtbar werden zu lassen.
Diese Reihenfolge der Darstellung entspricht nicht dem tatsächlichen Verlauf des Erkenntnisprozesses. Zuerst entdeckte ich mittels der vergleichenden Methode die Formschemata, dann führte ich die Feldforschung durch und zuletzt suchte ich nach einer beweiskräftigen statistischen und naturwissenschaftlichen Untermauerung. Die Theorie der metrischen Variantenbildung war in Ansätzen schon während meiner Arbeit über den Jodel im salzburgischen Ennstal (Fritz 1990) und während meiner Feldarbeiten in Abersee (Gemeinde Strobl und St. Gilgen, Salzburg) entstanden. Sie hat sich am Muotataler Material bewährt und weiterentwickelt. Zweifel an der Plausibilität von Wolfgang Sichardts Taktstrichsetzungen waren 6 mir bereits 1989 gekommen. Damals gelang es mir bei den Jodelweisen, aber noch nicht bei den Büchelstücken, eine plausiblere metrische Deutung zu finden. Auch war mir damals die Möglichkeit einer Differenz zwischen dem in der historisch-vergleichenden Untersuchung gefundenen Formschema und dem ethnomethodisch ermittelten metrischen Konzept noch nicht ins Bewußtsein gelangt. In der Arbeit über die Jodel im salzburgischen Ennstal habe ich diese Differenz beim Rubatostil als Umwandlung von gedehnten in gezählte Zeiten vermutet (Fritz 1990: 45), doch hielt ich es bis vor kurzem nicht für möglich, daß eine metrische Umdeutung auch bei gleichbleibender rhythmischer Gestalt im Nonrubatostil auftreten kann.
Als die Arbeit geschrieben war, stellte sich heraus, daß sie für eine Diplomarbeit viel zu lang war. Es stand dafür, sie in zwei Teile aufzuspalten: den ersten Teil als Diplomarbeit zu gestalten und den zweiten für eine anderweitige Veröffentlichung vorzubehalten. Als quasi natürliche Teilung bot sich eine methodische an. Im ersten Teil stehen statistische und naturwissenschaftliche Analysen im Vordergrund, den zweiten Teil bilden die historisch-vergleichende Untersuchung und der Feldforschungsbericht. Diese Unterteilung ist auch inhaltlich sinnvoll: Im ersten Teil werden bestimmte in der Muotatalforschung vorherrschende Auffassungen in Zweifel gezogen, im zweiten wird eine Problemlösung erarbeitet und ethnomethodisch überprüft. Die methodologische Reflexion wurde dem ersten Kapitel zugeschlagen. Damit verhält sich nun der erste zum zweiten Teil wie die Exposition zur Durchführung. Im ersten Teil, der hier als Diplomarbeit vorliegt, werden begründete Zweifel an gewissen Auffassungen angemeldet, Anhaltspunkte für eine Alternative bereitgestellt und ein methodischer Lösungsweg skizziert.
Es sei nun eine Bemerkung zur Terminologie gestattet, die gleichzeitig eine Abgrenzung des Gegenstandes darstellt. Nach allgemeiner Auffassung ist das Jodeln eine Singart [...], die sich durch häufigen, beweglichen Registerwechsel zwischen Bruststimme und Falsett kennzeichnet
(Sichardt 1939: 2; Hervorhebung durch Sichardt) bzw., in der gleichsinnigen, prägnanten Formulierung Walter Grafs, durch den abwechselnden Gebrauch von Brust‐ und Falsettstimme
(Graf 1975: 588; gleichlautend Födermayr und Deutsch 1994: 256). Darauf aufbauend gelangen Franz Födermayr und Werner A. Deutsch in ihrer Studie Analytische Grundlagen zu einer Typologie des Jodelns
(Födermayr & Deutsch 1994) zu folgenden Begriffsbestimmungen: Im Einklang mit dem Dudenwörterbuch der deutschen Sprache (Baumann 1976: 92) soll die entsprechende Tätigkeit als jodeln bezeichnet werden, die Person, die diese Tätigkeit ausübt, als Jodler (in) und das Ergebnis des Jodelns als Jodel.
(Födermayr & Deutsch 1994: 256). Die beiden Autoren leiten hier die Bedeutung des Wortes Jodel logisch von der Grafschen Definition des Begriffes jodeln ab. Sie weisen
7
allerdings darauf hin, daß es mit diesen Begriffsbestimmungen im Hinblick auf einschlägige regionale Bezeichnungen [...] Probleme [gibt]
(Födermayr & Deutsch 1994: 256).
Und solche Probleme treten bei meiner Arbeit nun auch tatsächlich auf, verursacht nicht nur durch die regionalen Bezeichnungen, sondern auch durch die von Autor zu Autor differierende Terminologie. Es gibt nämlich neben dem weitesten, allein gesangstechnisch definierten Begriff des Jodels, wie ihn Födermayr verwendet, auch engere Begriffe, die neben dem stimmphysiologisch-gesangstechnischen Kriterium noch zusätzliche Kriterien sprachlich-textlicher, funktionaler oder musikalisch-formaler Natur beinhalten.
Diese engeren Begriffe treten interessanterweise nicht unter dem Wort jodeln, sondern unter dem Wort Jodel auf (bzw. in der älteren Literatur unter dem Wort Jodler, das dort sowohl die männliche ausführende Person als auch das musikalische Ergebnis bezeichnet). So findet sich bei Max Peter Baumann folgende Begriffsbestimmung: Unter Jodel versteht man heute ganz allgemein eine text‐ und wortlose Singweise, die auf einzelnen nicht sinngebundenen Vokal-Konsonantverbindungen [...] alternierend in Brust‐ und Falsettstimme gesungen wird.
(Baumann 1976: 92). Dieses sprachliche Zusatzkriterium
*)
*) Es findet sich auch bei Zemp: Eine weitere Charakteristik des Jodels ist das Fehlen von Text
(Zemp 1990).
schließt mit Registerwechsel gesungene Lieder, wie sie zumindest in Österreich
**)
**)nach eigenen Beobachtungen im Feld.
vorkommen, aus dem Begriff des Jodels aus. Damit ist Baumanns Begriffsbestimmung dem umgangssprachlichen Begriff Jodel (bzw. im Bairisch-Österreichischen: Jodler) näher, ohne mit diesem jedoch ganz identisch zu sein. Ein anderes Zusatzkriterium verwendet Wolfgang Sichardt, wenn er den Jodler
von angrenzenden Gattungen
bzw. benachbarten Volksmusikformen
unterscheidet (Sichardt 1939: 41), zu denen er nicht nur die registerwechsellosen Alpsegen
Und Juchzer
zählt, sondern auch Gattungen, die nach der rein stimmphysiologisch-gesangstechnischen Definition durchaus unter den Begriff des Jodels fielen, wie Almschreie
und Jodelrufe
(Sichardt 1939: 47 ff.) sowie Lockgesänge
und Kuhreigen
(Sichardt 1939: 52 ff.). Es handelt sich hierbei um eine sowohl funktionale als auch musikalisch-formale Unterscheidung; funktional, weil der ruf‐ oder mitteilungshafte
Charakter (Sichardt 1939: 41) die gemeinsame Eigenschaft dieser Gesänge ist, wobei Sichardt die Unterteilung dieser angrenzenden Gattungen
– wiederum funktional – danach vornimmt, ob die Adressaten Menschen (Juchschrei, Juchzer, Almschrei, Jodelruf), Tiere (Lockrufe, Lockgesänge, Kuhreigen) oder übernatürliche Wesen (Alpsegen) sind, und musikalisch-formal, weil die funktionalen Unterschiede mit den musikalisch-stilistischen weitgehend parallel gehen.
Das primäre Unterscheidungskriterium Sichardts ist freilich das Funktionale.
Im Unterschied zum positiv definierten Begriff des Jodelns bleibt der Begriff des Jodlers
jedoch negativ definiert, denn Sichardt läßt sich an keiner Stelle darüber aus, welche spezielle Funktion dem Jodler
im Gegensatz zu den funktional wohldefinierten angrenzenden Gattungen
eigentlich zukommt.
Eine ähnliche begriffliche Komplikation tritt bei Max Peter Baumann auf.
Bei ihm tritt Jodel
sowohl als Überbegriff als auch als Unterbegriff auf, wie schon aus der Einteilung des 3. Teils (Zum Funktionswandel des Jodels
(Baumann 1976: 79 ff.)) in Unterkapitel hervorgeht, in denen Kuhreihen
, Jauchzer, Lock‐ und Jodelrufe
sowie Jodellied
vom eigentlichen Jodel
unterschieden werden. Diese Einteilung geht in den Begriffsumfängen weitgehend mit der Sichardtschen Unterscheidung parallel. Unklar bleibt jedoch das Unterscheidungskriterium. Zwar entbehren die vom Unterbegriff Jodel abgegrenzten Phänomene teils des Registerwechsels oder/und sie sind zum Teil textiert, doch gibt es auch textlose, registerwechselnde Kuhreigen (Baumann 1976: 133), Tierlockrufe (Baumann 1976: 145 und 149), Jauchzer (Baumann 1976: 149) und die Jodelrufe genügen von vornherein allesamt Baumanns gesangstechnischer, sprachlich-textlicher Begriffsbestimmung (Baumann 1976: 149). Daher ist zu vermuten, daß neben dieser Jodeldefinition noch andere Kriterien hinter dieser Einteilung stehen. Und da laut Baumanns Auffassung Lockruf, Kuhreihen und Jodel funktional in enger Verbindung [stehen]
(Baumann 1976: 147), ist dieses versteckte Kriterium wohl eher als ein musikalisch-formales denn als ein funktionales zu denken. In diese Richtung weisen auch Baumanns Ausführungen zu den Melodiestrukturen mündlich tradierter Jodel
(Baumann 1976: 154). Genau besehen treten bei Baumann also zwei Jodelbegriffe auf: ein weiterer, der durch die oben zitierte Definition bestimmt ist und ein engerer, dessen Begriffsbestimmung unklar bleibt und der primär negativ – durch Abzug der Kuhreihen, Jauchzer, Lock‐ und Jodelrufe – definiert ist. (Der dritte, speziell für die statistische Untersuchung definierte Jodelbegriff schließt darüberhinaus die stilisierten Jodelgesänge und Jodellieder, d.h. jene Melodien, die ein komponiertes, schriftliches Gut darstellen, aus (Baumann 1976: 154)).
Damit ist die Frage aufgeworfen, was es mit diesem bei Sichardt und Baumann und auch bei Gaßmann (Gaßmann 1906; 1936; 1961) auftretenden engsten, negativ definierten und, wie die Notenbeispiele zeigen, der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes Jodel am nächsten kommenden Jodelbegriff auf sich hat. Aus Sichardts und Baumanns Ausführungen ist zu schließen, daß die Bestimmungsmerkmale dieses Jodel im engeren Sinne im funktionalen oder im musikalisch-formalen Bereich zu vermuten sind.
9Hugo Zemps Muotatalforschung wirft Licht auf diese Frage: Früher war der Juuz mit der Tätigkeit der Bauern verbunden. Die Männer juuzten, um die Kühe zum Melken herbeizulocken, während des Melkens im Stall oder draußen auf der Alp, beim Grasmähen, beim Holztransport, usw. Die Frauen juuzten ebenfalls bei der Arbeit auf dem Bauernhof oder in der Küche. Am Abend juuzte man manchmal auf der Bank vor dem Haus, während Familienzusammenkünsten, während im Bauernhaus veranstalteten Tanzabenden (Schloffätänz) oder im Wirtshaus. Man konnte auch etwa die Nachtbuebä auf dem Weg zu einem von jungen Mädchen bewohnten Bauernhof hören.
(Zemp 1990; Hervorhebungen im Orig. kursiv). Der Juuz ist demnach funktional weder auf die Arbeit mit dem Vieh beschränkt noch auf Arbeit generell, er ist bei der Arbeit nicht immer streng funktionsbezogen, sondern auch als bloßer Zeitvertreib, als musikalische Untermalung (in der Küche
z. B.) gebraucht und er ist wichtiger Teil der Geselligkeit. Der Juuz ist multifunktional. In dieselbe Richtung weisen auch die Berichte Peter Betscharts: So erzählte mir meine Mutter, dass man vor 20 Jahren fast jeden Abend von einer Seite her ein paar Gsätzli gehört habe. Von der andern Seite des Tales wurde dann
(Betschart 1981: 7).
Bescheid-gegeben
. Damals war der abendliche Platz noch auf der Bank vor dem Haus und nicht vor dem Fernseher. Auch die Nachtbuben haben sehr schön gejuuzt. Sie waren darauf eingespielt, selbst Stimmung zu machen in den Wirtschaften. [...] Fast jeder Juuzer war Bauer oder zumindest Älpler [...] Mehrere betonten, beim Vieh gerne gejuuzt zu haben. Andere wieder beim Heuen usw. [...] Natürlich traf man den Juuz auch schon früher, genau wie heute, am Wirtstisch; [...] es gehörte die Atmosphäre der Zusammengehörigkeit dazu. Wo gejuuzt wird, gibt es immer Stimmung.Ehrler Paul, wohnhaft gewesen an der Grundstrasse, erzählte mir, dass früher die Fuhrmannen aus dem Tal bei ihnen einkehrten oder vorbeifuhren.
Besonders an Inspektionstagen ging es hoch zu und her im Schützenhaus.
In der Wirtschaft oder auf dem Leiterwagen wurde gejuuzt.
(Betschart 1981: 20).
Betschart erwähnt hier außer der Rolle des Juuz bei der Arbeit und in der Geselligkeit auch die Funktion als Verständigungsmittel auf weite Strecken.
Max Peter Baumann erwähnt außer den Funktionen des Jodels als Tierlockruf, die er für die ursprünglichen
hält (Baumann 1976: 204), als Verständigungsmittel und als Teil der Geselligkeit (Baumann 1976: 205) auch noch die als Wiegenlied und als Jodelwettgesang bzw. Zweikampf (Baumann 1976: 205). Die Multifunktionalität ist schon am Ende des 19. Jahrhunderts bezeugt. So findet sich im Schweizerischen Idiotikon unter dem Schlagwort Jodel
folgender Hinweis: Dem Zweck nach dient der Jodel, wie der Kureien, zunächst als Lockruf für die
10
Kühe, dann aber als Lustäußerung des Sennen, auch als Kundgebung in die Ferne und zu geselliger Unterhaltung, die sich in Appenzell nicht selten zu Wettkämpfen zwischen verschiedenen Sängern steigert.
(Schweizerisches Idiotikon. Bd. 3, Frauenfeld 1892, Sp. 11; zitiert nach Baumann 1976: 90).
Der im Anhang wiedergegebene Bericht über ein Älplerfest in Schwyz aus dem Jahre 1855 bezeugt die Existenz von Wettkämpfen im Jodeln und Alphornblasen auch für die Innerschweiz.
Von der Multifunktionalität scheinen im Muotatal lediglich jene Melodien ausgenommen zu sein, die mit dem Namen Chueraiheli
bezeichnet werden.
Hugo Zemp bemerkt hierzu: Mit diesem Stück lockt man die Kühe, um sie in den Stall zum Melken zu bringen.
(Zemp 1990). Da in meiner Feldforschung terminologische Fragen nicht im Mittelpunkt standen, kann ich nicht sagen, ob die Muotataler das Chueraiheli
zum Juuz
zählen. Laut Hugo Zemp bedeutet juuzä
(verschriftsprachlicht juuzen
, eine Dialektform von jauchzen
bzw. juchzen
) zur gleichen Zeit das Ausstoßen von Juchschreien [...] und die Singart, die man heute allgemein als Jodel bezeichnet.
(Zemp 1990).
Die Bedeutungserklärung des Zeitwortes läßt jedoch nicht von vornherein einen Schluß auf die Bedeutung des Hauptworts zu, es könnte vielleicht sein, daß in der Muotataler Terminologie das Chueraiheli
kein Juuz
ist, obzwar es gjuuzäd
wird. Eine derartige Bedeutungsdifferenz zwischen Zeitwort und Hauptwort wäre nichts Ungewöhnliches. Sie tritt jedenfalls, wie ich oben gezeigt habe, in der wissenschaftlichen Terminologie auf als Neigung, das Wortfeld von Jodel enger zu fassen als das von jodeln.
Diese engeren Begriffe des Jodels sind also, wenn sie überhaupt funktional definiert sind, durch die Multifunktionalität bestimmt. Ein weiterer Untersuchungsschritt deckt jedoch starke Anhaltspunkte dafür auf, daß diese engeren Begriffe des Jodels primär musikalisch-formale Begriffe sind. In Max Peter Baumanns statistischer Untersuchung mündlich überlieferter Jodel scheinen ausschließlich Stücke mit mehr als einem Formabschnitt auf (Baumann 1976: 155 ff.).
Ebenso weisen die von Wolfgang Sichardt als Jodler
bezeichneten Stücke (Sichardt 1939: 4﹣40) stets mindestens zwei Formabschnitte auf. Dasselbe gilt für die Jodel
bei Alfred Leonz Gaßmann (Gaßmann 1906; 1936; 1961). Die Juchzer
und die kürzeren Rufe
hingegen sind zumeist einteilig, erheblich kürzer und melodisch weniger komplex. Die längeren, mehrteiligen, Rufe
, Lockgesänge
und Kuhreihen
genannten Stücke hingegen unterscheiden sich vom Jodel
durch ihren andersartigen formalen Aufbau: Während die Jodel
fast ausschließlich periodisch gebaute Formteile (Vordersatz + Nachsatz) aufweisen, ist diese Formkonstruktion bei den längeren Rufen
, Lockgesängen
und Kuhreihen
nicht zu finden. Lockrufe
und Kuhreihen
unterscheiden sich
11
auch noch in einer anderen, bemerkenswerten Hinsicht vom Jodel
: Während die allermeisten Jodelaufzeichnungen harmonisch-metrische Schemata erkennen lassen (taktschlüssige Harmoniefolgen, Funktionsharmonik, acht‐und sechzehntaktige Formen), ist das bei den Lockrufen
und Kuhreihen
nicht der Fall. Eine Ausnahme bildet allerdings – nach der Auffassung von Sichardt und Leuthold – der Muotataler Jodel und zwar sowohl in metrisch-formaler als auch in harmonischer Hinsicht. Ob diese Auffassung richtig ist, ist unter anderem Gegenstand der folgenden Untersuchungen.
Auffällig ist weiters, daß der Jodel
sowohl ein‐als auch mehrstimmig auftritt, während die verschiedenen Rufe
und die Kuhreihen
einstimmig sind. Eine Ausnahme bildet nach Berichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert lediglich der (heute als ausgestorben geltende) Appenzeller Kuhreihen (Baumann 1976: 131) und die Appenzeller Löckler (Baumann 1976: 172).
Demnach scheint dieser engere Begriff des Jodels, wie er bei Gaßmann, Sichardt und Baumann auftritt, auf längere und komplexere musikalische Formen abzuzielen, die an keine bestimmte Funktion gebunden sind.
Die folgenden Untersuchungen sind auf den Jodel im engeren Sinn zentriert.
Diese Abgrenzung des Arbeitsfeldes soll nicht als eine Definition des Begriffes Jodel mißverstanden werden. Es liegt mir fern, den vielen Jodeldefinitionen eine weitere hinzuzufügen. Die Themenbegrenzung läßt sich auch mithilfe des weiteren, umfassenderen Jodelbegriffs von Graf (Graf 1975: 588) wie folgt formulieren: Arbeitsgebiet sind jene Muotataler Jodel, die nicht als Juchzer, Rufe oder Kuhreihen ausgewiesen sind. Da sich diese Unterscheidungen in allen für den Muotataler Jodel relevanten schriftlichen und tönenden Quellen in benennungsmäßig wie inhaltlich übereinstimmender Form vorfinden, sind sie nicht nur praktisch leicht zu handhaben, sondern auch inhaltlich sinnvoll.
(Daß sich hinter der benennungsmäßigen Übereinstimmung auch tatsächlich eine inhaltliche verbirgt, ist ein – angesichts der Verschiedenheit der theoretischen Grundauffassungen von Gaßmann, Sichardt und Zemp gar nicht selbstverständliches – Ergebnis der folgenden Untersuchungen, das hier schon vorgreifend bekanntgegeben wird). Diese Einschränkung bringt den Vorteil eines relativ homogenen und somit gut vergleichbaren Materials, das dann seinerseits wiederum mit den angrenzenden Gattungen
, zu denen ich nicht nur Juchzer, Rufe, Kuhreihen und Büchelmusik, sondern auch die Tanzmusik zähle, verglichen werden kann.
Eine terminologische Konsequenz dieser Präzisierung des Arbeitsfeldes ist, daß ich im folgenden unter Jodel stets den Jodel im engeren Sinn verstehen werde. Damit will ich, wie schon erwähnt, keine neue Jodeldefinition vorschlagen, sondern lediglich eine für diese Arbeit brauchbare und bequeme Terminologie benützen, die den doppelten Vorteil hat sowohl der Kürze als auch der Übereinstimmung mit den engeren Jodelbegriffen in den für den Jodel in der Schweiz relevanten Werken. Was den Umfang der zur Verfügung stehenden Quellen betrifft, so zeigt sich, daß innerhalb des Jodels im weiteren Sinn der Jodel im engeren Sinn die weitaus häufigste Untergruppe darstellt. Ob dieses Verhältnis die Wirklichkeit abbildet oder ein durch das Interesse der Forscher erzeugtes Artefakt ist, wage ich nicht zu entscheiden. Bei Gaßmann (Gaßmann 1961) finden sich 7 Jodel, aber keine Juchzer und Tierlockrufe aus dem Muotatal, obgleich er solche in anderen Landschaften sehr wohl aufgezeichnet hat. Sichardt publiziert 1939 zwei Viehlockrufe und 13 Jodel aus dem Muotatal, die einzigen auf seiner Forschungsreise aufgenommen Juchzer stammen aus Lungern. Die von Zemp 1990 herausgegebene CDJüüzli'. Jodel du Muotatal
enthält einen Viehlockruf (Chueraiheli
), mehrere Juchzer und 32 Jodel. Dieses Verhältnis dürfte dem im Repertoire eines einzelnen Juuzers entsprechen. Der Landwirt Franz Dominik Betschart, den ich am 12. 4. 1996 befragte, sprach von einem Chueraiheli
und mehreren Jüüzli
, die er könne.
Sehr oft verwende ich im folgenden statt Muotataler Jodel
das im Muotatal gebräuchliche Dialektwort Juuz
. Dieses hat zwar ein etwas weiteres Bedeutungsfeld als Jodel im engeren Sinne, weil es auch die Juchzer mit einschließt (Zemp 1990). Ich gebrauche es hingegen gleichbedeutend mit Jodel im engeren Sinne, sofern vom Muotataler Jodel die Rede ist.
Außer den bereits abgehandelten Jodelbegriffen gibt es noch weitere, von denen zwei erwähnt werden sollen, weil sie in der das Muotatal betreffenden Literatur vorkommen. Die Einheimischen des Muotatals
, so berichtet Hugo Zemp, hören es nicht gerne, wenn man als Jodel das bezeichnet, was sie selber Juuz oder in der Diminutivform Jüüzli nennen.
(Zemp 1990). Im Filmtitel Juuzen und Jodeln
(Zemp 1987) benutzt Zemp diese beiden Wörter, um auf die Unterschiede in der Ausführungsweise aufmerksam zu machen, der zwischen dem traditionellen Muotataler Juuzen und dem polierten Jodel der Jodlerklubs
(Zemp 1990) besteht.
Heinrich J. Leuthold schlägt in seinem Werk Der Naturjodel in der Schweiz
(Leuthold 1981) vor, den Registerwechsel als Jodel-Definitionskriterium fallenzulassen und als Kriterium nur mehr die textlose Singweise
aufzustellen (Leuthold 1981: 11), was er nicht nur mit den zahlreichen Tralala-Melodien und Kinderjodel
begründet: Es gibt Jodel, besonders im Appenzellischen, die, bei Vermeidung des Kopfregisters, in der Barytonlage gesungen werden. Im Chor nützen allerdings die Begleitstimmen als
(Leuthold 1981: 10 f.). Da es nach meiner Kenntnis eine solche Singpraxis im Muotatal nicht gibt, möchte ich Leutholds Jodelbegriff nur als Beispiel dafür erwähnen, wie die Bedeutung des Wortes Jodel den jeweiligen Erfordernissen entsprechend verändert wird.Überstimmen
den Tonraum bis zu den Jodelhochlagen aus. Die eigentliche Jodelmelodie verzichtet auf diese Hochlagen und damit auf den Wechsel zwischen Brust‐und Kopfregister.
Nicht unerwähnt bleiben darf der Begriff des Naturjodels
, der nicht nur in Leutholds Buchtitel, sondern auch von Zemp erwähnt wird: Der mündlich überlieferte Jodel, der durch stark ausgeprägte, regionale Merkmale gekennzeichnet ist, wird heute allgemein als
(Zemp 1990). Der Begriff Naturjodel dürfte im Umfeld des Eidgenössischen Jodlerverbandes aufgekommen sein. Es sei an dieser Stelle schon angemerkt, daß nicht alle Jodellieder schriftlich komponiertes Gut aus der Heimatbewegung darstellen. In Gaßmanns Sammlung finden sich im Kapitel Naturjodel
bezeichnet bezeichnet. Dieser Begriff wurde geprägt, um den textlosen Jodel vom geschriebenen Jodellied
zu unterscheiden, welches einen strophischen Text und einen Jodelrefrain beinhaltet. Die Verbreitung dieser geschriebenen Kompositionen [...] ist eng mit der im 19. Jahrhundert aufgekommenen Bewegung der Gesangsvereine verbunden.Tanzlieder und Gsätzli
zahlreiche Lieder mit angehängtem Jodelteil (Gaßmann1961: 165 ff.).
Diese Einleitung dürfte eigentlich nicht abgeschlossen werden ohne eine operationale Definition der Begriffe Metrum, Rhythmus und Takt zu geben. Doch möchte ich dies erst nach dem Kapitel über die Geschichte der metrischen Deutungsproblematik leisten, um die mit der definitorischen Vorentscheidung verbundenen Konsequenzen an Hand des vorgestellten Materials diskutieren zu können.
14Zur Problemgeschichte der Deutung des Muotataler Jodelmetrums
Der Muotataler Jodel tritt erst relativ spät, in den frühen Dreißigerjahren, in das Blickfeld der Forschung, gelangt dann aber schnell in den Ruf des Außergewöhnlichen und sich vom Jodel in der übrigen Schweiz stark Unterscheidenden, sowohl was die metrische Struktur als auch was die Melodiebildung undDie Jodelforschung im Muotatal beginnt mit den Aufzeichnungen des Luzerner Volksliedforschers Alfred Leonz Gaßmann 1931 und 1934 (veröffentlicht 1936 und 1961) und den Tonbandaufnahmen des deutschen Musikethnologen Wolfgang Sichardt im Jahr 1936 (Sichardt 1939). In jüngerer Zeit haben sich vor allem die Volksmusikforscher Peter Betschart (Betschart 1981) und Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981) sowie der Musikethnologe Hugo Zemp mit dem Juuz auseinandergesetzt. Hugo Zemp ist die Veröffentlichung seiner ab 1979 entstandenen Feldaufnahmen in Form von einer Schallplatte (Zemp 1979) vier Filmen (Zemp 1978) und einer CD (Zemp 1990) zu verdanken. Mit diesem Material hat Franz Födermayr spektrographische Analysen durchgeführt (Födermayr 1994). Mehr am Rande des Forschungsinteresses steht der Muotataler Juuz im Werk des Musikethnologen Max Peter Baumann (Baumann 1976). Wenn ich hier zwischen Volksliedforschern
und Musikethnologen
spreche, so bezieht sich diese Unterscheidung primär auf die musikwissenschaftliche Ausbildung.
Das von John Meier 1906 initiierte Schweizer Volkslied-Sammelunternehmen stützte sich vor allem auf die Mithilfe der zahlreichen, musikalisch gebildeten Lehrerschaft*)
Einer dieser Sammelaufrufe findet sich auf der Seite 2 der Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 4 ( 1906): Die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, der Schweizerische Lehrerverein und der Verein schweizerischer Gesang‐und Musiklehrer haben beschlossen, in gemeinsamer Arbeit eine umfassende Sammlung Schweizerischer Volkslieder zu veranstalten
[...] Wir bitten deshalb Alle, die Volkslieder kennen, sie aufzuzeichnen und womöglich mit den dazugehörigen Melodien einzusenden. [...] Alle Einsendungen sind zu richten an Professor Dr. John Meier, Pilgerstraße 45, Basel.
. In zweiter Linie bezieht sich der Unterschied auf die verschiedene Theorietradition in der Ethnologie und Ethnomusikologie einerseits und der Volkskunde und Volksliedforschung andererseits. Der Unterschied tritt in der Muotatalforschung der Dreißigerjahre besonders scharf zu Tage: Sichardt war Kulturkreistheoretiker, während Gaßmann der von John Meier (Meier 1897 und 1906) begründeten Rezeptionstheorie anhing. Der Unterschied in den Theorietraditionen verringert sich in der Nachkriegszeit allmählich, weil sich sowohl in der Ethnomusikologie als auch in der Volksliedforschung eine mehr funktionalistische Betrachtungsweise durchsetzte.
Die Entdeckung der metrischen Irregularität als einer für den Muotataler Jodelstil charakteristischen Eigenschaft erfolgte durch Wolfgang Sichardt (Sichardt 1939). Ob es sich hierbei um eine Entdeckung eines wirklichen Tatbestandes handelte oder um eine Erfindung
, ist unter anderem Gegenstand meiner Untersuchung. Erfindung
ist hier nicht nur im Sinne von Paul Watzlawick (Watzlawick 1981) gemeint, sondern auch im Sinne von Ernst Klusen (Klusen 1969). Denn ein mit metrischen Irregularitäten und ungewöhnlichen Tonsystemen ausgestatteter Jodel eignete sich mehr als jede andere musica alpina dazu, zur UR-MUSIG
hochstilisiert zu werden, was nicht erst durch den gleichnamigen Kinofilm des Berners Cyrill Schläpfer (Schläpfer 1993) geschah. Die Wissenschaft selbst hat mit der Hypothese des hohen Alters und mit der Betonung der Unterschiede zur abendländischen Kunstmusik diesen populären Auffassungen den Boden bereitet.
Die Frage, wie weit für diese wissenschaftlichen und populären Auffassungen eine empirische Basis besteht, wird in der vorliegenden Untersuchung allerdings nur, was das Metrum betrifft, gestellt und – soweit es mir möglich ist beantwortet.
Der Vergleich zwischen den Ausführungen der einzelnen Autoren zeigt freilich Unterschiede auf. Alfred Leonz Gaßmanns Aufzeichnungen (1936 und 1961) stellen in der Literatur über den Muotataler Jodel die große Ausnahme dar, sie bewegen sich in ganz gewöhnlichen Taktarten. Für Wolfgang Sichardt ist der pointierte Taktwechsel
ein Charakteristikum des Muotatal-Stils
(Sichardt 1939: 130), was sich auch in seinen Transkriptionen zeigt, während Heinrich J. Leuthold, Sichardts Taktwechselschreibung kritisierend, beim Muotataler Rhythmus
auf Taktstrichsetzung verzichtet, weil ihm überhaupt jedes Metrum fehlt
(Leuthold 1981: 58) und es sich zudem um einen Rubatostil handle. Auch in letzterem Punkt ist Sichardt der konträren Auffassung: nämlich daß im Muotatal-Stil
ein gleichmäßig (
und ein metronomartig
) pulsierender Rhythmuseinheitliches Zeitmaß
herrsche im Unterschied zum wechselnde[n] Zeitmaß
im Jodelstil der übrige[n] Deutschschweiz
(Sichardt 1939: 130). Max Peter Baumann hebt Sichardts Transkriptionen lobend hervor, weil sie den Jodel nicht in ein strenges Taktschema gedrängt
hätten (Baumann 1976: 160). Der Muotataler Peter Betschart, wohl der beste Kenner des Juuz, geht auf die Frage des Metrums kaum ein (Betschart 1981) und auch Hugo Zemp macht außer einer kryptischen Anmerkung (Zemp 1990: zu Nr. 2, 12c und 14) keine Angaben zu diesem Thema. So sind wohl als gegenwärtiger Forschungsstand
noch immer die einander entgegengesetzten Behauptungen Sichardts und Leutholds anzusehen.
Gemeinsam ist den beiden Auffassungen allerdings, daß es im typischen Muotataler Jodel kein strenges Taktschema gibt, und hierin stehen ihre Notationen im Gegensatz zu denen Alfred Leonz Gaßmanns, der 1961 zwar auf die Sichardtschen Transkriptionen hinweist (Gaßmann 1961: 308), auf Sichardts Auffassung aber nicht
16
weiter eingeht. Auch Sichardt hat, soweit mir bekannt ist, zu Leutholds Kritik nicht Stellung genommen. Und wie ist es zu verstehen, daß genau die zwei Autoren, die die größte und profundeste Materialkenntnis besitzen, nämlich Betschart und Zemp, zu dieser offenen Frage nichts aussagen? Ob solche Auffassungsunterschiede tatsächlich, wie ich in meinen Untersuchungen über Volksmusik‐ und Volksliedbegriffe
behauptet habe (Fritz 1994: 121), durch die unterschiedlichen theoretischen Zugänge bedingt sind, ist zu hinterfragen. Denn die Geschichte der Deutung des Muotataler Jodelmetrums macht eher den Eindruck, als sei ein Deutungskonstrukt, einmal in die Welt gesetzt, von Autor zu Autor übergegangen und lediglich an die jeweilige theoretische Position adaptiert worden. Ein Deutungskonstrukt
deshalb, weil keiner der Autoren die Muotataler Juuzer bisher über ihre eigene metrische Auffassung befragt hat, (– zumindest finden sich darüber keinerlei Hinweise in den Publikationen). Die Unterschiede in den Deutungen sind also wohl in erster Linie durch die Methode verursacht oder, aus einer heutigen Sicht, durch ein methodologisches Manko, das der Spekulation Tür und Tor öffnete. Freilich ist die Methodologie ihrerseits nicht unabhängig von der theoretischen Grundauffasssung. Daß die Frage nach den musikalischen Konzepten
der Ausführenden in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt ist, verdankt sich theoretischen Errungenschaften. Die Theorieabhängigkeit der Jodelaufzeichnung ist jedenfalls nicht so zu verstehen, daß Sichardt zu einer taktwechselnden Auffassung gelangt wäre, weil er Kulturkreistheoretiker, Gaßmann zu einer regulärtaktigen, weil er Rezeptionstheoretiker wer und Leuthold zu einer taktlosen, weil er vom Funktionalismus beeinflußt war.
Es soll nun zunächst die Deutungsgeschichte des Muotataler Jodelmetrums überblickhaft gestreift werden und zwar in Form einer Darstellung der Positionen der einzelnen Autoren. Die Wörter Metrum, Rhythmus und Takt werden von den Autoren in unterschiedlicher und mitunter in nicht genau eruierbarer Weise verwendet. Ich verzichte darauf, diesen Bedeutungsvarianten in jedem einzelnen Fall nachzuspüren.
17Alfred Leonz Gaßmann
Alfred Leonz Gaßmann gilt als der bedeutendste Volksliedforscher der Mittelschweiz. Als ehemaliger Natursänger meines kleinen Heimatdörfchens Buchs (bei Dagmarsellen) und als Volksliedsammler der engeren Heimat (Luzerner Wiggertal und Hinterland), späterhin auch der Mittelschweiz (Entlebuch, Vierwaldstättersee, Urkantone)
, wie der Autor sich selbst beschreibt (Gaßmann 1936: 7), darf ihm sozusagen ein Heimvorteil im Verstehen der Mittelschweizer Musik zugesprochen werden. Dazu kommt seine langjährige Erfahrung: Von den in seinem letzten großen Werk (Gaßmann 1961) veröffentlichten Jodelaufzeichnungen stammt die erste aus dem Jahr 1895, die letzte aus dem Jahr 1950. Gaßmann war ein Volksliedforscher der alten Schule. Er hat wahrscheinlich nie einen Phonographen oder ein Tonbandgerät benutzt. Außer der bereits erwähnten Rezeptionstheorie vertrat Gaßmann die Auffassung, daß die Landschaftsform den Musikstil präge (Gaßmann 1936).
Gaßmann verwendet ausschließlich die Mittel der konventionellen Notenschrift.
Das macht seine Jodelaufzeichnungen für meine Fragestellung nicht unbrauchbar, geht es doch um die metrorhythmischen Konzepte, und zur Wiedergabe derselben ist die konventionelle Notenschrift sehr wohl ein geeignetes Mittel. Die Voraussetzung ist allerdings, daß diese Konzepte auch wirklich verstanden wurden. Und wenn der Jodelstil des Muotatals sich tatsächlich so fundamental von den Jodelstilen der übrigen Mittelschweiz unterscheidet, wie Wolfgang Sichardt und Heinrich J. Leuthold behaupten, dann könnte von einem Heimvorteil im Verstehen
in diesem Falle nicht ausgegangen werden.
Eine metrorhythmische Besonderheit des Muotataler Jodels existierte für Gaßmann nicht. Ein kleiner Zahlenvergleich möge das unterstreichen: Von den 30 Jodeln, die er 1961 veröffentlichte (Gaßmann 1961: 179﹣197), sind sieben aus dem Muotatal. Davon ist ein einziger mit Taktwechsel geschrieben, die übrigen sechs weisen reguläre Taktschemata auf, während hingegen von den fünf im ebenfalls im Kanton Schwyz gelegenen Ort Goldau aufgezeichneten Jodeln drei mit Taktwechsel notiert sind. Unter den sechs Jodelaufzeichnungen aus Weggis im Kanton Luzern ist eine taktwechselnd, die übrigen fünf nicht.
Hingegen unterscheidet Gaßmann einen Typus des Schwyzerjodels
von einem Typus des Mittelschweizer Voralpenjodels
. Ihre Spezifika sieht er im Harmonischen, siehe Gaßmanns Erläuterungen zu den beiden Aufzeichnungen aus Goldau (Notenbeispiele 1 und 2, – mit Schwyz
dürfte hier nicht der Kanton, sondern dessen Hauptort samt Umgebung gemeint sein). Dazu eine Erläuterung: In der Sammlung Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland
(Voralpengebiet) schreibt Gaßmann, daß die mehrstimmige Ausführung dieser Jodel [...] mittelst des tonischen und Dominant-Dreiklanges, auch Dominant-Septimen-Akkordes [geschieht]. Verhältnismäßig wenig kommt der Unterdominant-Dreiklang zur Anwendung; mitunter beim Übergang in den 2. Teil (im 1. Takt des 2. Teiles).
(Gaßmann 1906: 174). [Dieses Zitat wurde für diese Ausgabe vollständig von Seite 19 auf Seite 17 verschoben.]
18
Gesungen von Lehrer Jos. von Euw, Goldau 1925. Dieser Jodel wird in höchster Stimmlage mehr gekrächzt als gesungen. Vielleicht wird damit der urwüchsige Klang des Büchels der Kehle abgerungen. Auffallend ist beim Schwyzerjodel, daß neben den Dreiklangstönen der Hauptakkorde auf der I., V., und IV. Stufe auch die Nebendreiklänge der II., III. und VI. Stufe angetönt werden.
(Gaßmann 1961: 309). Gesungen von Lehrer Jos. von Euw, Goldau 1925. Dieser Jodel schlägt aus der Schwyzer Rasse; die Wendung zur Unterdominante zu Beginn des 2. Teils hat er mit dem Mittelschweizer Voralpenjodel
des Entlebuchs und des Luzerner Hinterlandes gemein.
(Gaßmann 1961: 310).
Schwyzerjodel
als untypisch an. Da die Harmonik später behandelt werden soll, sei hier abgebrochen und zur Frage des Rubato weitergegangen.
Gaßmanns Angaben zu Rubato und Tempowechsel ermöglichen es, die sieben Muotataler mit den 23 übrigen Mittelschweizer Jodelaufzeichnungen zu vergleichen. Hierzu wurden die 30 Aufzeichnungen auf diesbezügliche Angaben hin untersucht und die Zahl der Aufzeichnungen, in denen eine bestimmte Klasse von Angaben vorkommt, bestimmt und in die untenstehende Tabelle eingetragen. Dann wurde jeder Spalte die Anzahl der Aufzeichnungen, die die genannte Eigenschaft haben, gleich 100% gesetzt und der Prozentanteil der Muotataler Aufzeichnungen bestimmt.

Wie die Tabelle zeigt, hat nur jeweils eine der sieben Muotataler Jodelaufzeichnungen die in der jeweiligen Spalte genannte Eigenschaft, was, je nach Anzahl aller Mittelschweizer Jodel mit dieser Eigenschaft, verschiedene Prozentsätze ausmacht. Ein Prozentsatz unter 23% bedeutet, daß die Muotataler Aufzeichnungen die genannte Eigenschaft in geringerem Ausmaß besitzen, als es ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Aufzeichnungen entspricht. Bei einem Prozentsatz über 23% ist es umgekehrt. Der Korrelationskoeffizient gibt den Zusammenhang zwischen der genannten Eigenschaft und der Eigenschaft Muotataler
an. Um zu beurteilen, ob die errechneten schwachen Korrelationen nicht sogar mit der Hypothese verträglich sind, daß in der Grundgesamtheit (aller Mittelschweizer Jodelaufzeichnungen, die Gaßmann hätte machen können, wenn er unermeßlich viel
20
Zeit dazu gehabt hätte,) zwischen der genannten Eigenschaft und dem Aufzeichnungsort gar kein Zusammenhang besteht, müßte ein Test auf stochastische Unabhängigkeit gemacht werden. Leider ist das wegen der geringen Anzahl der Muotataler Aufzeichnungen und/oder Aufzeichnungen mit der genannten Eigenschaft nicht möglich. Am wenigsten aussagekräftig sind aus demselben Grund jene Werte, die für die Fragestellung am wichtigsten wären, nämlich die Zahl der Fermaten im Melodieverlauf und die Tempoänderungen im Melodieverlauf. Die beiden etwas aussagekräftigeren Werte besagen, daß Schlußritardandi und Tempowechsel am Beginn des 2. Teils im Muotatal eher seltener sind als in den übrigen Mittelschweizer Aufzeichnungsorten. Wie irreführend es sein kann, aus kleinen Stichproben Schlüsse zu ziehen, zeigt jedoch die Zeile einteilige Jodel
: 3 von 7 Muotataler Jodeln sind einteilig, in dem im selben Jahrzehnt
*)
*) Gaßmanns Muotataler Jodelaufzeichnungen stammen größtenteils aus den 30er Jahren.
aufgenommenen Feldforschungsmaterial Wolfgang Sichardts (Sichardt 1939) sind es nur 2 von 13. Die vier Korrelationskoeffizienten indizieren also, wenn sie überhaupt etwas indizieren, ein geringeres Ausmaß an Abweichungen vom Gleichlauf des Metrums beim Muotataler Jodel im Vergleich zu den übrigen von Gaßmann beforschten Jodellandschaften und somit das Gegenteil dessen, was der Innerschweizer Jodelforscher Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981) behauptet.
Einen signifikanten Zusammenhang zeigt allerdings der Vergleich zwischen Gaßmanns Aufzeichnungen im Kanton Schwyz (Goldau, Seewen und Muotatal) und seinen Aufzeichnungen in den zum Kanton Luzern gehörenden Landschaften Entlebuch und der Gegend um den Rigi (Vitznau und Weggis). Diese Stichprobe umfaßt 27 der 30
1961 veröffentlichten Jodel. (Die restlichen drei stammen aus Ober‐ und Unterwalden). Der signifikante Zusammenhang besteht in der Schlußritardandonotierung:
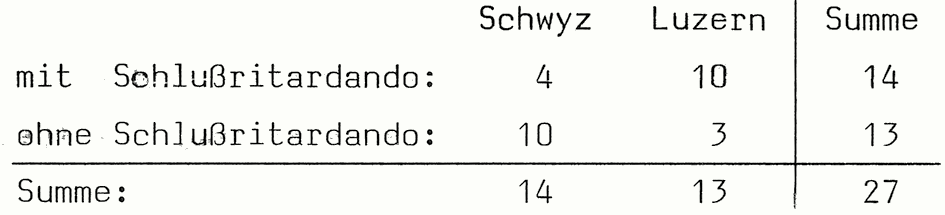
enen.
(In diesem Fall sind die Untergruppen groß genug, daß ein solcher Schluß zulässig ist. Siehe Schlittgen (Schlittgen 1995: 401 f.)). Dies bedeutet jedenfalls, daß Gaßmann in Weggis, Vitznau und im Entlebuch zusammen mehr zur Schlußritardandonotation neigte als in Goldau, Seewen und im Muotatal zusammengenommen. Da sich nicht erweisen läßt, daß Gaßmanns Notationepraxis sich geändert hat, – sie scheint über all die Jahre hindurch gleich geblieben zu sein –, muß wohl angenommen
21
werden, daß der Unterschied in der Musik lag. (Aus dieser Statistik darf allerdings nicht auf einen Unterschied zwischen den beiden Kantonen schlechthin verallgemeinert werden: In Gaßmanns Arbeit über das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland
(Gaßmann 1906) hat von den 10 veröffentlichten Jodeln nur ein einziger ein Schlußritardando eingezeichnet).
Da Gaßmanns Muotataler Jodelaufzeichnungen im zweiten Teil einzeln behandelt werden sollen, sei hier abgebrochen, freilich nicht ohne anzumerken, daß Gaßmann bei keinem einzigen der 7 von ihm veröffentlichten Muotataler Jodeln ein Alphorn-fa
notiert, während er dasselbe in Seewen und Goldau sehr häufig schreibt (mittels des einzigen von ihm verwendeten diakritischen Zeichens oder mittels Fußnote oder als lydische Quart). Das gänzliche Fehlen eines Hinweises auf das Vorkommen des Alphorn-fa
im Muotataler Jodel ist ein weiterer Punkt, in dem sich Gaßmanns Aufzeichnungen nicht nur von denen Sichardts und Leutholds auffallend unterscheiden, sondern auch von den von Hugo Zemp veröffentlichten Feldaufnahmen. Ein weiterer Unterschied besteht im Repertoire: Während sich das Material Sichardts mit dem Leutholds und Zemps zu einem großen Teil deckt, kommen die von Gaßmann aufgezeichneten Jodel bei den anderen Autoren nicht vor. Gaßmanns sieben Muotataler Jüüz' stammen von mindestens vier verschiedenen Personen, es ist also auch nicht anzunehmen, daß er einen vom Durchschnitt abweichenden Personalstil aufzeichnete.
Wolfgang Sichardt
Wolfgang Sichardts Schweizer Forschungsreise im Sommer 1936, die ihn zu den Aufnahmeorten Appenzell, Neßlau, Kerns (Obwalden), Lungern, Muotatal, Mathon (Rätoromanisches Gebiet), Brigerberg (bei Brig), Vissoyé (Val d'Annivers, Unterwallis) und Neirivue (Westschweiz) führte und bei der er außer Jodelgesängen, Juchzern und Rufen auch Viehlockrufe und Kuhreigen, Alpsegen, Lieder und Jodellieder sowie einige Alphornweisen aufnahm, war die erste, die sich der modernen Tonbandtechnik bediente: Zur Tonaufnahme diente das neu herausgebrachte Magnetophongerät der AEG, das die vom Standpunkt der musikwissenschaftlich-volkskundlichen Aufnahmearbeit wünschenswerten technischen Voraussetzungen in hohem Maße erfüllt [...] Besondere Vorzüge sind Betriebssicherheit und Ungezwungenheit der Aufnahmen. [...] Für die Bereitstellung des Aufnahmegerätes bin ich der AEG, für die Überlassung eines hochwertigen Aufnahmemikrophons der Telefunken-Gesellschaft zu besonderem Dank verpflichtet.
(Sichardt 1939: 2 f.).
Sichardts Absicht war es, älteres Stilgut aufzufinden
(Sichardt 1939: 2). Das gelang ihm seiner Auffassung nach im Appenzellerland und im Muotatal, das sich ihm als wahre Fundgrube archaischer Melodik
erwies (Sichardt 1939: 29). Das Muotatal war als Reisestation ursprünglich wohl gar nicht eingeplant: Während meiner Aufnahmetätigkeit in Lungern hörte ich verschiedentlich von dem seltsamen Jodeldialekt des Muotatals. Man konnte ihn nicht recht beschreiben, aber soviel ging klar aus den Schilderungen hervor, daß es sich melodisch wie klanglich um etwas durchaus Eigenartiges, von den gemeinüblichen Schweizer Jodlern Abweichendes handeln mußte. In diesen Erwartungen sah ich mich bei den Aufnahmen nicht getäuscht. Ich fand nur verhältnismäßig wenig neues Melodiegut, viel Barockmelodik und als gewinnbringendste Ausbeute schließlich eine beträchtliche Anzahl von Melodien höchsten Alters. Unzweifelhaft handelt es sich bei diesem Altstil um eine vorgregorianische, also in vorchristlicher Zeit wurzelnde Schicht.
(Sichardt 1939: 29. Hervorhebung durch Sichardt).
Sichardts Muotataler Aufnahmen umfassen:
- 11
Solojodel
(8 davon veröffentlicht) - 8
Jodelduette
(5 davon veröffentlicht) - 2
Viehlockrufe
(beide veröffentlicht) davon einKuhreigen
- 1
Alpsegen, gesprochen
(nicht veröffentlicht) - 8
Alphornmelodien
(alle veröffentlicht).
Die Bezeichnungen Solojodel
und Jodelduett
beziehen sich auf die Interpretation.
Zwei der solistisch interpretierten Jodel kommen auch in der Duettvariante vor.
Eine Informanten-Familie dürfte dieselbe gewesen sein wie in Gaßmanns Muotatal-Forschung von 1931, nämlich die Familie Ablondi. (Die Namen Suter, Gwerder und Betschart sind im Muotatal so häufig, daß sich im Nachhinein kaum mehr eruieren
23
läßt, wer die Informanten Gaßmanns und Sichardts waren. Ablondi ist hier eine seltene Ausnahme. Marie Ablondi, deren Mädchenstimme Sichardt 1936 aufnahm, lebt heute in einem Altersheim). Trotz dem und trotz der zeitlichen Nähe der beiden Forschungen ist den von den beiden Forschern veröffentlichten Materialien, wie bereits erwähnt, kein einziger Jodel gemeinsam. Ebensowenig tritt in Sichardts Feldaufnahmen die Dreistimmigkeit auf, in der die Jüüzli laut Hugo Zemp vorzugsweise
(Zemp 1990) ausgeführt werden. Allerdings entstanden Zemps Aufnahmen 43 Jahre später. Und Gaßmanns Aufzeichnungen sind grundsätzlich immer einstimmig, auch in Sammlungen, in denen er über Mehrstimmigkeit berichtet.
Bei dem von Sichardt aufgenommenen Alphorn
handelt es sich übrigens nicht um die bekanntere gerade Form der Holztrompete, sondern um die die in der Zentralschweiz heute üblichere gewundene Form, die von den Einheimischen Büchel
genannt wird. Sichardt hat den Bläser mit dem Instrument, mit dem sämtliche in Muotatal aufgenommenen Melodien
ausgeführt wurden (Sichardt 1939: 96), fotografiert.
Der von mir im Frühling 1996 befragte Büchelbläser Moritz Trütsch erkannte auf dem abgedruckten Foto (Sichardt 1939: 96) den Büchelbläser Franz Gwerder z' Chrümmelers, geb. 1900, und dahinter die heute nicht mehr existierende Dorfwäschehütte von Muotathal. Um einen anderen Franz Gwerder könne es sich gar nicht handeln, weil es nicht viele Büchelbläser gegeben habe und die paar, die es gegeben habe, seien alle bekannt.
Sichardt versucht in der drei Jahre nach seiner Forschungsreise publizierten Arbeit Der alpenländische Jodler und der Ursprung des Jodelns
(Sichardt 1939), von der monographischen Grundlage ausgehend [...] einen Ausblick in die angrenzenden musikethnologischen Probleme zu geben
(Sichardt 1939: 1). Das bedeutete auch, die Frage nach dem Ursprung des Jodelns im Sinne der von Sichardt vertretenen Kulturkreistheorie zu behandeln. Der Autor gelangt zu der folgenden Auffassung: Die ursprünglichen Trägervölker des Jodelns sind Angehörige der melaniden, mittelländischen und verwandter Rassen, Urheber mutterrechtlicher, pflanzerischer Kulturen.
(Sichardt 1939: 167). Da sich Max Peter Baumann eingehend mit dieser Hypothese auseinandersetzt (Baumann 1976: 112 ff.), die wohl heute nicht mehr vertreten wird, möchte ich ihre Darstellung so kurz wie möglich halten: Durch Kulturwanderung etc habe sich das Jodeln weltweit verbreitet, wobei es zu Umbildungen
, Neuprägungen
und schöpferische[n] Fortbildungen
kam. Letzteres sei im Alpengebiet der Fall. Im Muotatalstil leben vermutlich Überbleibsel eines vorgermanischen, keltisch-helvetischen Volkstums fort, in den Hauptgebieten der Ostalpen und der Schweiz trägt westgermanisches Volkstum (im bajuwarischen auch ostgermanische Einschläge) ältere wie neuere Stilschichten.
(Sichardt 1939: 167). Die Anknüpfungspunkte, die die schöpferische Fortbildung ermöglicht hätten, seien in Ähnlichkeiten
24
[...] des melodischen Konsonanzempfindens
gelegen, der mutterrechtliche
(Sichardt 1939: 167 f.). Die Urjodler
ging vermutlich von der Terz‐ und Dreiklangssphäre
des 1. Formenkreises aus, der westgermanische Jodler nimmt die Schichtterz
der Aszendenzmelodik als aufbauende Keimzelle, der möglicherweise keltisch beeinflußte Muotataljodler endlich übernimmt vor allem die konsonanten Sexten des hypothetisch angenommenen Urjodlers, baut sie aber in ein Distanzsystem von Quartbeziehungen ein.angrenzenden Gattungen
jedoch, Alphorn‐ und Rindentrompetenmelodik, Viehlockruf, Kuhreigen und Alpenbetruf, wurzeln gleichfalls in sehr alten aber vom Jodlermelos ursprungsverschiedenen Schichten
, sie entspringen im weit ausgebreiteten Kreise der eurasischen Hirtenkultur
(Sichardt 1939: 168, Hervorhebung durch Sichardt). Die Ursprungsverschiedenheit von Viehlockruf (einschließlich Kuhreigen) und Jodel ist aus meiner Sicht der interessanteste Punkt dieser Hypothese. Sie wäre in dieser Form nicht möglich, könnte sie sich nicht auf einen musikalisch-stilistischen Unterschied gründen.
Dieser wird von Autoren, die im Jodel nichts weiter erblicken wollen als eine musikalisch und funktional etwas bereicherte Abart oder Weiterentwicklung des Viehlockrufs, übersehen.
Sichardt ordnet sein Material nach zweierlei Prinzipien: historisch-stilistisch und geographisch-stilistisch. Beide Einteilungen stehen quer zueinander, einem Jodel kommen sowohl geographische als auch historische Stilmerkmale zu. Die Konstituenten der geographischen Sonderstellung des Muotatalstils
faßt Sichardt in folgendem Vergleich zusammen (Sichardt 1939: 130 f.):
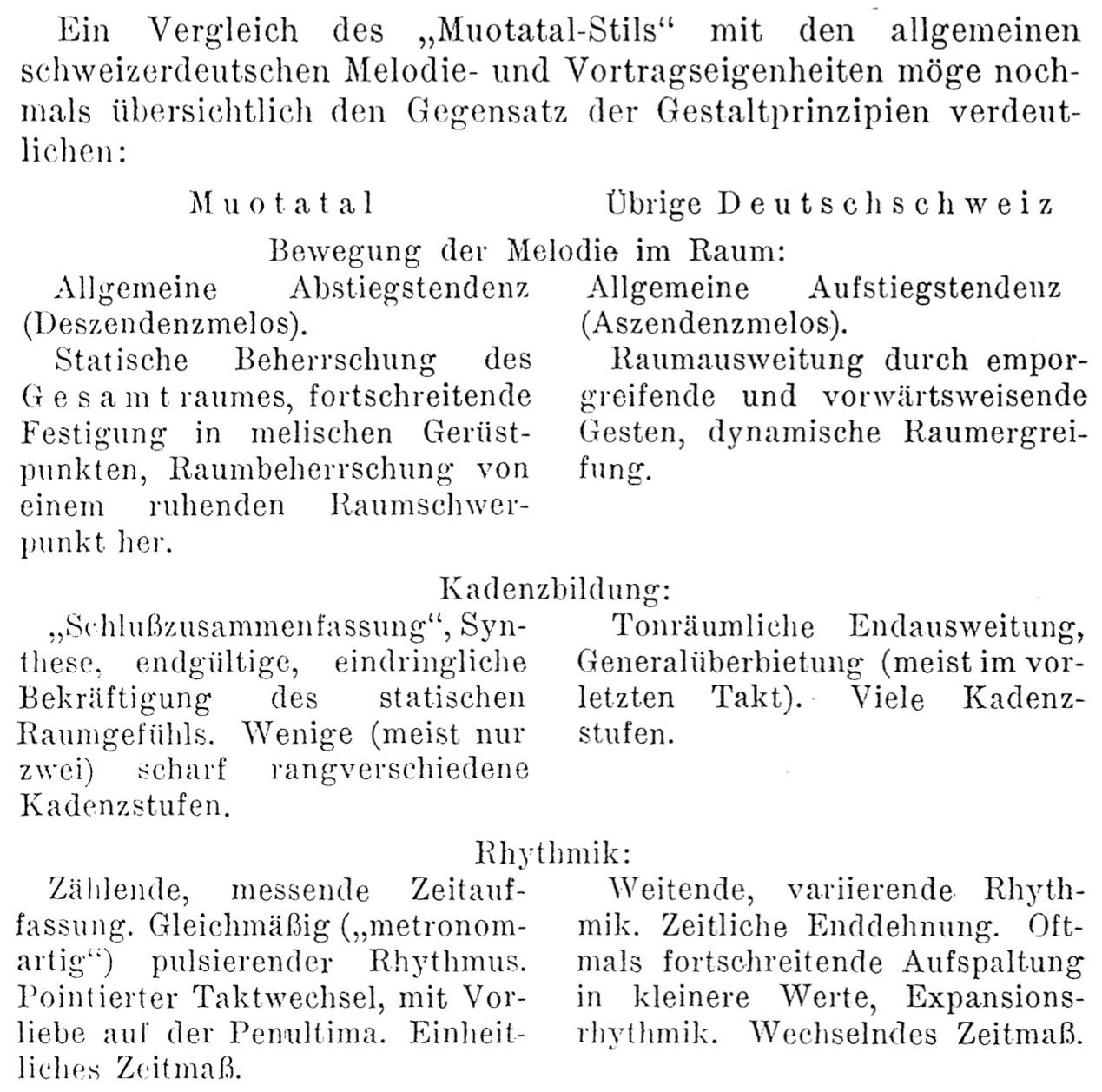
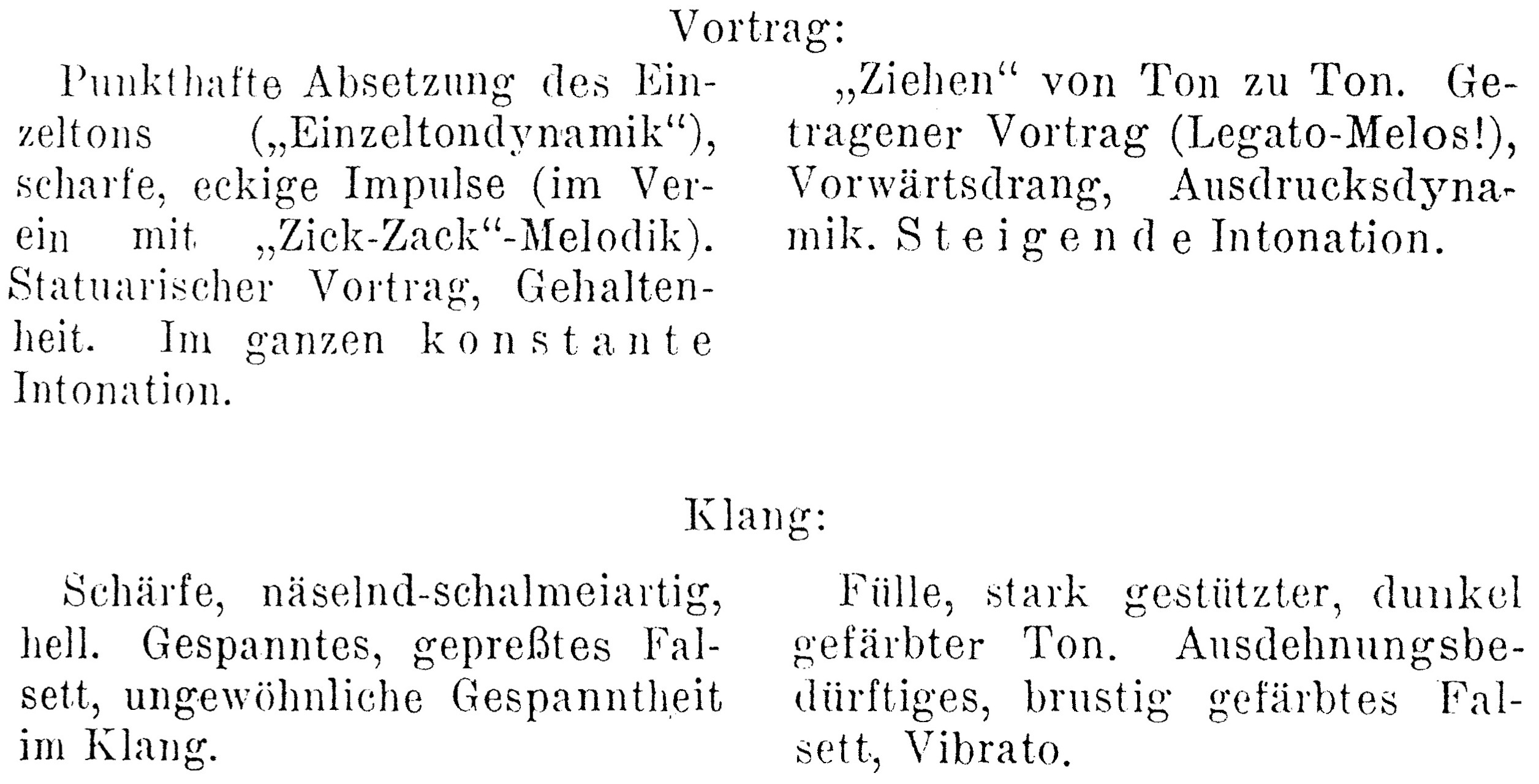
Keinen deutschschweizerischen Jodelstil außer dem des Muotatals fand Sichardt so eigenartig und von den anderen so weit abweichend, daß er ihn allen anderen deutschschweizerischen Jodelstilen in dieser Form gegenüberstellte. Diese Unterschiede werden auch in den Transkriptionen und in den ihnen beigefügten Erläuterungen sichtbar.
Sichardt unterscheidet nicht nur nationale und landschaftliche Stile
(Sichardt 1939: 119 ff.), sondern, wie bereits angemerkt, auch historische Stilschichten
(Sichardt 1939: 4 ff.) und zwar Jüngste Schicht
, Barock
, Renaissance
, Mittelalter
und Vorgregorianische Schicht
. Die dreizehn veröffentlichten Muotataler Jodel verteilen sich auf drei der fünf Stilschichten. Vier Jodel schätzt Sichardt als Barockjodler
ein (Sichardt 1939: 14 ff. Nr. 19﹣22). Als eine volksmäßige Abwandlung ältesten abendländischen Organalstils
(Sichardt 1939: 27) gelten ihm drei zweistimmig gesungene Jodel und zwar der Struktur dieser Zweistimmigkeit wegen (Sichardt 1939: 28 f. Nr. 36﹣38). Die sechs übrigen ordnet er der vorgregorianischen Schicht
zu, was er nicht mit dem Alphorn-Fa
begründet, das sich auch in Melodien jüngerer Prägung
finde (Sichardt 1939: 31), sondern mit Einzelzügen struktureller und vortragsmäßiger Art
: Von den bekannten Jodlertypen harmonikalen Gepräges unterscheidet sich der Altstil des Muotatals aufs schärfste. Die großen Sprungintervalle, namentlich Sexten und Septimen, haben hier keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion. Der Tonraum erscheint wie ausgemessen und in hohem Maß distanzmäßig charakterisiert. Die Quart gewinnt als Melodieschritt, das Tetrachord als Melodierahmen und Gerüstbeziehung besondere Bedeutung. Von unverkennbarer Eigenart sind Tonbildung und Singart. Fast punktförmig, kaum durch Portamento verbunden, reihen sich die Einzeltöne aneinander. Die Tongebung selbst ist klein und fest, von eigentümlich schalmeihafter Schärfe und Gespanntheit. In der Vokalisation überwiegt der gleichfalls schalmeihaft gefärbte ä-Klang. Sehr bezeichnend ist das rasch absteigende Schlußglissando. Dasselbe urwüchsige Portamento kehrt auch bei den ältesten Jodlern im Appenzell wieder [...], doch erscheint es in den Gesängen des Muotatals noch schärfer ausgeprägt.
(Sichardt 1939: 30 f). Siehe zwei dieser
26
sechs Jodel (Sichardt 1939: 36 ff. Nr. 45﹣50) in Notenbeispiel 3 und 4.
Während Sichardts Urprungshypothesen heute wohl veraltet sind, bleiben seine Transkriptionen gültig. Sie stehen in der Transkriptionstradition der Berliner Schule. Sichardt verwendet folgende diakritische Zeichen (Sichardt 1939: X):

- Agogische Dehnung

- Erhöhung um etwa einen Viertelton

- Vertiefung um etwa einen Viertelton

- Beständige Erhöhung oder Vertiefung der betreffenden Töne um etwa. einen Viertelton

- Tetrachordale Rahmenbeziehung

- Tetrachordale Rahmenbeziehung und zugleich Hinweis auf die Quarte als Tonschritt

- Pentachordale Rahmenbeziehung

- Pentachordale Rahmenbeziehung und zugleich Hinweis auf die Quarte als Tonschritt

- Hinweis auf strukturbedeutsame Terzen

- Glissando, Portamento zwischen zwei festen Tonstufen

- Portamento von unbestimmter zu fester Tonhöhe

- Stark absinkendes Schlußportamento

- Sehr gebunden, legatissimo
Dazu kommt noch die Fermate als Zeichen für Dehnung und die auf den Kopf gestellte Fermate als Zeichen für Kürzung. Das Zeichen Agogische Dehnung
(s. o.) verwendet Sichardt übrigens nur ein einziges Mal, und zwar bei einem Appenzeller Jodel (Sichardt 1939: 31 Nr. 39).
Sichardts Transkriptionen sind die genauesten, die in der Literatur über den Muotataler Jodel zu finden sind. Sichardt notiert nicht nur das Alphorn-Fa
, sondern auch die neutralisierte Terz, Eigenschaften, die durch die von Hugo Zemp (Zemp 1979 und 1990) und Franz Födermayr (Födermayr 1994) vorgenommenen Messungen bestätigt wurden. Jede Transkription ist mit einem ausführlichen Kommentar versehen. Dieser beinhaltet, wenn man das so trennen kann, einerseits Deutungen andererseits Beschreibungen. Die Unterscheidung zwischen Deutung und Beschreibung meine ich nicht als strenge Dichotomie, sondern als zwei Extreme, zwei Pole, zwischen denen sich die einzelnen Aussagen des Kommentars befinden. Alle diese Aussagen fußen auf Beobachtungen, doch sind sie in unterschiedlich hohem Grad deutungshältig. Dem Charakter eines bloßen Beobachtungssatzes
näher sind die Aussagen über Klang, Tonansatz, Vokalisation, Dynamik, Intonation, Artikulation, Phrasierung und Rhythmik; deutungshältiger sind die Sätze
27
über Tonsystem, Harmonik, Stil, Formschema und Metrum. Warum ich Sichardts Äußerungen über die Rhythmik zu den deutungsärmeren, seine Aussagen über die Metrik zu den deutungsreicheren und vom Höreindruck entfernteren Sätzen zähle, hat folgenden Grund: Es bedarf einer weniger hohen Interpretationsleistung, das Vorhandensein eines gleichmäßigen Pulses oder die rubatomäßige Abweichung von diesem Gleichlauf zu erkennen als die Betonungsverhältnisse des Metrums zu erfassen. Man kann z. B. hören, daß eine Tonfolge vor dem Hintergrund eines regelmäßigen Pulses abläuft, ohne noch zu wissen, wo die Eins ist
. Unter dem Terminus Rhythmus
beschreibt nun Sichardt gerade das Verhältnis der Tonabfolge zum gleichmäßigen Puls. Dieser ist zwar ebenfalls ein Deutungskonstrukt des Hörers, beinhaltet jedoch weniger Interpretationsleistung als das Verstehen der metrischen Betonungsverhältnisse, wenn sie, wie beim Jodel, latent sind. Und darauf will diese ganze Argumentation hinaus: daß Sichardts Aussagen zum Rhythmus
mehr Vertrauen geschenkt werden darf als seinen Äußerungen zum Metrum.
Sichardts Kommentare lassen, wenn man diese Argumentation als stichhaltig betrachtet, keinen anderen Schluß zu als daß der Interpretationsstil der acht Muotataler Informanten im Jahre 1936 kein Rubatostil war – im Unterschied zum Interpretationsstil, den Sichardt im Appenzell antraf. Sichardts Äußerungen über die Rhythmik der einzelnen transkribierten Jodel sind folgende (die Nummern sind die der Notenbeispiele im Kapitel Historische Stilschichten im alpenländischen Jodler
(Sichardt 1939: 4﹣40)):
Muotatal: Nr. 19: Der feste rüstige Schritt des Generalbasses beherrscht das Ganze.
Nr. 20: ... mit sehr prägnanter, klarer Artikulation, Tongebung und Rhythmik. [...] Generalbaßartig schreitende Rhythmik, an barocke Tanztypen wie Menuett und Passepied erinnernd.
Nr. 21: Gemessene Melodiebewegung, tonräumlich wie rhythmisch.
Nr. 22, 36, 37, 38, 45: Keine Äußerungen zur Rhythmik.
Nr. 46: ... Diese formale Kleingliederung wird stark unterstrichen durch Auftaktbeschleunigung und Dehnung der Endungen, die hier jedoch nicht im Sinne agogischer Dehnungsrhythmik, sondern eher als Verschärfung des grundsätzlich zeitmessenden, außerordentlich zielstrebig verlaufenden Bewegungsablaufes aufzufassen sind. Im abschließenden, kodaartigen Formteil [...] überstreicht die Bewegung nunmehr in streng gemess
Nr. 47: sener Taktrhythmik zäsurlos-linear den gesamten beherrschten [Ton-]Raum.Gemessene Rhythmik.
Nr. 48: Streng gemessene, dehnungsfreie Rhythmik.
Nr. 49:
Nr. 50: Keine Äußerung zur Rhythmik.Modale
, zeitmessende Rhythmik mit starker Betonung der zweiten Schlagzeit.
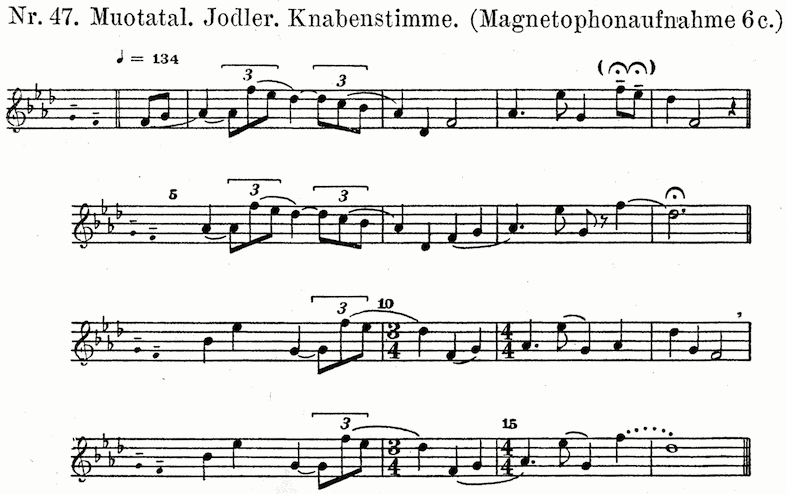

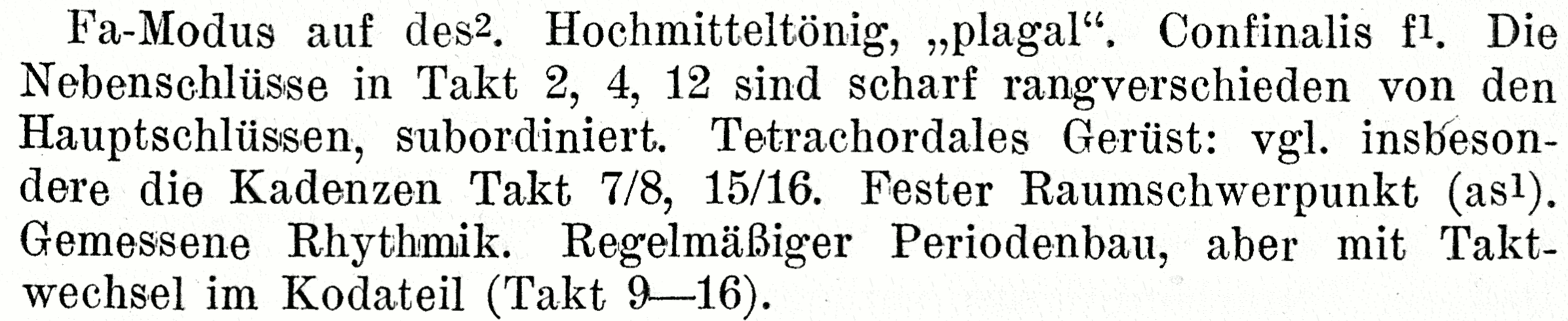
Notenbeispiel 3 (Sichardt 1939: 37. Kommentar ebd.: 38).
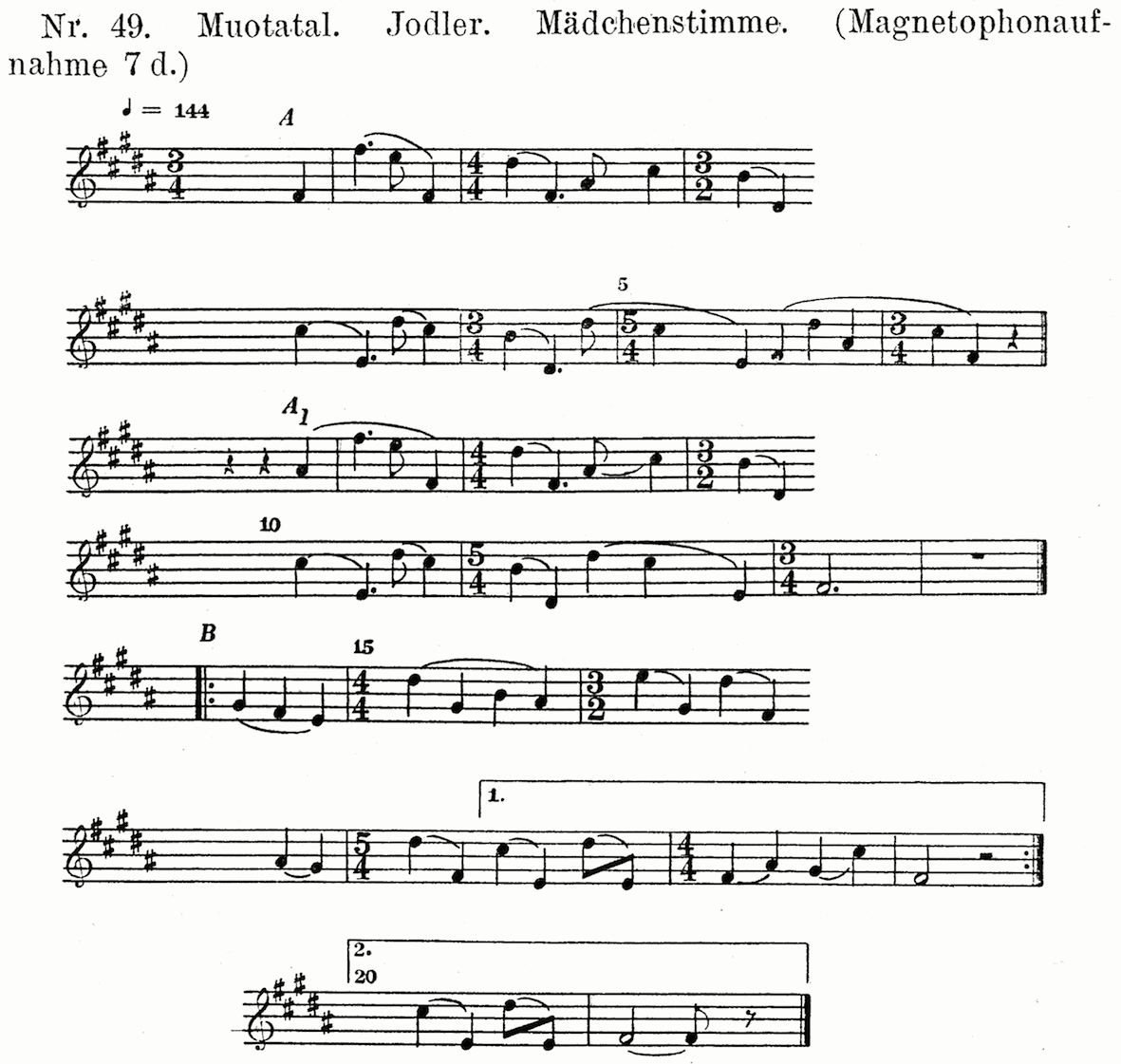

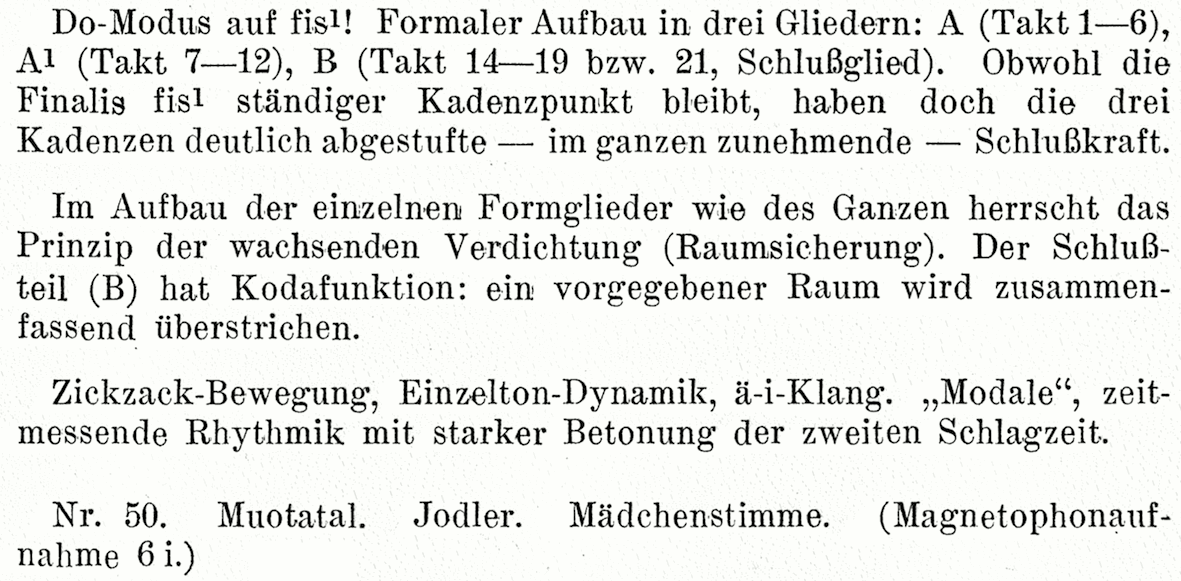
Modale
, zeitmessende Rhytmik mit starker Betonung der zweiten Schlagzeit.)Notenbeispiel 4 (Sichardt 1939: 38 f).
Sämtliche Spitzentöne erfahren ausdrucksvolle Dehnung. [...] Agogische Rhythmik.Nr. 23:
Sehr frei in Zeitmaß und Rhythmus, mit zahlreichen irrationalen Dehnungen und Beschleunigungen. [...] ausdruckshafte Dehnung aller Gipfeltöne.Nr. 24:
Dreiteilige Form: A : Aufstellung, rhythmisch sehr frei, B = Verarbeitung, etwas regelmäßiger im Rhythmus, C = schnelle Koda, taktmäßig. [...] Ausgeprägt agogische Rhythmisierung in allen Teilen. Spitzentöne ausdrucksvoll gedehnt.Nr. 39:
Freie, sehr agogisch betonte Rhythmik.Nr. 44:
eigentümlich irrational verdehnte Rhythmik mit starker agogisch-ausdruckshafter Hervorkehrung der Spitzentöne. Hinsichtlich der Zeitwerte ist die Notierung nur als Annäherung aufzufassen. Es dürfte schwer, wenn nicht unmöglich sein, die Fülle der irrationalen Züge dieser Rhythmik und Vertragsart graphisch festzuhalten.
Da die Rhythmik in Sichardts doppelter Einteilung nicht als historisch‐, sondern als geographisch-stilistisches Merkmal auftritt, kommt Sichardt im Kapitel Nationale und landschaftliche Stile
(Sichardt 1939: 119﹣138) noch einmal auf dieses Thema zu sprechen. Aufbauend auf Überlegungen von W. Danckert (Danckert 1939: 15 f.) begreift er die Rhythmik als Teil eines Komplexes zusammengehöriger Merkmale.
Er unterscheidet zwei Merkmalskomplexe: den Form‐ und Ausdrucksbereich des von Danckert so genannten Aszendenzmelos
(Sichardt 1939: 121) und den des Deszendenzmelos
(Sichardt 1939: 120 und 129 ff.). Diese Dichotomie setzt Sichardt mit dem Stilunterschied zwischen dem Muotatal und der übrigen Deutschschweiz gleich: Aus dem im ganzen einheitlich
(Sichardt 1939: 129). (Siehe auch obige Gegenüberstellung).aszendenzmelodischen
Stilbereich der deutsch-schweizerischen Alpenländer fällt ein Landschaftsgebiet heraus: das in der Zentralschweiz gelegene Muotatal. Wir treffen hier einen Sing‐ und Musizierstil an, dessen Grundprinzipien sich aufs schärfste von der deutschschweizerischen Gemein-Mundart abheben.
Die Rhythmik ist in diese Konstruktion miteinbezogen: Die Rubatointerpretation gehört zum aszendenzmelodischen, die Nonrubatointerpretation zum deszendenzmelodischen Form‐ und Ausdrucksbereich, diese also zum Muotatal, jene zu den übrigen deutschschweizerischen Landschaften. Auffällig ist, daß in der Beschreibung der beiden Merkmalskomplexe Parallelen oder Analogien zwischen Melodischem, Rhythmischem, Artikulatorischem und Klanglichem bemüht werden: Den aszendenzmelodischen Stil exemplifiziert Sichardt an Hand eines Musterbeispiels, des Appenzeller Jodels Nr. 15, wie folgt: Die größere Verdichtung liegt in den aufwärts gerichteten Bewegungszügen. [...] Durch ein
(Sichardt 1939: 120 f.). Der melodischen gestisches
Emporgreifen wird diese Aufstiegsbetontheit weiterhin bekräftigt. [...] Im Rhythmischen sind verwandte Züge zu bemerken: [...] Ein Vorwärtszug ist für den rhythmischen Ablauf kennzeichnend (nicht die gleichmäßig pulsierende Rhythmik, die sich mit dem Deszendenzmelos verbindet.) Agogische Drängungen und Dehnungen
30
variieren das Grundzeitmaß. Auch die Vortragsweise erscheint dynamisch belebt: getragener, ausdrucksvoller Vortrag, langatmiges Legato und drängende Klein-Dynamik. Schließlich steigende Intonation.Aufstiegsbetontheit
entspricht also im Rhythmischen ein Vorwärtszug
und agogische Drängungen und Dehnungen
, ferner eine drängende
Dynamik und eine steigende
Intonation. Ebensolche Gleichnisse enthält die Beschreibung des zweiten Musterbeispiels für den aszendenzmelodischen Merkmalskomplex und für die übrigen deutschschweizerischen Landschaften
, des Appenzeller Jodels Nr. 23: Auch in dieser Melodie weitet sich der Raum in großen, gestisch betonten Bewegungen nach oben. [...] Der rhythmische [...] Strom drängt unaufhörlich vorwärts. Der Vortrag ist durch und durch expansiv. Agogische Dehnungen unterstreichen die emporgreifenden Bewegungen im Sinne der Weitung und des Ausgriffes. Der Grundzug der Weitung herrscht auch im Bereich des Klanglichen: ein äußerst fülliger Klang bei stark gestütztem, oft vibrierendem Ton wird angestrebt.
(Sichardt 1939: 121. Hervorhebungen durch Sichardt). Hier ist es außer dem Vorwärtsdrängen und Emporgreifen auch der Begriff der Weitung und Expansion, der die Merkmalsebenen verklammert. Gleichnisse zeigen sich auch in der Beschreibung des dem Deszendenzmelos zugeordneten Muotatalstil[s}
: bei einer ausgesprochen
(Sichardt 1939: 129. Hervorhebungen durch Sichardt). Hier ist es das Bild des Haltens, Zählens und Messens sowie des Scharfen, das sich auf den einzelnen Merkmalsebenen wiederholt. Daß sich die Merkmale der beiden statischen
Grundhaltung wird der [Ton-]Raum [...] ausgeschritten und ausgemessen. [...] Ebenso ist das rhythmische Bild durch eine zählende, messende Zeitgestaltung gekennzeichnet. Schließlich der Vortrag: ungewöhnliche Gehaltenheit und Gespanntheit der Bewegung, bei scharfen, eckigen Impulsen. Jeder einzelne Ton ist bis zu einem gewissen Grade punkthaft
abgesetzt; scharfe, näselnd-schalmeihafte Klangfärbung.Form‐ und Ausdrucksbereiche
überdies zu Gegensatzpaaren anordnen lassen, braucht nicht extra gezeigt zu werden, weil Sichardt selbst das bereits getan hat. (Siehe obige Gegenüberstellung).
Sichardts dichotome Typologie macht den Eindruck des Konstruierten. Dies jedoch nicht im Sinne von Idealtypen (Max Weber), die sich im Empirischen stets nur unvollkommen wiederfinden, weshalb die Nähe des Empirischen zu diesem oder jenem Idealtyp eigens überprüft werden müßte, sondern im Sinne zweier gegensätzlicher Prototypen Appenzeller‐ und Muotatalstil
die jeder in sich eine erstaunliche gleichnishafte Homogenität ihrer Merkmale aufweisen, womit sich nicht nur Gegensatzpaare in ausnahmslos allen Merkmalskategorien ergeben, sondern der Gegensatz sich obendrein auf eine einfache Formel bringen ließe: statisch versus dynamisch. Diese Konstruktion ist sozusagen zu schön, um wahr zu sein und es erhebt sich die Frage, ob Sichardt das Empirische selektierte oder zurechtbog,
31
damit es sich in sein Konzept fügte. Im Speziellen: wie weit könnte sich die konzeptuelle Instrumentalisierung des Empirischen auf die Aussagen über die Rhythmik der Muotataler Jodel ausgewirkt haben? Wie weit ist Sichardts Ausführungen, denenzufolge der Muotataler Interpretationsstil ein Nonrubatostil ist, zu vertrauen? Das ist die Frage, auf die meine ganze ausführliche Darstellung von Sichardts Regionalstilkonzeption hinzielte.
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich die Darstellung zu Ende bringen. Sichardt vermutet, daß der Unterschied zwischen dem Muotatalstil
und dem Jodelstil der übrigen Deutschschweiz auf eine ethnische Differenz zurückgeht:
Ein Großteil der aszendenzmelodischen Merkmale erfüllt allerdings nicht allein den Kreis der deutsch-alpenländischen Volksmusik, sondern weite Bezirke des deutschen, ja darüber hinaus des westgermanischen Liedes. [...] Wenn wir einerseits vermuten dürfen, daß im alpenländischen Jodeln ein vorgeschichtliches, also wohl vorgermanisches Substrat verborgen liegt, so muß auf der anderen Seite mit umso größerer Entschiedenheit betont werden, daß der Jodel in seinem gegenwärtigen Bestand (von wenigen Ausnahmen und Grenzfällen abgesehen) eine typisch deutsche Stilprägung darstellt.
(Sichardt 1939: 123). Eine solche Ausnahme ist der Muotatal-Stil
: Ob der Muotatal-Stil als ein ursprungsmäßig germanischer betrachtet werden darf, mag allerdings dahingestellt bleiben. Das herrschende Deszendenzmelos und mancherlei andere Stileigenheiten könnten sehr wohl von einer keltischen (helvetischen) Grundlage ausgehen.
(Sichardt 1939: 117. Hervorhebungen durch Sichardt). Die Subsumtion des deutschen
Gesanges unter den aszendenzmelodischen Merkmalskomplex brachte es mit sich, daß der Muotatal-Stil
als undeutsch erschien. Die Beschreibung des Jodelstils der übrigen Deutschschweiz
(s. obige Gegenüberstellung) und damit des aszendenzmelodischen Merkmalskomplexes enthält eine Reihe von Wörtern, die aus dem Zusammenhang herausgenommen an das damalige Germanenklischee oder auch an die NS-Rhetorik zur Zeit des Kriegsausbruchs erinnern: allgemeine Aufstiegstendenz, Raumausweitung, emporgreifend, vorwärtsweisend, dynamische Raumergreifung, Generalüberbietung, Expansion, Vorwärtsdrang, ausdehnungsbedürftig. Über die politische Zuverlässigkeit des Aszendenzmelos ließ Sichardt die Zensoren nicht im Zweifel. Es ist bei Sichardts Buch generell die Frage, wie weit Wortwahl und Aussagen durch die Absicht bestimmt sind, das Buch trotz der vom nationalsozialistischen Gedankengut abweichenden Auffassungen die Zensur passieren zu lassen. Ich halte Sichardts Muotatal-Theorie jedoch nicht für ein solches Zugeständnis, sondern für eine Konsequenz der Kulturkreislehre in der Ausformung durch W. Danckert, die Sichardt bereits auf der ersten Seite der Einleitung seines Buches erwähnt: W. Danckert gewährte mir freundlicherweise Einblick in eine Reihe seiner ungedruckten Arbeiten, denen ich vor allem die grundsätzliche Erkenntnis verdanke, daß das Jodelproblem letztlich nicht durch bloße Lokalforschung, sondern nur in weitgespannten Zusammenhängen völkerkund
32
licher und rassenkundlicher Art zu lösen ist.
(Sichardt 1939: 1). Die Kulturkreislehre und die hohe Wichtigkeit, die dem Unterschied zwischen Aszendenzmelos
und Deszendenzmelos
in dieser Theorie zukam, zwangen Sichardt, den Muotataler als einen sich vom übrigen deutschschweizerischen aufs schärfste
abhebenden Jodel zu begreifen (Sichardt 1939: 129).
Die Frage ist indes, ob das auf den Jodelrhythmus, wie Sichardt behauptet, wirklich zutrifft. Wenn zwischen Melodischem und Rhythmischem allenthalben verwandte Züge
entdeckt werden und zwar derart, daß der melodischen Aufstiegsbetontheit
ein rhythmischer Vorwärtszug
, agogische Drängungen und Dehnungen
entsprechen (Sichardt 1939: 120) und auf der anderen Seite dem durch die Melodie ausgemessen[en]
Tonraum eine zählende, messende Zeitgestaltung
(Sichardt 1939: 129) und eine gleichmäßig pulsierende Rhythmik
(Sichardt 1939: 120), dann bietet sich zuallererst die Erklärung an, daß diese Verwandtschaften bloß rhetorische, unechte Analogien sind, daß hier von kategorial Verschiedenem in Bildern und Gleichnisssen gesprochen wird und durch die geschickte Wahl der Bilder sowie durch die durch die verbindenden Wörter verwandt
, ebenso
, auch
eine Verwandtschaft suggeriert wird. Es sei nicht einzusehen, weshalb Rubatointerpretation mit dem Aszendenzmelos
näher verwandt sein solle als mit dem Deszendenzmelos
. Gerade deshalb, weil rein rhetorische Verwandtschaften beliebig erzeugbar seien, könne jedoch davon ausgegangen werden, daß Sichardts Beschreibungen des Jodelrhythmus richtig seien und mit der Empirie im Einklang.
Diese Argumentation übersieht allerdings, daß Sichardts Konzeption auf die Aufstellung zweier gegensätzlicher Typen abzielt und sich so dem Verdacht aussetzt, daß Unterschiede überzeichnet, zufällig aufgenommene Extremfälle überbewertet und von der Typenkonstruktion Muotatal-Stil
abweichende Muotataler Jodel außer Betracht gelassen wurden. Und daß hier eine Typenkonstruktion stattfand und nicht eine Stilbeschreibung, dafür gibt es mehrere Anhaltspunkte: Die Kulturkreistheorie, die gleichnishaften Merkmalsverwandtschaften, die Gegenüberstellung von Gegensatzpaaren. Dieselben Bilder, die der Typenkonstruktion ihre suggestive Wirkung verleihen, kommen schon im ersten Kapitel in den Beitexten zu den Transkriptionen vor, einmal sogar im Gleichnis Gemessene Melodiebewegung, tonräumlich wie rhythmisch
(Sichardt 1939: Nr. 21). D.h. die Transkriptionen sind der Typenkonstruktion bereits verpflichtet, sie stellen keineswegs eine von ihr unabhängige Grundlage dar. Natürlich sind sie der Empirie näher. Und hier zeigen sich nun in drei der dreizehn Muotataler Transkriptionen Dehnungs‐ und Kürzungszeichen, davon zweimal inmitten des Melodieverlaufes, einmal wie ein Ritardando vor dem Halbschluß der Periode (Notenbeispiel 3). In nur einem der drei Fälle nimmt der Kommentar darauf Bezug: Es handle sich nicht nicht um agogische
Dehnungen, sondern sei eher als Verschärfung des grundsätzlich zeitmessenden [...] Bewegungsablaufes aufzufassen
(Sichardt 1939: Nr. 46). Der konstruierte Typus scheint keine
33
Ausnahmen zuzulassen. Bei sechs der dreizehn Transkriptionen beinhaltet der Kommentar keine Angaben über die Rhythmik, die Notation – keinerlei Hinweis auf Abweichungen vom Gleichlauf des Pulses (außer anders zu bewertenden Fermaten über Schlußnoten). Solche Hinweise in der Notation fehlen allerdings auch im A-Teil des Appenzeller Jodels Nr. 24, der laut Kommentar rhythmisch sehr frei
interpretiert wird (Sichardt 1939: 17 f.). Und die Transkription des mit zahlreichen irrationalen Dehnungen und Beschleunigungen
interpretierten Appenzeller Jodels Nr. 23 (Sichardt 1939: 16 f.) weist nur zwei einschlägige diakritische Zeichen und ein ritard.
vor dem Schluß auf. Man kann also nicht davon ausgehen, daß bezüglich der Existenz von Rubato das Notenbild in jedem Falle zuverlässiger ist als der Kommentar. Auch die umgekehrte Annahme wäre falsch, wie bereits gezeigt. Daher läßt sich die Frage nach der Häufigkeit von Nonrubatointerpretation im Muotatal im Jahr 1936 nur vorsichtig in negativer Form beantworten: In fünf der dreizehn Fälle ist von gemessener
Rhythmik die Rede, in einem davon ist diese Aussage verbal und durch die Transkription relativiert. In insgesamt elf Fällen gibt es weder einen verbalen noch einen notenschriftlichen Hinweis auf Abweichungen vom gleichmäßigen Puls inmitten des Melodieverlaufes. In nur einem Fall gibt es einen Hinweis auf ein Schlußritardando, und zwar bei Nr. 47 (Sichardt 1939: 37) vor einem Halbschluß, ausgedrückt durch eingeklammerte Fermaten. Das Zeichen rit.
kommt niemals vor.
Anders steht es mit den fünf Appenzellerjodel-Transkriptionen: Alle fünf enthalten im Notentext oder im verbalen Kommentar oder in beidem Hinweise auf Abweichungen vom gleichmäßigen Puls inmitten des Melodieverlaufes. In dreien wird ein Ritardando vorm Schluß angezeigt, einmal stehen zusätzlich Ritardandi inmitten des Melodieverlaufs.
Es gibt demnach Grund zur Annahme, daß im Jahr 1936 in Appenzell mehr Rubatointerpretation üblich war und auch mehr Schlußritardando als im Muotatal. Sichardt behauptet jedoch nicht bloß einen Stilunterschied Appenzell/Muotatal, sondern setzt den Muotatal-Stil
dem der übrigen Deutschschweiz
entgegen (Sichardt 1939: 130) und behauptet in diesem Zusammenhang eine stilistische Gemeinsamkeit schon allein damit, daß er unter der Überschrift Appenzell und verwandte Gebiete
außer seinen Appenzeller Aufnahmen auch die aus Nesslau (Toggenburg), Kerns (Oberwalden) und Lungern (Luzern) anführt, wobei er dem Appenzeller Jodel eine besondere Stellung Zuweist: Melodiegefüge, Vortragsweise und Klangideal der deutschsprachigen Schweiz erscheinen am deutlichsten ausgeprägt im Appenzeller Jodelstil.
(Sichardt 1939: 120). Auffällig ist, daß in dieser Aufzählung von Merkmalskategorien die Rhythmik fehlt, die im regionalstilistischen Kapitel sonst stets nach der Melodik und vor dem Vortrag und dem Klang als
34
eigene Merkmalskategorie abgehandelt wird, (siehe z. B. obige Gegenüberstellung, in der noch die zusätzliche Überschrift Kadenzbildung
auftaucht), – mit einer bemerkenswerten Ausnahme: bei der Besprechung der Jodelstile der verwandten Gebiete
(Nesslau, Kerns und Lungern). Ja mehr noch: Mit der Begründung, daß die im folgenden herangezogenen Jod
(Sichardt 1939: 121), verzichtet Sichardt sogar auf die Präsentation von Transkriptionen und beschränkt sich auf Kurzbeschreibungen einiger Tonaufnahmen, freilich nicht ohne vorher diese Beschränkung auf eler auch meist jüngeren und jüngsten Stilschichten angehören und daher ihrer Substanz nach nicht sonderlich erwähnenswerte Merkmale aufweisenEigenschaften klang‐ und vortragsstilistischer Natur
vorher anzukündigen (Sichardt 1939: 121). Die nun folgende Darstellung unterbietet allerdings nochmals die Vorgabe: Nur eine einzige der zwölf Jodelbeschreibungen sagt zum Klang etwas aus. Die Bemerkungen über den Vortrag bestehen in den meisten Fällen nur in einer einzigen Angabe u. zwar steigende Intonation
um einen Viertel‐ oder Halbton. Dies ist nun die einzige Eigenschaft, die Sichardt als eine tatsächlich sowohl in Appenzell als auch im Toggenburg, in Oberwalden und in Luzern vorkommende ausweist (Sichardt 1939: 122 f.). Wie Sichardt die rudimentäre Darstellung geeignet erscheinen konnte, das Bild des einheitlichen deutschschweizerischen Stils [...] abzurunden
(Sichardt 1939: 121), mag dahingestellt bleiben. Gerade die aus dem Blickwinkel der Kulturkreistheorie zentrale Frage nach dem Vorkommen von Aszendenzmelos
in den vorgeblich verwandten Gebieten
bleibt unbeantwortet. Von den in den verwandten Gebieten
aufgenommenen Jodeln liegt nur eine einzige Transkription vor. Der B-Teil dieses Jodels aus Lungern (Sichardt 1939: 9 Nr. 7) ist eine Variante des Muotataler Jodels Nr. 20 (Sichardt 1939: 14). Die beiden Orte Kerns und Lungern liegen in der Innerschweiz, also dem Muotatal näher als dem Appenzellerland, weshalb sich das Problem der stilstischen Verwandtschaft
hier doch in dringlicherer Weise stellen müßte (gerade für den Diffusionisten!). Genügte Wolfgang Sichardt schon der Nachweis irgendeiner Eigenschaft des aszendenzmelodischen
Merkmalskomplexes, um sich der Zuordnung gewiß zu sein? Als eine solche Eigenschaft mußte er dann wohl die steigende Intonation betrachtet haben. Als zusätzliches Indiz mochte ihm (trotz des im Vergleich zum Appenzeller Material geringen Anteils) ein Schlußritardando
bei einem der drei Jodel aus Kerns und eine zeitliche Dehnung
eines Spitzenton[s]
(Sichardt 1939: 122) bei einem der sieben Jodel aus Lungern gedient haben. Daß in diesen Kurzbeschreibungen – unangekündigt – nun doch vereinzelt Bemerkungen über die Rhythmik enthalten sind, gibt zu denken. Die Kurzbeschreibungen enthalten ausschließlich Eigenschaften, die zum aszendenzmelodischen Merkmalskomplex passen. Unpassendes oder Kontraindikatives aufzunehmen war von vorneherein nicht der Zweck dieser Liste. Je karger die Kurzbeschreibung, desto mehr Unpassendes, Kontraindikatives mußte vorgelegen sein. Am kargsten sind die Beschreibungen der Jodel aus den
35
beiden Innerschweizer Orten, am üppigsten die der Jodel aus dem Toggenburg (Nesslau), das dem Appenzell benachbart ist. Die Jodel aus Nesslau haben durchschnittlich zwei passende Eigenschaften, die Innerschweizer Jodel jedoch nur eine. Vor allem ist es die Rhythmik, die bei acht der zehn in die Liste aufgenommenen Innerschweizer Jodel nicht geeignet erschien, die Zugehörigkeit dieser acht zum aszendenzmelodischen Form‐ und Ausdrucksbereich
zu indizieren. (Andernfalls, so meine Hypothese, wären ihre rhythmischen Eigenschaften ebenso auf die Liste gesetzt worden). Vielleicht wurde die Rhythmik deshalb von den als beweiskräftig vorangekündigten Kategorien ausgespart, weil Sichardt diese Problematik erkannte, (die er beim Klang übersah: Nur ein einziger Jodel erfüllte wohl die klanglichen Voraussetzungen in hinreichendem Maß. Es ist ein Toggenburger Jodel).
Damit ist zwar die Frage nach dem Zustandekommen der Sichardtschen Regionalstilistik nicht restlos geklärt. Es ist jedoch ein Verdachtsmoment gewonnen, daß der Jodelstil von Kerns und Lungern, ja vielleicht sogar der ganzen Innerschweiz im Jahre 1936 selten Rubato gebrauchte und darin dem Muotatal-Stil
ähnlicher war als Sichardt zugibt. Die oben zitierte Gegenüberstellung zwischen Muotatal
und übrige[r] Deutschschweiz
kann nur als Gegenüberstellung zwischen Muotatal-Stil
und Appenzeller-Stil als durch die Sichardtschen Aufnahmen einigermaßen empirisch fundiert betrachtet werden. Zudem vereinfachen sie die Vielfalt zu einem Stil
. Und letztlich bleibt die Frage offen, wieweit die Stilkonstruktionen, die Auswahl der Stücke, die Kommentare, ja die Transkriptionen selbst durch die von W. Danckert übernommenen Merkmalssyndrome des deszendenz‐
und aszendenzmelodischen Form‐ und Ausdrucksbereiches
beeinflußt und manipuliert sind (in dem Sinne, daß nicht sein kann, was nicht sein darf
).
Sichardts Muotataler Informanten waren sechs Erwachsene und zwei Kinder. Von den 13 transkribierten Jodelaufnahmen stammen fünf von den Erwachsenen und acht von den Kindern. Diese sind ausnahmslos einstimmig, während jene ausschließlich zweistimmig sind. Alle drei Jodeltranskriptionen, in denen Dehnungen oder Kürzungen inmitten des Melodieverlaufes oder schlußritardandoartig notiert sind, betreffen Jodelinterpretationen der Kinder. Kann es sein, daß es die Kinder mit der metronomartigen
Gleichmäßigkeit des Muotataler Rhythmus
in ihren solistischen Interpretationen nicht so genau nahmen? Dafür spräche, daß in den Erwachsenen-Varianten von zwei dieser drei Kinder-Interpretationen keine Abweichungen vom gleichmäßigen Puls angezeigt sind. Diese meine Hypothese geht natürlich von Sichardts Auffassung über den Muotataler Rhythmus
aus, stützt sie aber gleichzeitig, indem sie ihre Plausibilität
36
erhöht.
Ich will nun den Gedanken wiederaufnehmen, daß das Erkennen des Abweichens oder Nicht-Abweichens von einem gleichmäßigen Puls weniger deutungshältig ist als das Erkennen der metrischen Betonungsverhältnisse. Pointierter Taktwechsel
ist laut Sichardt eines der Charakteristika des Muotatal-Stils
(Sichardt 1939: 130. Siehe die oben zitierte Gegenüberstellung). Die dreizehn Muotataler Jodeltranskriptionen lassen sich nach der Taktschreibung in drei Gruppen einteilen:
- Notationen ohne Taktwechsel: 6 Jodel;
- Notationen, in denen ein Takt von den anderen in der Schlagzahl abweicht (= ein bis zwei Taktwechsel in einer Melodie, siehe Notenbeispiel 3): 3 Jodel;
- Notationen mit mehr als zwei Taktwechsel (Vgl. Notenbeispiel 4): 4 Jodel.
Somit ist ca. die Hälfte der Sichardtschen Muotataler Jodeltranskriptionen taktwechselnd. Allerdings ist zu bemerken, daß unter den sieben taktwechselnd notierten Jodel einige zweiteilige sind, bei denen ein Teil taktwechselnd notiert ist, der andere nicht. Nur bei zwei Transkriptionen sind beide Teile taktwechselnd.
Kein Zusammenhang besteht zwischen taktwechselnder Notation und der Zuordnung zu historischen Stilschichten. Sowohl taktwechselnde als auch taktwechsellose Notationen finden sich auf alle drei Stilschichten, denen Sichardt das transkribierte Muotataler Material zuordnet, verteilt.
Wenn nun der Jodelstil von Sichardts Muotataler Informanten kein Rubatostil ist, – und vieles spricht dafür, daß Sichardts Einschätzung in diesem Punkt richtig ist –, dann ist die Möglichkeit, daß die Taktwechselnotation durch vom Transkribenten als gezählte Zeiten mißverstandene gedehnte Zeiten bedingt ist, auszuschließen. (Ein solches Mißverständnis könnte allenfalls bei jenen drei Kinder-Interpretationen vermutet werden, bei denen Sichardt Abweichungen vom gleichmäßigen Puls notiert hat). Das bedeutet jedoch nicht, daß Sichardts Taktwechselnotation Glauben geschenkt werden muß, geben sie doch die Auffassung des Transkribenten, nicht der Ausführenden wieder. Diese nach ihrem metrischen Verständnis zu befragen, gehörte nicht zu den Methoden der damaligen Musikwissenschaft. Hypothesen darüber aufzustellen, woran Sichardt den Takt zu erkennen glaubte, möchte ich den in den nächsten Kapiteln erfolgenden Einzelanalysen vorbehalten. Sichardts Transkriptionskommentare geben darüber 37 keine Auskunft. Ebenso sind die taktwechsellosen, die regulärtaktigen Deutungen auf ihre Plausibilität und ihre Richtigkeit hin zu befragen. Für sie gelten die selben grundsätzlichen Überlegungen wie für die taktwechselnden Notationen. Die tatsächliche metrische Ordnung könnte eine andere sein als die vom Transkribenten erkannte. Sichardts Taktstrichsetzungen wurden bereits von Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981: 58) bezweifelt, allerdings nur bei den taktwechselnden Notationen.
Die folgende Überlegung ist bereits ein Vorgriff auf die von mir ins Auge gefaßte Methode: Wenn es richtig ist, daß die von Sichardt aufgenommenen Muotataler Jodel im Nonrubatostil gesungen wurden, dann bilden die geschriebenen Notenwerte nicht nur deskriptiv
die Tondauerverhältnisse, sondern mit ihnen auch die konzeptuellen metrischen Zeitverhältnisse ab. Dann müßte es ohne Schwierigkeiten möglich sein, von Sichardts Taktstrichsetzung abstrahierend alternative metrische Deutungen auszuprobieren. Die Voraussetzung für die problemlose Anwendbarkeit dieser Methode ist allerdings, daß der Muotatal-Stil
kein Rubatostil ist, und gerade das wird von Heinrich J. Leuthold bestritten (Leuthold 1981: 58 und 102 f.).
Jodelmetrum und Ideologie
Der nun folgende Abschnitt wurde an dieser Stelle eingeschoben, weil er in gewisser Weise von Wolfgang Sichardt zu Max Peter Baumann und – noch mehr – zu Heinrich J. Leuthold überleitet.
Obwohl Sichardt keinen einzigen der von ihm veröffentlichten Muotataler Jodel dem Schnadahüpfeltyp
(Sichardt 1939: 4 ff.) zuordnet, kann ich nicht umhin, auf diese Begriffsbildung Sichardts kurz einzugehen. Sichardt versteht darunter eine Gattung, deren Ursprung im Ländler zu suchen ist, und die ja bloß eine abgeschliffene Ausprägung der Ländlerform darstellt,
sie zeigt sich in den gesungenen vierzeiligen Schnadahüpfeln, Gstanzeln oder wie die unzähligen Bezeichnungen hierfür in den einzelnen Landschaftsbezirken des Alpengebietes lauten. In der instrumentalen Volksmusik tritt sie unter dem Namen Ländler auf. Man darf sie als den landläufigen Jodeltyp unserer Tage ansprechen.
(Sichardt 1939: 4). Nachdem Sichardt die Schnadahüpfelform
mit vier Notenbeispielen, von denen das erste hier wiedergegeben sei (Notenbeispiel 5), exemplifiziert, stellt er folgende Gattungsmerkmale
(Sichardt 1939: 6) auf: In formaler Hinsicht symmetrisch unterteilter Aufbau des Ganzen: 4 + 4 (= notengetreue Wiederholung der ersten vier) Takte. Harmonikale Einbettung des
(Sichardt 1939: 6 f. Hervorhebung durch W. S.)Melos
in den schematischen Wechsel von T und D(7). Keine oder nur unbedeutende rhythmische Abwandlungen ebenfalls in symmetrisch wiederkehrender Abfolge. Rationalistische Primitivität des Melodieumrisses: man bewegt sich in festgefahrenen Spuren zwischen Tonika und Leitton bzw. Dominantsept und Tonikaterz. Die Leittöne haben jedoch keine keine melodische Triebkraft. Schematische Betonungsverhältnisse. Melodieumfang häufig eng, nicht über Sext oder Sept hinausgehend [...] In letzter Zusammenfasssung läßt sich sagen: der Schnadahüpfeltyp ist die abgesunkene, völlig rationalistische Ausprägung des Ländlers.
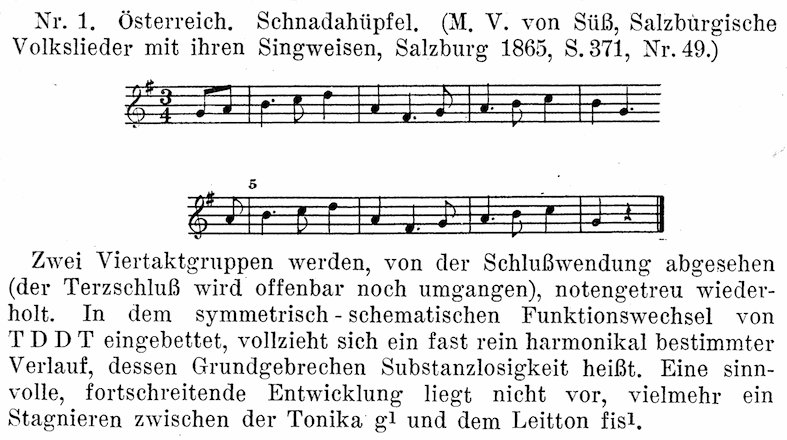
Schnadahüpfeltypsamt Sichardts Kommentar (Sichardt 1939: 5)
rationalistische Primitivität,
daß hier die tönende Form auf eine der niedrigsten Stufen ihrer Eigenständigkeit herabgedrückt wird,
Melodiestoff [...] von schwer zu überbietender Gleichförmigkeit,
Substanzlosigkeit,
der allzu eng gezogene Grundrahmen [erlaubt] keine wahrhaft schöpferischen Fortbildungen(Sichardt 1939: 5 und 7). Das hinter diesen abwertenden Äußerungen stehende Motiv scheint im Begleittext zu Sichardts Notenbeispiel Nr. 3 durch:
Abermals zeigen sich Entsprechungen, deren rationalistische Primitivität nicht auf(Sichardt 1939: 5). Sichardt kritisiert hier nicht nur jene Vertreter der Produktionstheorie, die gerade das Schnaderhüpfl als Beleg für die Richtigkeit der Produktionstheorie und die Verfehltheit der rezeptionstheoretischen These desUrsprünglichkeitsondern aufgesunkenes Kulturgutder Aufklärungsperiode hinweist.
gesunkenen Kulturgutswerteten, (vgl. zu dieser Kontroverse John Meier 1906, Emil Karl Blümml 1901 und Josef Pommer 1912), sondern ganz allgemein eine weit verbreitete Volksliedauffassung, die in den Schnaderhüpfln etwas besonders
Echtesund Wertvolles erblickte. Sichardt setzte sich mit seinen Äußerungen auch von der nationalsozialistischen Auffassung ab, zumindest von der des Leiters des damaligen
Ostmärkischen VolksliedarchivsKurt Rotter, der ein Werk über den
Schnadahüpfl-Rhythmus(Rotter 1912) geschrieben hatte.
Ich möchte die Sinnhaftigkeit und Brauchbarkeit dieser Idealtypus-Konstruktion nicht bestreiten und auch nicht Sichardts Einschätzung, daß dieser Typus im alpenländischen Jodel breitesten Raum
einnimmt (Sichardt 1939: 4 und 7). Auch will will ich von Sichardts Wertung zunächst absehen. Für unglücklich gewählt halte ich jedoch die Benennung Schnadahüpfeltyp
und Schnadahüpfelform
, und zwar aus zwei Gründen:
Erstens gibt es im Schnadahüpfl (ohne e vor dem l, weil es von hochdeutsch Schnatterhüpflein
kommt und auch im Dialekt hier kein e gesprochen wird) nicht nur den von Sichardt aufgestellten Typus, sondern auch Formen, die Sichardt wohl kaum zu diesem Typus zählen würde, wie Notenbeispiel 6.
Weiters ist der aufgestellte Typus ebenso häufig im Ländler und, wie Sichardt selbst zugibt, im Jodel anzutreffen und es ist daher nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet das Schnadahüpfl den Namen für diesen wissenschaftlichen Fachbegriff abgeben soll. (Der einzige Grund könnte die Polemik gegen oben erwähnte Auffassungen sein).
Zweitens führt die Einführung der Bezeichnung Schnadahüpfeltyp
schon bei Sichardt selbst zu der mißverständlichen Bezeichnungsvariante Schnadahüpfelform
(Sichardt 1939: 4), wodurch der begriffliche Unsinn entsteht, daß es
40
Schnadahüpfln gibt, die keine Schnadahüpfelform
aufweisen, (wie z. B. Notenbeispiel 6). Schlußendlich führt Sichardt für den aufgestellten Typus überhaupt die Kurzbezeichnung Schnadahüpfel
ein (Sichardt 1939: 8). Das Wort Schnadahüpfl erhält eine neue Bedeutung, es wird zum Synonym für den aufgestellten Typus.
So wird suggeriert, daß alle Schnadahüpfln dem aufgestellten Typus entsprechen.
Sichardts Eigenart, bei Typenbildungen allzu großzügig vorzugehen und das Abweichende unter den Teppich zu kehren, wurde bereits im vorherigen Abschnitt deutlich.
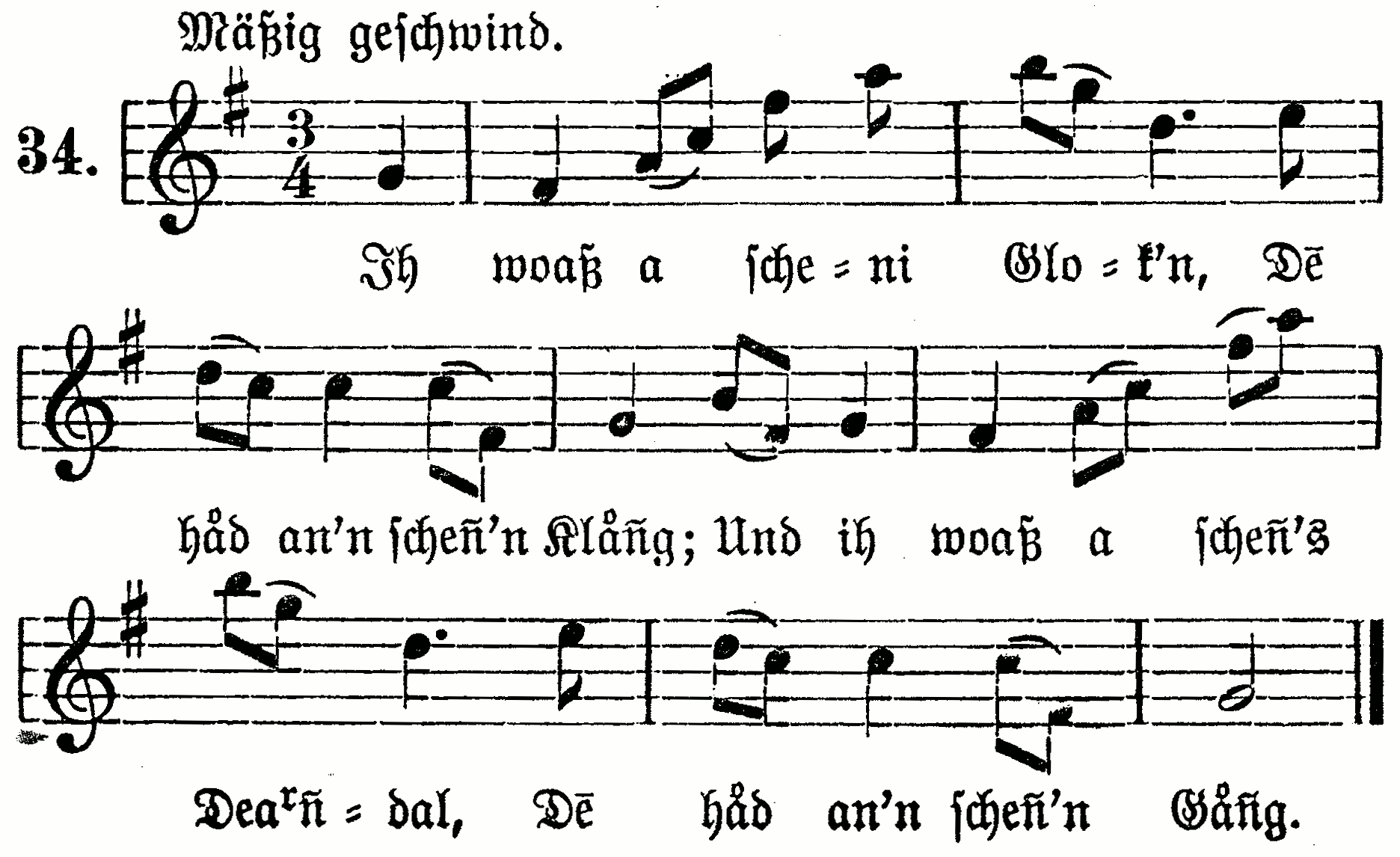
Schnatterhüpfelnder Sammlung von F. Tschischka und J. M. Schottky ( 1818/1844/1906: 69 Nr. 34)
Auf die Sichardtsche Typenkonstruktion wird hier deshalb eingegangen, weil sie von der Schweizer Jodelforschung aufgegriffen wurde. Das Schnadahüpfl als Dekadenzform rationalistischer Musikauffassung
heißt eine Kapitelüberschrift in Heinrich J. Leutholds Buch über den Naturjodel in der Schweiz
(Leuthold 1981: 58), in dem, unter Berufung auf Sichardt, unter anderem behauptet wird: Im ungeheuren Siegeszug des Schnadahüpfls durch fast ganz Europa im
19. Jahrhundert hat dieser Typ weitgehend die neuern Jodel‐ und Jodelliedschöpfungen bee
(Leuthold 1981: 59). Der durch Sichardt entstellte Schnadaüpflbegriff ändert hier seine Funktion: Diente er Sichardt zu seiner Polemik gegen bestimmte Auffassungen des einflußtUrsprünglichen
so wird er bei Leuthold zu einem Beleg für schlechten österreichischen Einfluss auf den Schweizer Jodel. Wo es darum geht, gegen eine neue Invasion geistiger Art [...] durch Melodien aus Österreich
einen Gegenschlag auf dem Gebiet der Volksmusik
zu führen, um dieser geistigen Überflutung Herr zu werden
Leuthold 1981: 105 f.), wo versucht wird, das bereits fest im Volksempfinden verhaftete ausländische Musiziergut [...] zu verdrängen
(Leuthold 1981: 105) und bedauert wird, daß die verpönten Erzeugnisse in eine Bernerlandsammlung hineingeraten sind (Leuthold 1981: 105) 107), wo Lieder nach einem Heimatschein
gefragt werden (Leuthold 1981: 105) 107), dient
41
der entstellte Schnadahüpflbegriff dazu, dem ausländischen Einfluß eine zusätzliche negative Seite abzugewinnen. Er wird bei der Prüfung der Lieder auf ihren Heimatschein
zu einem Indiz, das auf Österreich verweist: Das
(Leuthold 1981: 107). An die Möglichkeit eines schweizerisch-hausgemachten Küherleben
in Bd. 2 [der Berner Jodelliedsammlung von O. F. Schmalz] ist melodisch stark vom Schnadahüpfl geprägt und weist eindeutig auf Österreich als Ursprungslandschaft hin.Schnadahüpfeltyps
wird nicht gedacht, nicht nur weil Schnadahüpfl ein österreichisches Dialektwort ist, sondern auch weil Sichardt, dessen Auffassung Leuthold hier übernimmt, die heute kaum mehr geteilte Meinung der älteren Forschung vertrat, der Ländler und mit ihm das Schnadahüpfl seien in Oberösterreich entstanden und hätten sich von dort aus im 19. Jahrhundert über das gesamte Alpengebiet verbreitet
*)
*) das Leuthold offenbar mit fast ganz Europa
gleichsetzt.
(Sichardt 1939: 7). Wahrscheinlicher ist vielmehr, daß eine mindestens schon im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitete Tanzgattung in der 2.Hälfte dieses Jahrhunderts in Wien den Namen Ländler
erhielt und die Benennung dann im 19. Jahrhundert sich ausbreitete. Einen ähnlichen Vorgang weist Max Peter Baumann bei dem Wort Jodel
nach (Baumann 1976: 87 ff.).
Es geht mir hier nicht darum, die Instrumentalisierung der Volksmusik
durch das Schweizer Nationalbewußtsein aufzuzeigen oder gar zu kritisieren, – ich möchte diesbezüglich auf Max Peter Baumanns Versuch einer Kritik der Heimatideologie
(Baumann 1976: 87 ff.) verweisen. Vielmehr will ich zeigen, wie ein Begriffskonstrukt, obwohl schon bei Anbeginn und nach dem damaligen Forschungsstand auf falschen Voraussetzungen aufgebaut, weiterlebt, weil es eine (von seinem Erfinder unbeabsichtigte) neue Funktion erhielt. Bei diesem Funktionswandel ist weiters zu beachten, daß Leuthold
– im Unterschied zu Sichardt – sich nicht primär an eine kleine Gruppe wissenschaftlicher Spezialisten wendet. Sein Buch hat wohl die größte Leserschaft im Umkreis des Eidgenössischen Jodlerverbandes, bei dem er Ehrenmitglied ist und für den er als Kampfrichter bei Jodlerfesten mehrmals tätig war (Leuthold 1981: 4). Es ist dies der Prozeß der Popularisierung wissenschaftlichen Gedankenguts.
Wahrscheinlich hat Leuthold noch einen zweiten das Jodelmetrum betreffenden Gedanken aus der Musikwissenschaft übernommen und zwar die Auffassung Max Peter Baumanns, daß der nicht stilisierte, freie Jodel in den meisten Fällen
42
in keinen Takt eingepaßt werden kann
(Baumann 1976: 160). Die Übernahme ist hier nicht direkt nachweisbar, doch beruft sich Leuthold an anderer Stelle (Leuthold 1981: 25 f.) auf dieses Werk Baumanns, er hat es also gekannt.
Allerdings ist bei Leuthold freier, ungebundener Rhythmus
ein Kennzeichen einer älteren Stilschicht (Leuthold 1981: 100) und das beinhaltet eine Akzentverschiebung gegenüber Baumann, dem der freie Rhythmus
als Merkmal der Musikfolklore
(im Gegensatz zum Musikfolklorismus
) gilt (Baumann 1976: 84 f.).
Seine Auffassung von der Altartigkeit der freien Rhythmen
, deren hypothetischen Charakter er nicht reflektiert, führt Leuthold nun sogar dazu, einheimisches Musiziergut des ausländischen Einflusses zu verdächtigen. Zur Frage, warum im Bernerjodel keine Natur-Fa
, keine freie[n] Rhythmen
und keine Alphornmelodien vorkommen wie im Appenzeller und im Innerschweizer Jodel, entwickelt Leuthold folgenden Erklärungsversuch: Im Berner Oberland war der Tiroler Einfluß während des 19. Jahrhunderts so mächtig stark, dass er das einheimische Liedgut, eingeschlossen den Naturjodel, fast vollständig überdeckte und damit die Bindungen mit der traditionellen Folklore zerriss.
(Leuthold 1981: 110). Dieser Erklärungsversuch vermag nun den Autor selbst nicht zu überzeugen und er schließt einen zweiten Erklärungsversuch an, demzufolge die zu Beginn unseres Jahrhunderts einsetzende organisierte Jodelpflege alles
(Leuthold 1981: 110). Damit nähert sich Leuthold der Folklorismus-These Max Peter Baumanns an. Die Frage, ob indes die Auffassung von Unreine
, alles rhythmisch von der Norm Abweichende ausmerzte.freiem Rhythmus
des nicht stilisierte[n], freie[n] Jodel[s]
(Baumann 1976: 85, 160) hinreichend begründet ist oder ob hier der Topos der Älplerfreiheit sich metaphorisch in den Jodelrhythmus rettet, wird noch zu stellen sein.
Max Peter Baumann
Das Werk Musikfolklore und Musikfolklorismus. Eine ethnomusikologische Untersuchung zum Funktionswandel des Jodels
(Baumann 1976) ist mittlerweile ein Klassiker der Literatur über den Jodel in der Schweiz geworden. Und obwohl außer dem Abdruck einiger Notationen Wolfgang Sichardts darin keine Muotataler Jodel vorkommen, (– das Chueraiheli auf Seite 145 steht nicht im Zentrum meines Forschungsinteresses –), sei kurz auf diese Arbeit eingegangen wegen des Einflusses, den Max Peter Baumanns Gedanken auf die jüngere schweizerische Jodeldiskussion haben.
Wie schon der Titel sagt, richtet sich Baumanns Hauptinteresse auf den Kontext: auf Funktion und Funktionswandel. Doch enthält das Werk auch einige speziell musikalische Untersuchungen sowie Stellungnahmen zur Aufzeichnung von Rhythmus und Metrum. Zu diesem Thema bemerkt Baumann, die überlieferten Jodelaufzeichnungen sind [..,] als präskriptive Notierungeweisen zu verstehen und bieten im rhythmischen Bereich sowie in dem der Zählzeiten nur stilisierte Werte. [...] Das Problem der fragwürdigen, rhythmisch starren Fixierung ist nach Ebels ersten Reiseaufzeichnungen immer wieder zur Sprache gekommen.
(aumann 1976: 84 f.). Dies sei bei der statistischen Auswertung von Jodelaufzeichnungen zu berücksichtigen: Zur Frage der Metren kann unsere Zusammenstellung [insgesamt 247 Belege aus verschiedenen gedruckten Quellen und aus handschriftlichen Beständen des Schweizerischen Volksliedarchivs] nur mit besonderer Vorsicht herangezogen werden, da – wie wir bereits erwähnt haben – alle Aufzeichnungen, mit Ausnahme jener von Sichardt, in ein starres Taktschema gedrängt wurden, was in Wirklichkeit selten auf den Jodel zutrifft.
(Baumann : 160). Diese These unterstreicht er mit zwei Notenbeispielen, in denen er ältere präskriptive
Aufzeichnungen mit von Baumann selbst erstellten deskriptiven
Aufzeichnungen vergleicht. Zu seinem zweiten Beispiel, das hier in Notenbeispiel 7 wiedergegeben ist, schreibt der Autor: Sogar bei einem Jodellied (Gsätzli) zeigt sich in analoger Weise, wie der Jodelrefrain in freiem Rhythmus den prägnanten Takt des vorausgehenden Volksliedes sprengt.
(Baumann : 85).
Da ich zu dem angesprochenen Problemkreis eine andere Auffassung vertrete, möchte ich die Gelegenheit benutzen, über die bloße Darstellung hinaus in einer Auseinandersetzung mit Baumanns Ausführungen meinen Standpunkt klarstellen.
44Es sind im alpenländischen Jodel, wie es bei Baumann bereits anklingt, Freiheiten
auf mehreren Ebenen zu unterscheiden:
- die Abweichung von den acht‐ und sechzehntaktigen Formschemata in der Anzahl der Takte, (wurde auch von den früheren Aufzeichnern notiert);
- ungleich viele Zählzeiten pro Takt (= Taktwechsel);
- freies Rubato: Zählzeiten erscheinen in der Zeitdauer gedehnt oder verkürzt wodurch die Takte ungleich lang dauern; findet sich mitunter als Taktwechsel geschrieben, ist jedoch konzeptuell etwas anderes;
- gebundenes Rubato: Dehnungen und Kürzungen von Zählzeiten gleichen einander aus, wodurch die Takte oder die Großtakte gleich lang sind.
- Inégalité: die kleineren Unterteilungen der Zählzeiten, (meist als Achteln und/oder Sechzehntel geschrieben), dauern ungleich lang, finden sich jedoch gleich lang geschrieben;
- Tempowechsel inmitten des Melodieverlaufs.
Das Hineinpressen
in ein Schema durch den Aufzeichner wäre dann wie folgt zu klassifizieren:
- Taktwechsel wird als freies Rubato gedeutet, um eine Taktwechselschreibung zu vermeiden;
- Das Rubato ist nicht angemerkt;
- Inégalité ist nur sehr grob mithilfe der Unterscheidung in und (allenfalls noch und bzw. ) notiert;
- Tempowechsel ist nicht angemerkt.
Ebenso möglich ist jedoch dann auch der umgekehrte Vorgang, daß ein Jodel in der Aufzeichnung aus dem regulären Schema herausgedrängt
wird:
- Die gesetzten Taktstriche stimmen nicht überein mit den von den Ausführenden empfundenen Schwerzeiten, Vier‐ und Achttakter erhalten eine von vier und acht abweichende Taktzahl:
- Dehnung oder Kürzung wird als gezählte Zeit (miß)verstanden, Rubato als Taktwechsel geschrieben.
Diese Klassifikationen beruhen freilich auf der These, daß die Jodler und Jodlerinnen metrisch-formale Konzepte haben. Dies muß angesichts der zahlreichen mit 4 + 4 Takten ohne Taktwechsel aufgezeichneten Jodel wohl
45
angenommen werden. Ein alpenländischer Jodel, der ganz andere oder gar keine metrischen Strukturen hätte, würde sich schwerlich so häufig in diesem Schema schreiben lassen; es ist unwahrscheinlich, daß die Aufzeichner ihnen aus der Kunstmusik und Tanzmusik bekannte Formschemata rein äußerlich auf die Jodel applizierten, diese Schemata müssen in der Jodelmusik selbst in irgendeiner Weise vorhanden sein, sei es als Konzept der Ausführenden, sei es als Konzept derer, die diese Melodien schufen. Das wird nun von Baumann bestritten 1976:160). Charakteristisch für Baumanns Notationsweise ist neben dem zurückhaltenden Gebrauch von Taktstrichen die gleichzeitige Verwendung unterschiedlicher Typen von Rubatoschreibung. Zusätzlich zu den Angaben der traditionellen Notation (z. B.rit...
), die sich in allen genaueren Jodelaufzeichnungen durchaus finden, und den seit Abraham und Hornbostel (Abraham & Hornbostel 1909) in der Musikethnologie eingeführten Zusatzzeichen greift Baumann zu der Möglichkeit, Rubati und Tempowechsel mithilfe der Noten selbst auszudrücken, (siehe Notenbeispiel 7). Das ist nicht nur insofern deskriptiv
, als so die tatsächlichen Zeitdauerverhältnisse besser angenähert werden, sondern auch in dem Sinne, daß der Transkribent auf die Beschreibung eines von ihm bloß Vermuteten und Gedeuteten, nämlich des Metrums, verzichten kann: Taktstrichsetzung entfällt und die Zeitwerte der Noten erhalten eine neue Funktion: Statt der konzeptuellen metrischen Verhältnisse geben sie die objektiven Zeitdauerverhältnisse (näherungsweise) an. Diese Umfunktionierung der Bedeutung der Notenwerte hat somit auch einen Nachteil: Die größere Genauigkeit in der Schreibung der Dauerverhältnisse wird durch einen Verzicht auf die genaue Notierbarkeit des metrischen Konzepts erkauft, – sei es nun eines mittels Deutung unterstellten oder eines tatsächlichen, ethnomethodisch eruierten. Dieser Nachteil bleibt bei Baumann unerwähnt.
Der hier angesprochene Unterschied in der Funktion der Notenwerte ist besser mit dem Begriffspaar phonetische
und phonemische
Transkription umrissen (Doris Stockmann im Supplementband des MGG, Tafel 111). Während die phonetische
Transkription die Tondauerverhältnisse annähert, gibt die phonemische
Transkription das metrische Konzept wieder. Bela Bartok erstellte in komplizierteren Fällen zwei Transkriptionen derselben Tonaufnahme, die er übereinanderlegte (Bartok and Lord 1951). Baumanns Transkription (Notenbeispiel 7) weist sowohl phonetische als auch phonemische Züge auf.
Sie verzichtet weder vollständig auf Taktstrichsetzung noch auf die Verbindung der Achtel und Sechzehntel durch Balken. Auch die Balkenschreibung suggeriert ja Metrisches, die erste der mit einem Balken verbundenen Noten steht im allgemeinen auf schwererer Zeit, (vgl.
mit
).
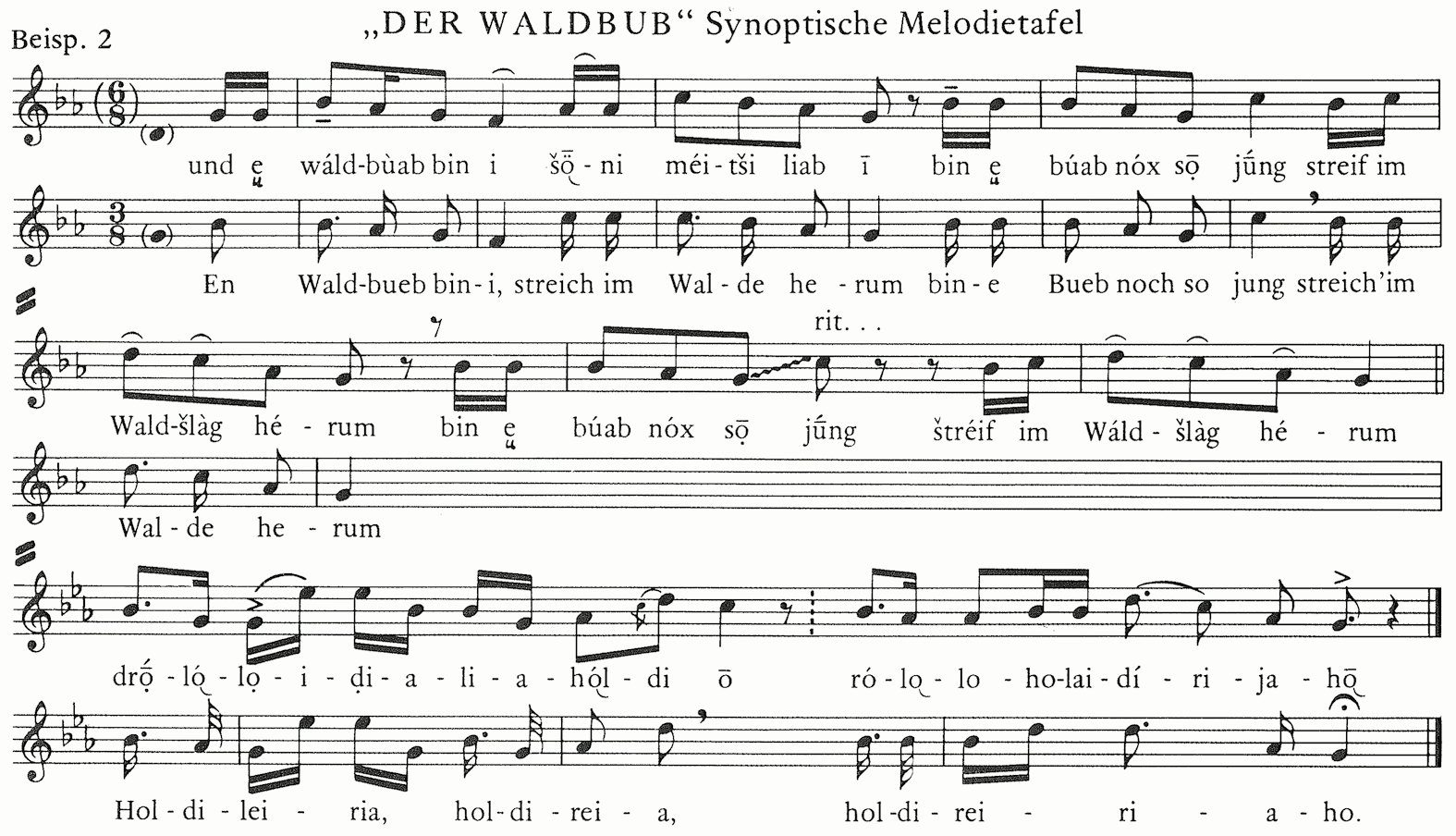
Aus Tradition und Gegenwart der Volksmusik im Oberwallis(Schriften des Stockalper-Archivs in Brig, 1972: 23). Untere Notenzeile: Aufzeichnung aus
Volkslieder aus dem Kanton Aargau(S. Grolimund 1911: 78 f. (Schriften der Schweizer. Gesellschaft f. Volkskunde, 8).
Damit enthält die Transkription Notenbeispiel 7 nicht nur Deskriptives, sondern auch Hypothetisches, nämlich eine metrische Deutung, deren Plausibilität hier zur Diskussion steht. Erstens ist nicht einsichtig, wieso nicht ein 3/8-Takt vorgeschrieben wurde wie in Grolimunds Aufzeichnung.
Vom Versmaß des Textes her gesehen entbehrt der 6/8-Takt nicht einer gewissen Willkür, denn ebenso plausibel wären Taktstriche vor den betonten Silben i
, jung
und rum
. Vom vermutlichen harmonischen Verlauf her gesehen sind diese Zeiten sogar die schwereren, da hier die Harmoniewechsel stattfinden. Aus diesen Gründen ist Grolimunds Taktstrichsetzung plausibler.
Baumann will mit seiner Transkription zeigen, wie der Jodelrefrain in freiem Rhythmus den prägnanten Takt des vorausgehenden Volksliedes sprengt
((Baumann 1976: 85). Gerade dies geht aber aus seiner Notation gar nicht hervor: Der Gleichlauf des vorgezeichneten Taktes wird schon bei der Wiederholung der beiden letzten Textzeilen des Vierzeilers gesprengt, wie aus den zusätzlichen Achtelpausen in Takt 4 und Takt 5 und aus dem Ritardando in Takt 5
47
hervorgeht. Hier ist die Frage, ob die zusätzliche Pause in Takt 5 nicht ebenfalls über das Liniensystem zu zeichnen gewesen wäre, ob es sich wirklich um einen konzeptualisierten metrischen Wert handelt. Der Rhythmus ist im Jodelrefrain kaum freier
, lediglich geschieht am Beginn seines zweiten (Zählung nach Grolimunds Aufzeichnung) Taktes ein Tempowechsel, ein meno mosso, das Baumann durch doppelt so lange Notenwerte ausdrückt, das aber ebenso durch einen Wechsel der Metronomangabe hätte ausgedrückt werden können. Die Zäsur in S. Grolimunds Aufzeichnung ist bei Max Peter Baumann als zusätzliche Achtelpause (samt strichlierter Linie) präzisiert, auch hier erhebt sich die Frage, ob diese Pause tatsächlich ein metrischer Wert ist oder bloß ein Stehenbleiben des Metrums, eine Fermate. Über der Silbe di
in Takt 3 des Refrains steht ein gekürzter Wert, aber auch das ist nichts Neues, wie Takt 1 des Liedes zeigt. Das einzige wirklich Neue im Jodelrefrain ist somit das langsamere Tempo ab seinem 2. Takt. Deswegen von einem freien
Rhythmus und einer Sprengung des prägnanten Taktes zu sprechen, erscheint mir übertrieben.
Ebensowenig wird das Viertakterschema des Jodelrefrains durchbrochen.
(Daß der Taktstrich vor dem Schlußton in Grolimunds Aufzeichnung fehlt, dürfte ein Druckfehler sein). Es handelt sich um das bekannte Schema mit den taktschlüssigen Harmoniewechseln I V V I. Zwei der vier Taktstriche sind durch den Harmoniewechsel beglaubigt
, die restlichen zwei sind Schemainterpretation
. Die phonemische
Deutung des von Baumann transkribierten Jodelrefrains müßte demnach wie in Notenbeispiel 7a aussehen.
Die Taktstriche im Jodelrefrain sind nicht nur harmonisch und schematisch plausibel, sondern auch melodisch, weil sie den Sekundgang (Paul Hindemith) g﹣as und as﹣g auf den Niederstreich der Takte setzen.
Dieses Beispiel soll zeigen, daß Transkriptionen, sofern sie außer Deskriptionen auch Deutungen enthalten, kritisierbare Behauptungen, Hypothesen darstellen, zu denen Alternativen entwickelt und diskutiert werden können. Das kann freilich, wie die Argumentation mit den harmonischen Deutungsmustern zeigt, nur auf der Basis einer gewissen Kenntnis der Kultur
geschehen. Letztlich ist also die Befragung der Ausführenden die beste und sicherste Methode, zu einem richtigen Verständnis des Metrums zu gelangen.
In Frage zu stellen ist weiters Baumanns Behauptung, daß alle Aufzeichnungen, mit Ausnahme jener von Sichardt, in ein starres Taktschema gedrängt wurden.
(Baumann 1976: 160). Zahlreich sind die Jodelaufzeichnungen von A. L. Gaßmann, A. Tobler und anderen, in denen Taktwechsel vorkommen oder/und von den 4‐ und 8-taktigen Schemata abgewichen wird. Baumann selbst bringt in seinem Buch solche Beispiele (Baumann 1976: 84 und 167) und stellt in der statistischen
48
Analyse fest, daß 14% der Aufzeichnungen von schweizerischen Jodeln taktwechselnd sind (Baumann 1976: 160). Sogar die Methode, auf Taktstrichsetzung überhaupt zu verzichten, findet sich schon in den 50er Jahren angewandt (Th. Kappeler 1956: 126). Dieses Beispiel ist sogar in Baumanns Werk abgedruckt ((Baumann :1976: 183 f.). Der 2. Teil dieses dreiteiligen Jodels sei in Notenbeispiel 8 wiedergegeben.
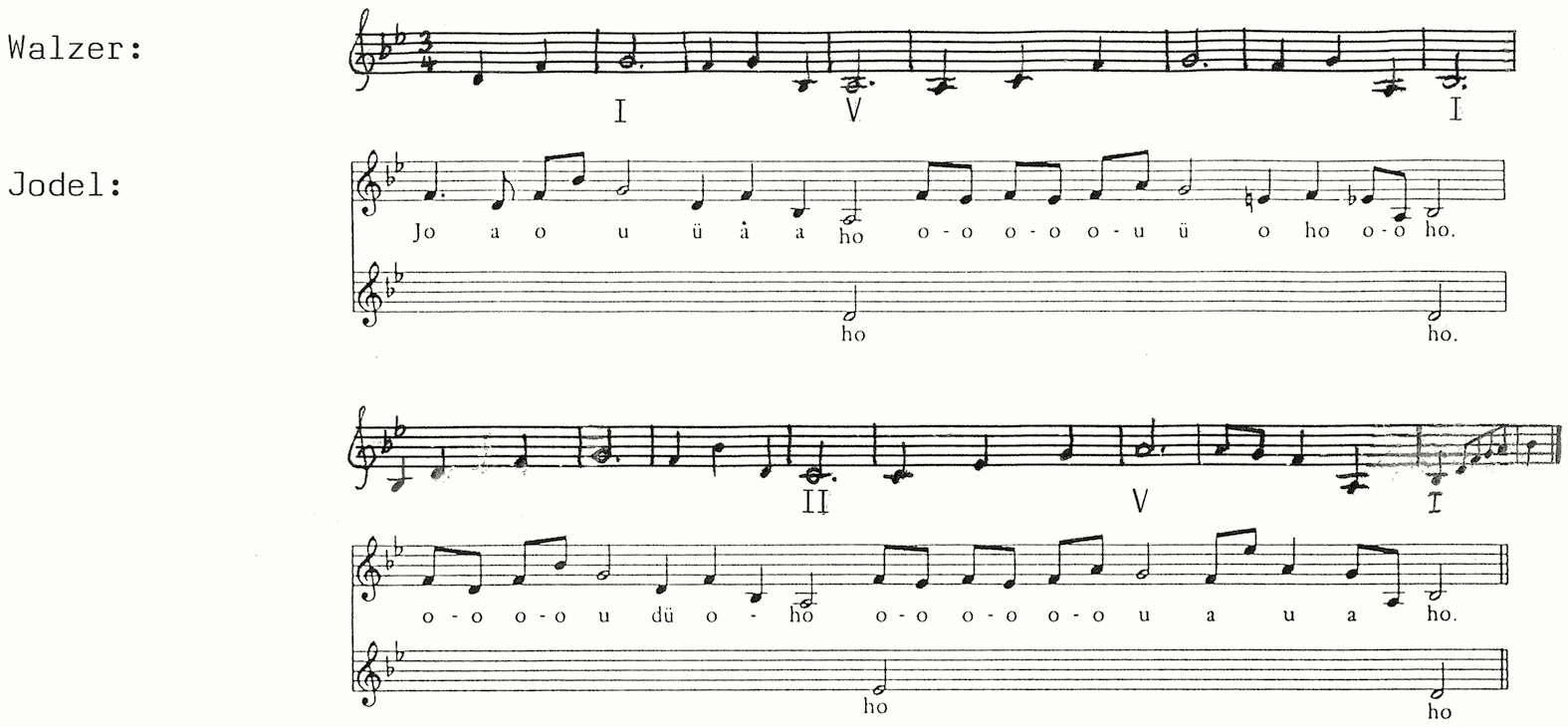
Rauschen an der Goldach, aus der Erinnerung aufgezeichnet von H. Fritz. 2. Teil des Toggenburger Jodels
De Bendeler met eme Aahängselaus Th. Kappeler: Der Toggenburger Jodel. Toggenburger Heimat-Jahrbuch 16, 1956: 126 (zit. nach Baumann 1976: 183 f.).
TöbiTobler *) *)[Diese Fussnote wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen] gelernt hatte und in der Musikgruppe
Appenzeller Space Schöttle mit Fritz & Fritz**) **)Töbi Tobler: Hackbrett; Ficht Tanner: Kontrabaß; Hermann Fritz: Violine, Friedrich Gimplinger: Gitarre. einer Fusion aus einem appenzellischen und einem oberösterreichischen Duo, in den Achzigerjahren spielte und den ich hier (ebenfalls Notenbeispiel 8) aus der Erinnerung wiedergebe. Der Vergleich des Toggenburger Jodels mit dem Appenzeller Walzer zeigt im Rhythmisch-Metrischen Abweichungen bei den langen Tönen: Wo im Walzerteil eine Dreiviertelnote steht, ist im Jodelteil eine Halbe, anstelle von zwei Walzertakten steht im Jodel eine fünf Viertel lange Gruppe. 49 Ebenso wie die Melodie des Walzers basiert auch die des Jodels auf der
Funktionsharmonik. Während der Walzer in Takt 11 die II. harmonische Stufe erreicht, bringt der Jodel an der entsprechenden Stelle die V. Stufe wie in Takt 3. Die Begleitstimme pendelt zwischen der Terz des Tonikaklanges und der Dominantsept hin und her. (Der erste Ton dieser Stimme müßte
esstatt
dheißen, es dürfte sich um einen Druckfehler handeln). Kappeler hätte den Jodel als 16-taktige oder, unproblematischer, weil an den durch die Begleitstimme angezeigten Harmoniewechseln orientiert, als 8-taktige Form schreiben können. Warum er – im Gegensatz zu anderen Jodelaufzeichnungen seiner Sammlung – hier auf Taktstrichsetzung verzichtete, muß Gegenstand von Vermutungen bleiben, sei es, daß er es scheute, Taktwechsel oder einen 5/4-Takt anzunehmen, sei es, daß er damit ausdrücken wollte, daß die Notenlängen nicht als metrische Werte, sondern als Zeitdauerverhältnisse zu verstehen sei oder daß es sich um eine spezielle Art von Rubatonotation handle. Die Frage, wie der Jodel metrisch konzeptualisiert war, ob z. B. die Halbe als gekürzte Dreiviertel verstanden wurde, ob der Jodel im Walzertakt begriffen wurde oder anders, muß unbeantwortet bleiben. Weder über die metrische Deutung Kappelers noch über das Konzept seiner Informanten sagt die Aufzeichnung Eindeutiges aus betreffend die metrische Struktur der Fünfviertelgruppen. Lediglich die Annahme, daß die Appenzeller Walzermelodie auch im benachbarten Toggenburg bekannt war, ließe eine Hypothesenbildung zu. (Aus Kappelers Aufzeichnung geht auch nicht hervor, ob die auf die Halbe folgende Viertel auf auftaktig leichter Zeit oder, wie die Konkordanz Notenbeispiel 8 suggeriert, auf schwerer Zeit steht).
Der Nachteil dieser Aufzeichnungsweise, nämlich daß sie keine Auskunft über das metrische Verständnis des Aufzeichners oder seiner Informanten gibt, kann allerdings auch als Vorteil gesehen werden: In Fällen, in denen der Aufzeichner keine Gewißheit und keine Meinung über das dahinterstehende metrische Konzept hat, erlaubt es ihm diese Aufzeichnungsart, auf willkürliche Unterstellungen zu verzichten und sich auf das zu beschränken, was er mit einiger Sicherheit behaupten kann.
Trotz alledem läßt sich Kappelers Aufzeichnung, wie bereits erwähnt, einem metrisch-harmonischen Formschema zuordnen, nämlich dem Schema I V V I ﹣ I V V I, das im alpenländischen Jodel überaus häufig anzutreffen ist. Darüberhinaus bleibt die metrische Struktur, wenn man nicht die walzerische Auffassung unterstellt, weitgehend undeutbar. Hierin unterscheidet sich Kappelers Aufzeichnung von dem in Notenbeispiel 7 wiedergegebenen Jodelrefrain. Daß dieser metrisch leichter zu deuten war, lag an seiner Form und an seiner leichter durchschaubaren Rubatonotation.
50Wie problematisch ein Taktstrich sein kann, möchte ich mit Notenb. 9 zeigen. Diese Aufzeichnung stammt aus den handschriftlichen Beständen des Schweizerischen Volksliedarchivs und ist ebenfalls in Max Peter Baumanns Werk (Baumann 1976: 167) wiedergegeben. Das Notenbild zeigt einen taktwechselnden, periodisch gebauten Jodel mit fünftaktigem Vorder‐ und fünftaktigem Nachsatz.

| Form: | A Av |
| Zäsur: | Ambitus: III - 7 (−2) |
| Skala: | Fa-Modus (Tritonus) |
| Metrum: | 3/4 und 2/4 |
| Harmonik: | Zerlegter Sextakkord alternierend mit umspielter Dominante, Quart‐ und Dominantseptakkord |
|
Plausibler erschiene mir hier, eine achttaktige Form mit zweimal vier Takten anzunehmen und Takt 2 und 3 sowie Takt 7 und 8 zu je einem 5/4-Takt zusammenzufassen. Dies hätte nicht nur den Vorteil, den Jodel dem häufigen harmonischen Formschema I﹣V﹣V﹣I﹣I﹣V﹣V﹣I zuordnen zu können, sondern auch den, daß sich der fünf Viertel lange Takt als Dehnung oder Verlängerung eines Dreivierteltaktes verstehen ließe:
Der 2/4-Takt T. 5 kann als Kürzung des Halbschlusses von einer Halben auf eine Viertel erklärt werden. Kurz: In diesem Beispiel erblicke ich ebenso wie in den zuvor betrachteten Fällen bloß Abweichungen, nicht Negationen der aus der Tanzmusik bekannten metrisch-formalen Schemata. An die Stelle des vagen Hinweises auf Freiheit
müßte die Klassifikation der Abweichungen treten.
Baumann ordnet in seiner Analyse (Notenbeispiel 9) und seiner Statistik diesen Jodel dem Fa-Modus
zu. Da die erhöhte Quart hier jedoch ausschließlich in Umspielungen der Quint vorkommt, in denen auch Dur-Stücke der Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts gemeinhin die Quart erhöhen, kann ich dieser Auffassung nicht zustimmen. Als Fa-Modus allgemein die Dur-Weise mit auftretendem Tritonus [zu] bezeichnen
(Baumann 1976: 159), dehnt den Begriff des Fa-Modus zu weit aus. Das statistische Ergebnis, daß in 21% der Aufzeichnungen von schweizerischen Jodeln eine erhöhte Quart vorkommt (Baumann 1976: 1597), sagt daher über die Häufigkeit des Fa-Modus nicht mehr aus als daß sie irgendwo zwischen 0 und 21 Prozent liegt.
Als historische Untermauerung für seine Hypothese, daß der nicht stilisierte freie Jodel in den meisten Fällen in keinen Takt eingepaßt werden kann
(Baumann 1976: 160), führt Baumann die Berichte von Ebel und Viotti an: Es ist äußerst schwer, das Thema des Kuhreihen, besonders des appenzellischen in Noten zu setzen, denn dieser Gesang hat nichts Bestimmtes und Regelmäßiges, obgleich der Takt nicht verändert wird.
(J. G. Ebel 1798: 153, zitiert nach Baumann 1976: 194). Und Viotti schreibt über den Ranz de vaches: J'ai cru devoir le noter sans rhythme, c'est-à-dire sans mesure ...
(C. Pougin: Viotti et l'ecole moderne de Violon. Paris 1888: 149, abgedruckter Brief Viottis von 1792; zitiert nach Baumann 1976: 138). Doch scheinen die beiden Aussagen einander zu widersprechen: Laut Ebel hat der Kuhreihen einen Takt, der nicht verändert wird, laut Viotti hat der Kuhreihen kein Metrum. Zieht man in Betracht, daß der Ausdruck Jodlerjodeln erst um 1818 das erstemal in der Schweiz belegt ist (Baumann 1976: 89) und zuvor entweder das Wort Kuhreigen bzw. Ranz de vaches auch das bezeichnet, was heute als Jodel im engeren Sinne von Kuhreigen abgegrenzt wird und Viotti und Ebel vielleicht gar nicht von derselben Sache sprechen oder aber, wie Baumann vermutet, sich die eigentlichen
, auf der modernen Funktionsharmonik basierenden Jodel erst seit 1800 verbreiteten
(Baumann 1976: 84), dann erscheint die Konstruktion einer ungebrochenen, bis auf den Kuhreihen des 18. Jahrhunderts zurückgehenden historischen Kontinuität der rhythmisch und metrisch freien
Jodelinterpretation zweifelhaft.
Last but not least wäre noch für eine über den Schweizer Jodel pauschal aufgestellte Behauptung die empirische Grundlage einzufordern. Es scheint, daß Baumann die auf seiner Feldforschung im Appenzell (Baumann 1976: 191﹣201) gewonnenen Eindrücke auf die übrigen Schweizer Jodellandschaften verallgemeinerte (Baumann 1976: 194). Nun ist aber der Appenzeller Interpretationsstil auch nach meiner Erfahrung ein ausgesprochener Rubatostil. Ob das für den Schwyzer und speziell für den Muotataler Stil ebenfalls zutrifft, steht noch zur Diskussion und zur Untersuchung.
Die Kritik an der von Baumann vorgestellten Auffassung sei nun wie folgt zusammengefaßt:
- Die These, alle früheren Aufzeichner außer Sichardt hätten den Jodel in ein starres Taktschema gedrängt, ist nicht aufrechtzuerhalten.
- Die Konstruktion einer historischen Kontinuität rhythmisch-metrischer
Freiheit
des Jodels (im engeren Sinne) bis zurück ins 18. Jahrhundert ist zweifelhaft. - Eine Verallgemeinerung vom rezenten Jodelstil des Appenzells auf die übrigen schweizerischen Jodelstile ist nicht zulässig. Baumanns Befragung in der Innerschweiz betraf ausschließlich das Chueraiheli, nicht den Jodel im engeren Sinne.
- Die vorgestellten
deskriptiven
Transkriptionen sind nicht geeignet, das Problem des Jodelmetrums einer Lösung näherzubringen: Dort, wo sie rein deskriptiv sind, geben sie die metrischen Konzepte nicht wieder und an Stellen, an denen sie Metrisches ausdrücken, sind sie nicht deskriptiv. sondern hypothetisch. (In letzterem Falle lassen sich, ebenso wiewiebei früherenpräskriptiven
Notationen, alternative Hypothesen aufstellen). - Der Begriff der rhythmischen und metrischen Freiheit umfaßt in seiner Allgemeinheit differente Phänomene, die noch zu erforschen und zu klassifizieren sind. Der Begriff ist geeignet, das Problem zu stellen, nicht aber zu lösen.
Baumanns Verdienst bleibt es jedoch, das Problem gestellt zu haben.
53Heinrich J. Leuthold
Heinrich J. Leuthold war Schuldirektor, Organist und Komponist von Chorwerken. Als Kampfrichter bei zahlreichen Jodlerfesten und als langjähriger Dirigent der Stanser Jodlerbuebe
hatte er nicht nur eine profunde Kenntnis der organisierten Jodelpflege, sein Interesse galt darüberhinaus dem Naturjodel
in der Schweiz, an dessen Renaissance innerhalb der Jodelverbände er maßgeblich beteiligt war. Seine in dem Buch Der Naturjodel in der Schweiz
(Leuthold : 1981) dargelegten sind zum Teil beeinflußt von Max Peter Baumanns Konzept der Unterscheidung in Musikfolklore
und Musikfolklorismus
(Baumann 1975). Ferner ist er der Auffassung, daß jede Landschaft ihren eigenen Jodelstil hat, wobei er nicht nur in drei Großlandschaften Appenzell﹘Toggenburg, Innerschweiz und Bern unterscheidet, sondern diese weiter differenziert: Das Jodelgebiet
(Leuthold 1981: 92). Der Zusammenhang dieser Unterregionen ist nicht bloß äußerlich durch den Begriff Innerschweiz gegeben, sondern auch inhaltlich durch Innerschweiz
gliedert sich deutlich in drei Unterregionen: Schwyz﹘Muotatal, Unterwalden und Entlebuch﹘Luzerner Hinterland.Jodelmelodien, die man in der ganzen Region Innerschweiz kennt und überall singt. [...] In jeder einzelnen Region kommen aber noch weitere eigenständige und nur für diese Region geltende Melodien hinzu, zum Teil Eigengut, zum Teil Import aus benachbarten Landesgegenden
, z. B. sei der Berner Einfluß im Luzerner Hinterland und vor allem im Entlebuch [...] unverkennbar. [...] Daß aber die Entlebucher Folklore trotzdem noch stark mit der übrigen Innerschweiz verhaftet ist, zeigt die Tatsache, daß sogar das Natur-Fa, das sonst ganz besonders in Schwyz und Unterwalden beheimatet ist, sich auch hier vorfindet
(Leuthold 1981: 94), während es im Bernbiet nicht mehr gebräuchlich sei (: 108). Auch im Luzerner Hinterland sei es ausgestorben
(Leuthold 1981: 98). Ob‐ und Nidwalden bilden eindeutig eine spezifische Jodelregion mit praktisch gleichem Melodiegut, das sich nur durch schnellere oder langsamere Vortragsweise unterscheidet
(Leuthold 1981: 98, Hervorhebung im Orig. kursiv).
Ähnlich wie bei Sichardt (Sichardt 1939) tritt auch bei Leuthold zur landschaftlichen Differenzierung eine historisch-stilistische. Während das räumliche Auflösungevermögen bei Leuthold, wohl auf der Basis einer breiteren Empirie, viel höher ist als bei Sichardt, unterscheidet Leuthold historisch nur zwei Arten von Stilelementen: ältere und jüngere. Der am meisten verbreitete Typ ist sicher ein Erzeugnis neuerer Zeit. Er wurde [...] vom Schnadahüpfl beeinflußt. Die stereotype Form der achttaktigen Liedperiode sowohl im Vorder‐ als auch im Nachsatz kehrt immer wieder: Tonika﹣Dominante﹣Domi
54
nante﹣Tonika (T﹣D﹣D﹣T). Die Melodien bewegen sich demgemäß auch stark in diesem vorgezeichneten Schema: Von der einfachen Linie, die fast nur die Akkordtöne berücksichtigt, bis zur reicheren Melodik finden sich alle Varianten.
(Leuthold 1981: 95) – (Wie schon erwähnt, übernimmt Leuthold hier den von Sichardt umgedeuteten Schnadahüpflbegriff). Die meisten Innerschweizer Jodel seien zweiteilig, wobei der 2. Teil motivmäßig oft nur eine Variation des 1. Teils
darstelle (Leuthold 1981: 96). Auch einen Jodel mit dem achttaktigen Harmonieschema T﹣T﹣D﹣T ﹣ T﹣T﹣D﹣T zählt Leuthold zu dieser Stilschicht (Leuthold 1981: 96), die damit in etwa das zusammenfaßt, was Sichardt als jüngste Schicht
und Barock
unterschieden hatte. Der Autor gelangt zu folgender historischer Einschätzung dieser Stilschicht des Innerschweizer Jodels: Stilistisch gesehen dürften die meisten dieser Melodien um die Mitte des
19. Jahrhunderts entstanden sein.
(Leuthold 1981: 98).
Von den Kennzeichen der jüngeren Stilschicht unterscheidet Leuthold die auf frühere musikalische Zeitepochen hinweisenden Stilelemente
, nämlich:
- „- herbe, offene Vokalisation auf ä, e, i, seltener o;
- - freier, ungebundener Rhythmus, der sich nicht an einem festen Metrum orientiert.
- - Abweichung vom Acht-Takte-Schema zugunsten eines Rhythmus, der auf festes Taktgefüge verzichtet;
- - vermehrtes Anwenden von
la(VI. Stufe) und damit Annäherung an die Pentatonik;- - kurze Vor‐ und Nachschläge;
- - Portamento (schleifender Übergang von einem Ton zum andern, wobei das [...] abwärtsführende Schlußportamento nur eine besondere, wenn auch auffällige Abart darstellt.“(Leuthold 1981: 100).
All diese Stilelemente können auch mit nachweisbar jüngeren Melodien verkoppelt werden, die damit den Eindruck urtümlicher Musik erwecken. Ebenfalls läßt sich das Natur-Fa beliebig oft anwenden
(Leuthold 1981: 100). Dieser Hinweis relativiert allerdings die historische Zuordnung. Noch mehr tut dies die Beobachtung, daß der typische Natursänger, den man heute nur mehr selten antrifft, f...] spontan all die auf frühere Zeitepochen hinweisenden Stilelemente an[wendet]
(Leuthold 1981: 100), denn sie läßt eher an Unterschiede zwischen einem traditionellen und einem von der organisierten Jodelpflege beeinflußten Interpretationsstil denken, also an Differenzen, die erst ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auftreten. Das gilt in erster Linie für die Vokalisation, die kurzen Vor‐ und Nachschläge und das Portamento, d.h. für die eindeutig der Kategorie Interpretationsweise zugehörenden Eigenschaften. Aber auch, was das melodisch-formale Element der vermehrten
55
Anwendung der sechsten melodischen Stufe betrifft, läßt sich eine plausible Gegenhypothese aufstellen: Die häufigere Verwendung von Dominantseptnonenakkorden und das Auftreten von Tonika-sixte-ajoute-Klängen ist Kennzeichen eines jüngeren Stils, der in Wiener Tanzmusikkompositionen und im Wiener Ländler (Fritz 1993: 398 ff.) etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in Appenzeller Tanzmusikkompositionen (Manser 1979) im letzten Fünftel des 19. Jahrhunderts aufkam und den Jodel beeinflußte. Das Aufkommen dieses Stils in der Innerschweiz ist historisch noch nicht untersucht. Er hat mit Pentatonik nichts zu tun. Das ist auch aus dem Belegexemplar Leutholds (Notenbeispiel 10) zu ersehen.
Horgebärgleraus Einsiedeln (Leuthold 1981: 101) Unten: Beginn der namenlosen Variante aus Nidwalden die Leuthold aus der Erinnerung an seine Schulbubenzeit (1918﹣1926) aufzeichnete (Leuthold 1981: 101). Die von mir hinzugefügten funktionstheoretischen Bezeichnungen geben die harmonisch-melodische Deutung Leutholds wieder.
Damit bleibt von den von Leuthold aufgelisteten auf frühere musikalische Zeitepochen hinweisenden Stilelementen
nur noch der freie Rhythmus und die Abweichung vom Acht-Takte-Schema, Eigenschaften bzw. Deutungen, die in der vorliegenden Arbeit zur Diskussion stehen und in den nächsten Kapiteln eingehend behandelt werden sollen. (Daß sich das Natur-Fa
nicht in der zit. Liste findet, liegt vielleicht daran, daß Leuthold es schon in einem früheren Kapitel (Leuthold 1981: 34 ff) abgehandelt hat).
Damit ist bereits der Muotathaler Jodel
thematisiert. Muotathaler Jodel
wird bei Leuthold zu einem rein stilistischen Begriff, der geographisch nicht mehr ausschließlich ans Muotatal gebunden ist und auch auf manchen anderen Innerschweizer Jodel anwendbar ist. Das Charakteristikum dieses Stils sieht der Autor im Melodischen
(Leuthold 1981: 101) und zwar in ungewöhnlichen Vorhalten und in harmoniefremden Tönen, die nicht in die heute gängigen melodisch-harmonischen Vorstellungen passen, bis hin zu völlig ametrischen und aharmonischen Gebilden.
Als Beispiel für Vorhalte führt Leuthold die Nidwalder Fassung des Horgebärglers
an (Notenbeispiel 10, untere Notenzeile): Der erste Takt würde mit der Tonika begleitet, der zweite schaltet auf die Dominante um, beginnt aber mit dem akkordfremden Ton
(Leuthold 1981: 101). Da Leuthold f
, der dritte Takt kehrt zur Tonika zurück beginnt aber mit dem d
, dem Ton der VI. Stufe! Wir haben es hier mit einer Art von Vorhalten zu tun, die jedoch den ganzen melodischen Ablauf bestimmen.die Melodie aus der Schulbubenzeit [...] in Erinnerung
ist (Leuthold 1981: 101) und diese Formulierung wohl so zu verstehen ist, daß er sie selbst als Schulbub gesungen hat, ist seine Beschreibung des harmonischen Verlaufes als Information aus erster Hand
zu werten.
Zu den beiden Varianten (Notenbeispiel 10) merkt Leuthold an, dass der Ausdruck
(Leuthold 1981: 101).Muotathaler
nur sehr bedingt richtig ist. Tatsächlich handelt es sich um einen Jodeltyp, der Früher mit Sicherheit sowohl in ganz Schwyz und in Unterwalden, (mindestens Nidwalden) beheimatet war. Das Muotatal ist ein Reduitgebiet, in das sich diese Jodelart zurückgezogen hat.
Daß die Muotathaler Melodik auch in Nidwalden beheimatet war
(Leuthold 1981: 101), möchte Leuthold noch an einem zweiten Beispiel zeigen (Notenbeispiel 11).
Dr Ämätter, mitgeteilt 1978 von Oskar Würsch, Emmetten (Nidwalden), aufgezeichnet von Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981: 101).
Der Aufzeichner spürt hier im 3. und 7. Takt den Muotathaler Modus
heraus (Leuthold 1981: 101) und meint dazu: Nach modernem Tonika-Dominant-Empfinden würde man die Melodie etwa folgendermaßen zu Ende führen:
(Leuthold 1981: 102). Im vier‐ oder Fünfstimmigen Satz eines Jodlerklubs
57
und mit dem von Leuthold beschriebenen
entweder
oder
Statt dessen besteht aber die letzte Achtelfigur aus dem Septimenintervall e﹣d, das sich harmonisch weder in die V. noch in die I. Stufe einordnen läßt.modernen
melodisch-harmonischen Empfinden ließe sich der Jodel vielleicht wirklich nicht ganz problemlos realisieren. Jener dreistimmige Satz hingegen, der auf der von Hugo Zemp herausgegebenen Schallplatte (Zemp 1979) und der CD (Zemp 1990) hörbar wird, erwiese sich, das sei hier schon als Vorgriff auf die Analyse des Muotataler Tonsatzes
vorausgeschickt, als dieser Melodik angepaßter. Gesetzt den Fall, der Baß bliebe den ganzen Takt 3 auf der Dominante, dann wäre das dritte, vierte und fünfte Achtel als Durchgangsquartsextakkord aufzufassen oder aber das dritte und vierte Achtel als Durchgangsquartsextakkord und das e im 5. Achtel schon als Vorausnahme der Terz des folgenden Tonikaklanges. Jedenfalls ist das C im 4. Achtel als Durchgang h﹣c﹣d verständlich.
Auf die melodisch-harmonischen Verhältnisse wird hier deshalb eingegangen, weil ihre Kenntnis bei der metrischen Deutung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen wird. Wenn Vorhalte, Durchgänge und vielleicht Vorausnahmen im Unterwalder Jodel vorkommen und der Unterwalder Heinrich J. Leuthold solche Bildungen als muotatalerisch empfindet, dann wird bei der Aufstellung und Diskussion metrischer Hypothesen über Muotataler Jodelmelodien mit solchen Bildungen zu rechnen sein. Wenn die von Leuthold und von mir gegebene melodisch-harmonisch-metrische Deutung obiger Unterwalder Jodel richtig ist – und ich sehe wenigstens keinen Grund, an Leutholds Interpretation zu zweifeln*)
*) Siehe jedoch die weiter unten (S. 169 f.) aufgetauchten Zweifel an der Richtigkeit von Leutholds Taktstrichsetzung in Notenbeispiel 11.
– und wenn er damit recht hat, daß diese beiden Jodel (Notenbeispiel 10 und 11) stilistisch dem Muotathaler
ähnlich sind, dann wird allerdings die folgende Schlußfolgerung Leutholds unverständlich: Der alte Muotathaler zeichnet sich aus durch eine wilde, unstete, oft überraschende Melodieführung, wie sie sonst kaum irgendwo anzutreffen ist
(Leuthold 1981: 101), denn derlei Vorhalte und Durchgänge sind in der Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts überaus gewöhnlich, ebenso die Darstellung einer Zwei‐ oder Dreistimmigkeit durch eine einzelne Stimme:
entspricht
Die Vorhaltssext im Horgebärgler
(Takt 3) erweist sich außerdem als Teil einer absteigenden Linie f﹣e﹣d﹣c. Parallelen bei Bach oder Chopin liegen nicht fern. Die Frage, ob ein tatsächlicher Zusammenhang mit der Kunstmusik besteht, wird zu stellen sein.
Der Vollständigkeit halber sei auch noch das dritte melodische Charakteristikum des Muothalers
angeführt, obgleich es bei der metrischen Deutung eine geringere Rolle spielt: Es sind jene kurzen Fa-Nachschläge, die hauptsächlich, aber nicht auss
(Leuthold 1981: 38). Notenbeispiel 12 zeigt, daß solche Nachschläge auch schrittweise nach unten weitergeführt werden (Takt 3﹣4). In Takt 6 und 7 hat Leuthold diese Verzierung als Achtelnote ausgeschrieben.schließlich, Quinten angehängt werden, bevor die Melodie einen höhern Ton anzielt.

's Dävids Juz, dem Aufzeichner Heinrich J. Leuthold mitgeteilt von Alois Lüönd, Siebnen (Leuthold 1981: 102)
Ob der Ausdruck Nachschlag
berechtigt ist, ob es sich also wirklich um eine Verzierung handelt und nicht etwa um einen obligaten Teil der Melodie, ist an einem einzigen Beispiel nicht zu erkennen. Die zahlreichen von Hugo Zemp veröffentlichten Feldaufnahmen ermöglichen es jedoch, Leutholds Einschätzung zu überprüfen und zu erhärten. Die Melodiewiederholungen ermöglichen es, den ad-libitum-Charakter des an die fünfte Leiterstufe angehängten Fa festzustellen. Ein weiters Indiz ist das legato im Unterschied zum non legato der anderen Melodietöne, ein Unterschied, der auch im Sonagramm sich zeigt.
Leutholds Eindruck des Wilden und Unsteten des Muotathalers
wird erst verständlich im Zusammenhang mit einer weiteren Eigenschaft, die er allerdings nicht als Charakteristikum des Muotatalers
schlechthin, sondern einer älteren Stilschicht des alpenländischen Jodels generell ansieht, nämlich dem freien Rhythmus und der Abwesenheit eines festen Taktgefüges.
Die Melodie Notenbeispiel 12 zählt Leuthold eindeutig nicht zu dieser Gruppe: Die rhythmusgebundene, nach dem Acht-Takt-Schema geschaffene Melodie mit ihrem regelmäßigem Wechsel D﹣T﹣D﹣T reiht sie ganz klar als Neukomposition ein, und dies trotz der Muotathaler Garnitur.
(Leuthold 1981: 102).
Als klassisches Beispiel eines echten Muotathalers
, bei dem die typische Muotahaler Linienführung [...] noch ergänzt [wird] durch den absolut freien Rhythmus, wie er in einem neuern Jodel kaum möglich wäre
(Leuthold 1981: 102), bezeichnet Leuthold den in Notenbeispiel 13 wiedergegebenen Jodel.
Muotathaler Jodel, mitgeteilt vom Naturjodler Toni Büeler, Muothathal(Leuthold 1981: 57).
Leutholds Informant ist der aus Muotathal stammende Anton Büeler (geb. 1941), der 12 Jahre (1959﹣1971) in Nidwalden lebte und 21 Jahre lang (1963﹣1984) Mitglied, davon die meiste Zeit Vorjodler der Stanser Jodlerbuebe
war,
*)
*) Gespräch mit Toni Büeler am 10. 4. 1996
jenes Jodlerchores, den Heinrich J. Leuthold seit 1933 leitete (Leuthold 1981: 4).
Es ist anzunehmen, daß Leuthold diesen Juuz von Toni Büeler nicht bloß ein einziges Mal hörte. Unklar ist nach Leutholds Beschreibung, ob es sich um die Transkription einer Tonbandaufnahme handelt, unklar ist damit auch, ob die Notation eine einzelne Interpretation mitsamt ihren Zufälligkeiten beschreibt oder davon abstrahierend das Wesentliche
wiedergibt.
Ich habe im vorigen Unterkapitel rhythmische und metrische Freiheit
in mehrere Ebenen differenziert. Auch Leuthold unterscheidet in seiner Liste altartiger Stilelemente zumindest zwei Ebenen, nämlich den ungebundenen Rhythmus, der sich nicht an einem festen Metrum orientiert
, was ich als Taktwechsel oder/und Rubato interpretiere, und die Abweichung vom Acht-Takte-Schema zugunsten eines Rhythmus, der auf festes Taktgefüge verzichtet
(Leuthold 1981: 100), Auf den obigen Jodel trifft beides zu, wie der Aufzeichner berichtet: Diese Melodie fließt in einem absolut freien Rhythmus, der keinem Metrum unterliegt. Eine Viertelnote ist hier nicht einfach eine Viertelnote. Sie wird, je nach Lust und Laune des Sängers, bald etwas länger gehalten, bald verkürzt. Es ist unmöglich, ein Metrum zu konstruieren, oder gar eine periodische Takteinteilung herauszufinden, die der Melodie gerecht wird.
Leutholds Aussage, die auf einen Rubatostil hindeutet, steht im Widerspruch zu der Sichardts, der Muotataler Rhythmus sei von metronomartiger
Gleichmäßigkeit. Leuthold dürfte dieser Widerspruch nicht aufgefallen sein, denn er unternimmt es, seine Aussage mit folgendem Sichardt-Zitat zu unterstreichen: eigentümlich irrational verdehnte Rhythmik mit starker agogisch-ausdruckshafter Hervorkehrung der Spitzentöne. Hinsichtlich der Zeitwerte ist die Notierung nur als Annäherung aufzufassen. Es dürfte
60
schwer, wenn nicht unmöglich sein, die Fülle der irrationalen Züge dieser Rhythmik und Vortragsart graphisch festzuhalten.
(Sichardt 1939: 35. Zitiert von Leuthold 1981: 58). Diese Stelle bei Sichardt bezieht sich jedoch, was Leuthold entgangen sein dürfte, auf einen Appenzeller Jodel. Auf diesem Mißverständnis aufbauend fährt Leuthold fort: Trotzdem versucht Sichardt, mit verschiedenen Taktwechselangaben (2/4, 5/4, 4/2, 5/2, 3/2 usw.) dem Geheimnis dieses Muotathaler Rhythmus' auf die Spur zu kommen. Wo doch überhaupt jedes Metrum fehlt!
(Leuthold 1981: 58). Zwar beziehen sich auch die von Leuthold zitierten Taktwechselangaben auf den Appenzeller Jodel (Sichardt 1939: 34f. Nr. 44 Coda
) Dennoch trifft er mit dem Hinweis auf seine Auffassungsdifferenz zu Sichardt das Richtige, denn pointierter Taktwechsel
ist für Sichardt ein Charakteristikum des Muotatal-Stils
(Sichardt 1939: 130). Leutholds Deutung ist der Auffassung Sichardts diametral entgegengesetzt und zwar sowohl auf der Ebene des Metrums (Metrum fehlt versus Taktwechsel) als auch auf der Ebene des Rhythmus (absolut freier Rhythmus versus metronomartig pulsierender Rhythmus). Beide Autoren stimmen allerdings darin überein, daß es im Muotatal Jodel gibt, die sich metrisch von den im Alpenraum üblichen Jodeltypen grundlegend unterscheiden. Für Sichardt ist die metrische Besonderheit Charakteristikum eines Muotataler Regionalstils, für Leuthold Kennzeichen einer älteren Stilschicht im alpenländischen Jodel schlechthin.
In der melodisch-harmonischen Deutung gelangen die beiden Autoren zu ähnlichen Formulierungen: Die Melodieführung [...] ist immer nur linear melodisch, nie harmonisch empfunden
(Leuthold 1981: 100); Die großen Sprungintervalle, namentlich Sexten und Septen, haben hier keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion.
(Sichardt 1939: 30). Genaugenommen geht aber auch hier Leutholds Behauptung viel weiter als die Sichardts. Wie die metrischen Bezüge erscheinen auch die harmonischen bei Sichardt teilweise, bei Leuthold jedoch gänzlich aufgelöst. Diese Parallelität zwischen der metrischen und der harmonischen Deutung ist vielleicht nicht zufällig, ist doch der Takt beim alpenländischen Jodel gemeinhin an den Harmoniewechseln erkennbar. Könnte es nicht sein, daß Vorhalte, Vorausnahmen, Durchgänge und abgesprungene und frei eingeführte Nebennoten den Muotataler Jodel in einem derart hohen Ausmaß bestimmen, daß beide Autoren die dahinterliegende metrisch-harmonische Struktur nicht erkannten, weil sie einen so komplexen Tonsatz von vornherein gar nicht erwarteten? Als unnötig erwiese sich dann Sichardts Hypothese des hohen Alters, die auch von Leuthold geteilt wird: Die Melodik des echten Muotathalers weist dermassen unverkennbar archaische Züge auf, dass die berechtigte Vermutung besteht, ihre Anfänge reichen bis weit in die Vorgregorianik zurück.
(Leuthold 1981: 100).
Alfred Leonz Gaßmanns Muotataler Aufzeichnungen enthalten weder ametrische
61
noch harmonisch undeutbare noch sonst irgendwie ungewöhnliche Jodel.
Da sowohl Gaßmann als auch Leuthold eine gewisse Kenntnis der Kultur
zugebilligt werden muß, ließe sich dies damit erklären, daß Gaßmann nur eine sehr kleine Anzahl Muotataler Jodel kannte und ihm die ungewöhnlichen entgangen waren oder er sie aus irgendeinem Grund nicht weiter beachtete.
In einem Punkt gleichen einander jedoch die metrisch regulären und die metrisch irregulären Jüüzlinotationen: Es handelt sich in beiden Fällen um periodisch gebaute Formen mit einem Vordersatz und einem etwas kürzeren Nachsatz, wobei diese Längendifferenz bei den regulärtaktigen Jodeln als Differenz zwischen einem weiblichen und einem männlichen Schluß auftritt.
Auch in Notenbeispiel 13 scheint dies der Fall zu sein. Zwar setzen die Begriffe männlicher und weiblicher Schluß eine metrische Struktur voraus und können daher nicht auf metrumlos aufgezeichnete Jodel angewandt werden. Die formale Ähnlichkeit ist jedoch augenfällig und gibt Anlaß zu der Vermutung, daß die taktlos oder taktwechselnd geschriebenen Jodel mit den regulärtaktig notierten doch mehr zu tun haben als Leuthold und Sichardt für möglich hielten. Auch wird die These zu prüfen sein, daß es Jüüzli gibt, die nur linear und nicht harmonisch empfunden sind. Die Begriffe des Linearen und des Harmonischen schließen einander ja nicht aus, wie die Analyse des Horgebärglers
zeigte. Leutholds Hinweis auf Vorhaltbildungen könnte sich vielleicht auch bei den nur linear melodisch
gedeuteten Jodeln als fruchtbar erweisen. Damit wird die Forderung nach einer Erforschung des Muotataler Jodeltonsatzes ausgesprochen, die mit der metrischen Analyse parallelgehen muß. Denn der Begriff des Vorhalts wie auch der der Vorausnahme und des harten und weichen Durchgangs enthält auch eine metrische Komponente.
Und die Taktgliederung ist zumindest beim regulärtaktig notierten Jodel eng mit dem harmonischen Verlauf gekoppelt in Form des taktschlüssigen Harmoniewechsels. Ob solches Bemühen, zu einer neuen Theorie des Muotataler Jodels vorzustoßen, Aussicht auf Erfolg hat, ist jedoch nicht von vornherein schon sicher. Denn Leuthold hat sich in seinem Kapitel über Probleme um die
mit dem Zusammenhang zwischen Melodie‐ und Harmonieverlauf und Taktstrichsetzung sehr wohl auseinandergesetzt, es ist äußerst unwahrscheinlich, daß er die Metrumlosigkeit der Muotataler Jüüz' leichtfertig behauptete.die Rhythmisierung der Jodelmelodien
Abschließend sei noch genauer auf Leutholds Metrumbegriff eingegangen. In der zweiten Zeile von Notenbeispiel 13 sind Notenwerte, die zusammen eine Viertel ergeben, mit je einem Balken verbunden. Die Synkopenschreibung (statt einer Viertelnote g) sowie die Tatsache, daß die binäre Ordnung ohne Unterbrechung durchgeht und die Schlußnote auf Schwerzeit zu stehen
62
käme, bestärken den Eindruck, daß die Balken metrisch gemeint sind. Das scheint im Widerspruch zu stehen zur Aussage, es sei bei diesem Jodel unmöglich, ein Metrum zu konstruieren
(Leuthold 1981: 58). Es muß daher angenommen werden, daß Leutholds Metrumbegriff die bloße binäre oder ternäre Basisstruktur nicht genügte, sondern nach einer Zusammenordnung solcher Paare oder Tripel zu Takten verlangte, daß also Leuthold unter Metrum
eine mindestens zweistufige metrische Ordnung (Schlag und Takt) verstand. Leuthold hat noch zwei weitere Jodel taktstrichlos notiert.
Es handelt sich hierbei um Muotataler Büchelgsätzli
, das sind Holztrompetenmelodien, die auch gejodelt werden (Notenbeispiel 14): Der Rhythmus ist ziemlich lebhaft, bevorzugt nach echter Muotathaler Manier ein wildes Auf und Ab, meist ohne feste Bindung an ein rhythmisches Schema oder gar einer strengen Metrik.
(Leuthold 1981: 103). Die zwei Stücke gehören zu jener im Muotataler wie überhaupt im alpenländischen Jodel sehr seltenen Spezies, die nicht oder nur andeutungsweise periodisch gebaut sind. Das Notenbeispiel 14 b) weist einen unsystematischen Wechsel binärer und ternärer Achtelgruppen auf. Es zeigt ebenso wie Notenbeispiel 13 eine Tendenz des Transkribenten, tiefere Töne als schwerere Zeiten aufzufassen, die Unterquart vor dem Grundton jedoch auf leichter Zeit, quasi auftaktig.

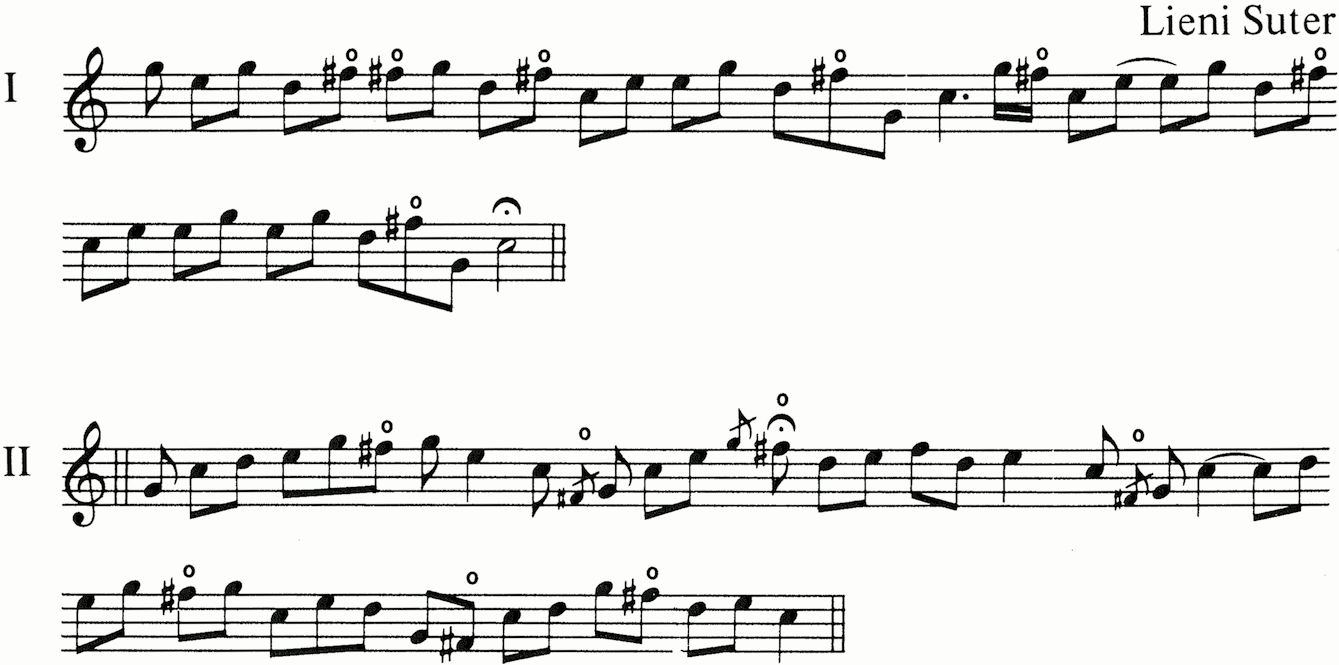
Das erste Beispiel, kopiert ab einer alten Schallplatte, wurde gesungen vom bekannten(Leuthold 1981: 103).Wichels Wiisi, einem hervorragenden Jodler; das zweite Beispiel ist eigene Bandaufnahme des Jodlers Lieni Suter aus dem Muotathal
Hugo Zemp
Seine 1979 entstandenen Muotataler Feldaufnahmen hat Zemp zweimal veröffentlicht: 1979 als Schallplatte und 1990 als CD. Weiters produzierte er in den Achtziger Jahren vier Filme über den Jodel im Muotatal:Juuzen und Jodeln,
Kopfstimme, Bruststimme,
Die Hochzeit von Susanna und Josephund
Glattalp(Zemp 1978). Von Zemp gibt es keine publizierten Transkriptionen Muotataler Jüüzli, dafür bieten die zahlreichen ein‐ bis dreistimmig gesungenen Jüüzli auf der CD nicht nur die Möglichkeit, zu transkribieren und den Muotataler Jodeltonsatz zu erforschen, sondern auch mittels sonagraphischer Messungen die Rubatohypothese zu überprüfen und Indizien für die metrische Struktur zu gewinnen, die, da die CD im Unterschied zu meinen eigenen Feldaufnahmen im Handel erhältlich und jedem zugänglich ist, intersubjektiv und überprüfbar sind. Deshalb wird der naturwissenschaftliche Teil meiner Arbeit primär auf den von Zemp 1990 herausgegebenen Feldaufnahmen basieren.
Das der CD beigegebene Textheft enthält Informationen über das gesellschaftliche Umfeld des Juuz, seine Funktionen, die Stimmgebung, das Tonsystem, die mehrstimmige Praxis und die musikalische Form, aber kaum über das Metrum.
Dies ist umso erstaunlicher, da es sich hierbei um ein umstrittenes Thema und ein ungeklärtes Problem handelt, zumindest seit dem Erscheinen von Leutholds Buch (Leuthold 1981). Doch standen in der mit den Filmaufnahmen von 1983 und 1984 verbundenen Forschungstätigkeit Hugo Zemps und Peter Betscharts andere und vielleicht wichtigere Fragen im Vordergrund. So spart Zemp, als er die Sichardtschen Beobachtungen bestätigt, das Metrum aus: Der Stil der Muotataler Jüüzli unterscheidet sich von dem der anderen Gebiete der Schweiz unter anderem durch den
(Zemp 1990). Es hieße diese Stelle wahrscheinlich überzuinterpretieren, wollte man darauf hinweisen, daß Sichardt von einem pulsierenden
Rhythmus, die Zig-zag
Melodik und die extreme Spannung der Stimme mit ihrem nasalen, an den Klang der Oboe erinnernden Klang. Diese [von Sichardt] für den Muotataler Juuz als typisch beschriebenen Merkmale können noch heute beobachtet werden.gleichmäßig (
spricht und Zemp nur von einem metronom-artig
) pulsierenden Rhythmuspulsierenden
.
Tatsache ist jedenfalls, daß Zemp von den vielen von Sichardt (Sichardt 1939: 130 f.) angeführten Muotataler Charakteristika nur drei hervorhebt und zu den für meine Fragestellung relevanten umstrittenen Aussagen Pointierter Taktwechsel L...] Einheitliches Zeitmaß
(Sichardt 1939: 130) nicht Stellung bezieht.
An anderer Stelle, als Zemp auf die Varianten zu sprechen kommt, geht er jedoch kurz auf Metrisches ein: Wenn eine große Dynamik im allgemeinen
64
charakteristisch für den Juuz ist, so überraschen gewisse Sänger, wie Erasmus Betschart (vgl. 2) und Alois Suter (vgl 12c und 14) durch Intensitäts-Akzente auf schwachen Zeiteinheiten.
(Zemp 1990). Dieser Hinweis bleibt jedoch kryptisch, weil Zemp nicht angibt, welches Metrum vorliegt und welche Zeiteinheiten als schwache zu verstehen seien. Er scheint davon auszugehen, daß das Metrum intuitiv klar ist. Wie die in der vorliegenden Arbeit angestellten Analysen zeigen, gibt es jedoch bei einigen dieser 7 Jüüzli, die Zemp mit den 3 Nummern seiner CD anspricht, metrische Zweideutigkeiten.
Trotz gewisser Archaismen gehört der Muotataler Juuz zum tonalen Tonsystem
(Zemp 1990). Mit dieser generellen Aussage widerspricht Zemp sowohl der Hypothese Sichardts, es gebe im Muotataler Jodel eine vorgregorianische Schicht
als auch der Hypothese Leutholds, es gebe ein Muotataler Jodelmelos, das nur linear melodisch, nie harmonisch empfunden
werde. Der Höreindruck besonders der dreistimmigen Realisationen scheint Zemp rechtzugeben: Die dritte Stimme [...] singt meistens nur zwei Töne im Bassbereich, die Tonika und die untere Dominante.
(Zemp 1990). Doch kommt nicht jeder Juuz von Zemps Tonaufnahmen in mehrstimmiger Fassung vor. In den einstimmigen Fassungen erschweren oft die Vorhalte und Durchgänge die harmonische Deutung. Und es gibt Jüüz', die selbst den Muotataler Juuzern Schwierigkeiten bereiten, wie Hugo Zemp berichtet: Emmi Suter﹘Gwerder ist für ihre verdrääte Jüüzli bekannt, die schwierig zum Abnehmen (abnää) sind
(Zemp 1990), was nichts anderes heißt als daß es einer zweiten Stimme schwerfällt, eine passende Begleitung zu diesen verdrehten
Jüüzli zu finden. Weshalb das so ist, ist eine weitere Forschungsfrage.
Was die musikalische Form betrifft, so unterscheiden sich die Jüüzli aus dem Muotatal kaum von den Jodeln anderer Schweizer Gebiete. Die meisten haben zwei Taili, jeder Teil wird wiederholt (AABB); manchmal wird ein dritter Teil hinzugefügt (AABBCC). Gewöhnlich wird der letzte Ton jedes Teils etwas länger ausgehalten, [...], gefolgt von einer Atempause. Bei gewissen Jüüzli können die Teile auch ohne Unterbrechung wiederholt werden, vorausgesetzt die Ausführenden haben genügend Atem, um dies in einem Zug zu tun
(Zemp 1990; Hervorhebung im Orig. kursiv).
Es ist nämlich im Muotatal üblich, einen Teil
auf einem Atem zu singen.
*)
*) Mitteilung von Peter Betschart
65
Genau besehen handelt es sich in den meisten Fällen nicht um eine wortwörtliche Wiederholung, sondern um Vorder‐ und Nachsatz einer Periode.
Daher ziehe ich es – im Unterschied zu Zemp und Baumann – vor, die zweiteilige Form wie folgt mit Kleinbuchstaben zu schreiben: aa' bb', und die dreiteilige: aa' bb' cc', mit Großbuchstaben jedoch den ganzen Teil, Vordersatz + Nachsatz, zu bezeichnen: AB und ABC. Daß auch die von Sichardt und Leuthold als archaisch eingestuften Jüüzli diese Form haben, ist, wie schon erwähnt, ein Indiz dafür, daß ihre Andersartigkeit nicht auf eine ältere Stilschicht hinweist, sondern auf eine höhere harmonisch-melodische Komplexität, die es den Aufzeichnern erschwerte, bei einstimmiger Interpretation die angemessene harmonisch-metrische Deutung zu finden. Sichardt und Leuthold wären, wenn diese Hypothese stimmt, Opfer der verdrehten Jüüz'
geworden, weil sie, aus welchen Gründen auch immer, deren Kompliziertheit unterschätzt hätten. Die Gegenhypothese wäre, daß Zemp von den harmonisch und metrisch leichter verständlichen dreistimmigen Jüüzli auf die einstimmigen verdrehten
Jüüz' falsch verallgemeinerte.
Peter Betschart
Der wohl beste Kenner des Muotataler Juuz ist der Muotataler Lehrer Peter Betschart. Er arbeitete bei Zemps Filmprojekt mit; auch ich verdanke ihm eine Menge Informationen. Betschart ist dem hypothesenbildenden Zugang der früheren Forschung gegenüber kritisch eingestellt, bei ihm steht die Empirie im Mittelpunkt:Es ist meiner Meinung nach leicht verfehlt, über Ursprungstheorien und Zuordnung bestimmter Charakteristiken zu schreiben, f...] Wesentlicher erscheint mir die Feldforschung(Betschart 1981: 3).
Es paßt zu Betscharts empirischer Ausrichtung, daß er auf die Frage des Metrums kaum eingeht. Denn Methoden, die das im musikalischen Bewußtsein der Juuzerinnen und Juuzer verborgene und der direkten Beobachtung entzogene metrische Gefüge ans Tageslicht brachten, sind in der alpenländischen Jodelforschung noch nicht entwickelt.
In Anlehnung an Heinrich J. Leuthold unterscheidet Betschart drei Jodeltypen im Muotatal:
- Büchelgsätzli
- Jüüzli mit eigenwilliger Melodik und Natur-fa
- Holouri-Typ
(Betschart 1981, 15).
Das Charakteristikum der Jodel vom 2. Typ liegt im Melodischen: Sie sind auf keinem eindeutigen Motiv aufgebaut (H. Leuthold), die Melodie springt hin und her, kehrt aber immer wieder zum Grundton zurück; sie wirken unschön für unser heutiges Musikempfinden, weil kein schöner Melodiebogen entsteht.
(Betschart 1981: 17). Zu dieser Art gehören die meisten Jüüzli mit dem Merkmal Natur-fa. [...] Auch viele Melodien ohne Natur-fa können hierzu gezählt werden. [...] Bei diesen Jüüzli findet man auch die Eigenheit, dass die Tonstufe nicht regelmäßig, oder auf einem unbetonten Taktteil wechselt.
(Betschart 1981: 17). Mit Tonstufe
meint Betschart die harmonische Stufe. Aus dieser kurzen Bemerkung zum Thema Metrum geht hervor, daß Betschart in diesen Jodeln sehr wohl einen Takt
erkennt, und dies trotz der eigenwilligen Melodik
. Betscharts Aussage steht damit in scharfem Gegensatz zu der Auffassung, die Leuthold in seinem im selben Jahr (Leuthold 1981) erschienen Buch darlegt. Betscharts Bemerkung ist ferner zu entnehmen, daß er den Takt keineswegs als bloße Funktion des Harmonieverlaufs ansieht derart daß jeder Harmoniewechsel als Schwerzeit aufzufassen wäre. Im Widerspruch zu Leutholds und Sichardts Auffassung steht weiters Betscharts harmonische Interpretation.
67
An keiner Stelle ist bei ihm die Rede von rein linear
empfundenen Jüüzli.
Wie er zu seinen metrischen Deutungen gelangt, an welchen Eigenschaften das Metrum erkennbar ist, darüber läßt sein Beitrag den Leser im Unklaren. Das Metrum scheint ihm ebenso wie Sichardt, Gaßmann und Leuthold nicht Deutungskonstrukt eines Beobachters, sondern etwas objektiv Gegebenes und intersubjektiv Erkennbares zu sein. Und Zemp hat dieser Haltung zumindest nicht widersprochen. Mit jener zuerst bei den Erforschern afrikanischer und asiatischer Musik aufgekommenen Skepsis gegenüber den metrischen Deutungen Kulturfremder wäre freilich am allerwenigsten den Ausführungen des Muotatalers Peter Betschart zu begegnen, stünde seine Auffassung nicht in so großem Gegensatz zu der Leutholds, dem eine gewisse Kenntnis der Kultur
ebenfalls nicht abzusprechen ist.
Der Holiouri-Typ
, den Betschart nicht näher beschreibt, ist in seiner Typologie als Gegensatz zu Typ 2 konzipiert. Es handelt Sich demnach um Jodel mit einem für das heutige Musikempfinden schönen Melodiebogen
, diese Jodel sind auf einem eindeutigen Motiv aufgebaut
, haben meist kein Natur-fa und die harmonische Stufe wechselt regelmäßig und zwar auf den betonten Taktteilen. Diese Umkehrung der Beschreibung von Typ 2 trifft auf den Großteil der Aufzeichnungen schweizerischer wie österreichischer Jodel zu.
Betschart verweist hier auf die Ausführungen von Gaßmann und Sichardt.
Den Begriff Holiouri-Typ
hatte Alfred Leonz Gaßmann (Gaßmann 1936) eingeführt.
Gaßmann sah den bekannten schweizerischen Alphornruf, den Rigiruf, den Säntisruf – oder wie ihn die Leute nennen
als den Urtyp unseres schweizerischen Volksliedes, unseres Nationalgesanges
an (Gaßmann 1936: 15; siehe Notenbeispiel 15), sein Wesen sei eine Harmonie, ein Akkord, ein Dreiklang
(Gaßmann 1936:16)

Tonpsychologie
(Gaßmann 1936: 15)
Tonpsychologie
(Gaßmann 1936) findet sich nicht einmal in Sichardts Literaturverzeichnis (Sichardt 1939: 176﹣182). Vielleicht hatte Betschart eine Synthese aus Gaßmanns Holiouri-Typ
und Sichardts Schnadahüpfeltyp
im Auge.
Die im Muotatal gejuuzten Büchelgsätzli, Bücheljüüz'
genannt (1. Typ in Betscharts Einteilung), unterscheidet Betschart in zwei Arten: Es gibt
68
schöne, rhythmische Melodien (a) und freirhythmische, komplizierte Jüüzli (b)
(Betschart 1981: 17; siehe Notenbeispiel 16).
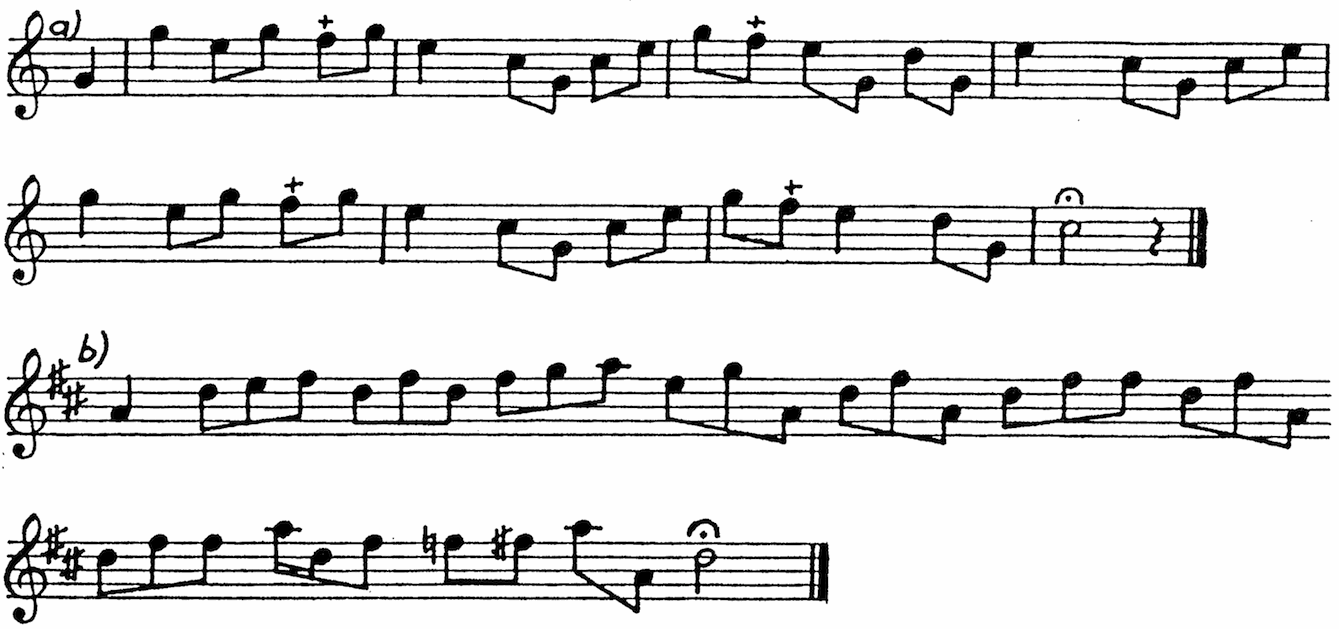
Freirhythmischebestehen soll: Notenbeispiel 16 b) ließe sich problemlos im 3/8-Takt schreiben, zumal die Setzung der Achtelbalken diese Auffassung von vornherein suggeriert. Auch ein 6/8-Takt ginge sich aus, es entstünde eine sechstaktige Form, die zwar für das
heutige Musikempfindenungewöhnlich wäre, aber dennoch nicht als
freirhythmischgelten könnte, auch nicht der vorletzte Takt, der dann als Hemiole aufzufassen wäre. Vergegenwärtigt man sich ferner die durch alte und neue Schallplatten bekannte Ausführungsweise solcher Büchelgsätzli durch Büchelbläser und Juuzer, die schwerlich erkennen läßt, ob es sich um eine binäre oder eine ternäre metrische Basis handelt, dann wird auch ein Sechstakter im 3/4-Takt denkbar. Auch die von Leuthold angeführten Notenbeispiele ließen, wie später gezeigt wird, konventionelle metrische Deutungen durchaus zu. Ungewöhnlich ist an Notenbeispiel 16 b) wohl hauptsächlich, daß es sich nicht auf die dem
heutigen Musikempfindenentsprechende achttaktige Form bringen läßt.
Heute findet man nur noch Büchelgsätzli der ersten Art [a]. Die zweite [b] ist auf dem Büchel fast und im Juuz ganz ausgestorben. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Melodien dieser Art klingen in unseren Ohren nicht schön. Eher verdreht, und man hat das Gefühl, daß willkürlich Töne aneinandergereiht werden. Der Melodieverlauf ist nicht vorauszusehen und es ist schwierig der Melodie zu folgen, weil keine Eckpunkte da sind. Sie [..; hat keinen Schluß nach acht Takten. Sie beginnt und endet irgendwann. Diese eigene Art des Juuzens diente vornehmlich als Lockruf oder Treibgesang(Betschart 1981: 17). 69
Der letzte Satz deckt sich mit meiner Erfahrung, daß es gerade bei den Chueraiheli am schwierigsten, ja unmöglich ist, ein Metrum hineinzuhören.
Die theoretische Prämisse, daß eine Tonfolge ohne irgendeine metrische Strukturierung gar nicht memorierbar ist und daß demnach der Eindruck des Freirhythmischen
nur für den Hörer, nicht für den Juuzer selbst besteht, führt zur Forderung, nach dem Metrum auch dort zu fragen, wo dem äußeren Anschein nach keines vorhanden ist.
Den historischen Prozeß des Verschwindens beobachtet Betschart auch beim 2. Typus (Jüüzli mit eigenwilliger Melodik): Viele Jüüzli dieser Art sind in den letzten Jahren untergegangen. Sie waren zu kompliziert oder paßten nicht mehr zu unserem Empfinden. Die Kriterien der Auswahl haben sich eindeutig zugunsten des Holiouri-Typs verändert.
(Betschart 1981: 17 f.).
Im Kapitel Tradierung
kommt Betschart nochmals auf den Wandel des Musikempfindens
(Betschart 1981: 19) zu sprechen und vermutet, daß Typ 2 früher auch in Schwyz zu finden gewesen sei, sich dort aber schneller verflüchtigt habe und heute nur noch im Muotatal anzutreffen sei. Die These vom Muotatal als Rückzugsgebiet vertreten auch Leuthold (Leuthold 1981) und Sichardt (Sichardt 1939), auf deren Spekulation, es handle sich um eine vorgregorianische Stilschicht
, läßt sich der Empiriker Betschart freilich nicht ein. Zemp stellt der Rückzugsgebiet-Hypothese vorsichtig eine Isolations-Hypothese gegenüber: Das Muotatal ist lange relativ isoliert geblieben, was zur Folge hatte
– wie man sagt –, dass die Einheimischen (heute etwa 3000 Personen) im Laufe der Jahrhunderte einen eigenwilligen Volksschlag gebildet haben und gegen Auswärtige anfangs misstrauisch sind. Diese Isolierung hat wahrscheinlich das Entwickeln und Erhalten eines in der Schweiz ganz einzigartigen Musikstiles gefördert (Forschungen in den Nachbargebieten des Muotatales müssen noch ausgeführt werden).
(Zemp 1990). Damit sind allerdings Forschungsfragen angesprochen, die im bescheidenen Rahmen meiner Arbeit nur am Rande berührt werden können. Als zentral wird sich hingegen die Frage erweisen, welche musikalischen Eigenschaften dieser Typ 2
aufweist, die Frage nach einem Muotataler Jodeltonsatz
, ohne den das Problem des Metrums wahrscheinlich nicht zu lösen sein wird. Leider gibt Betschart für den Typ 2
kein Notenbeispiel. Einen Anhaltspunkt dafür, welche Melodien er meint, gibt allerdings sein Hinweis auf die schon von Sichardt erwähnte Zick-Zack
-Melodik (Sichardt 1939: 130): die Melodie springt hin und her
(Betschart 1981: 17).
Noch an einer dritten Stelle kommt Betschart kurz auf das Metrum zu sprechen und zwar im Zusammenhang mit dem Funktionswandel des Jodels: Zum Wandel gehört auch eine Verschiebung vom einfachen zum gebildeten Naturjuuzer.
Der Juuzer [...] hat nicht mehr die gleiche Jodelsprache [Jodelsilben]
[...] Meistens wird dadurch auch die Melodik des Juuzes geändert. Es entstehen plötzlich koloraturähnliche Gebilde, genaue Metrik wird spürbar
(Betschart 1981: B).
Darf dieser Satz als Hinweis auf Rubatostil im traditionellen Muotataler Juuz gedeutet werden? Oder referiert Betschart in diesem den Naturjuuz
allgemein betreffenden Kapitel lediglich die Auffassung Max Peter Baumanns, daß nach unserer Auffassung der nicht stilisierte, freie Jodel in den meisten Fällen in keinen Takt eingepaßt werden kann
(Baumann 1976: 160)? Mit der Frage, ob es im Muotataler Jodel einen Rubatostil gibt, wird sich meine Arbeit jedenfalls auseinandersetzen müssen allein schon wegen der einander widersprechenden Aussagen Sichardts und Leutholds.
71
Franz Födermayr
Es mag verfehlt erscheinen, in einem Kapitel über die Deutungsgeschichte des Muotataler Jodelmetrums die StudieAnalytische Grundlagen zu einer Typologie des Jodelns(Födermayr und Deutsch 1994) anzuführen. Ist doch die in dieser systematisch-musikwissenschaftlichen Arbeit enthaltene Jüüzlitranskription Franz Födermayrs durch einen konsequenten Verzicht auf metrische Deutung gekennzeichnet. (Siehe Notenbeispiel 17). In dieser Studie, in der je ein Beispiel aus dem Bereich der tribalen Musik, der europäischen Volksmusik und der Popularmusik
hinsichtlich jener Momente untersucht [werden] die für eine Typologie des Jodelns in Frage kommen: Häufigkeitsverhältnis von Brust‐ und Falsettönen, Qualität des Falsettregisters, Art des Registerwechsels, Jodelsilben, Melodiekontur(Födermayr & Deutsch: 255) steht das Metrum gar nicht zur Diskussion. Folgerichtig intendiert die Transkription nicht die Wiedergabe eines metrischen Verständnisses oder die Aufstellung einer metrischen Hypothese, sondern sie nähert die spektrographisch gemessenen Tondauerverhältnisse via Klassenbildung mithilfe der Zeichen unserer Notenschrift an. Sie ist eine phonetische, keine phonemische Transkription. Sie zeigt nicht an und will auch gar nicht anzeigen, wie diese Dauerverhältnisse metrisch zurechtgedeutet und verstanden werden können.
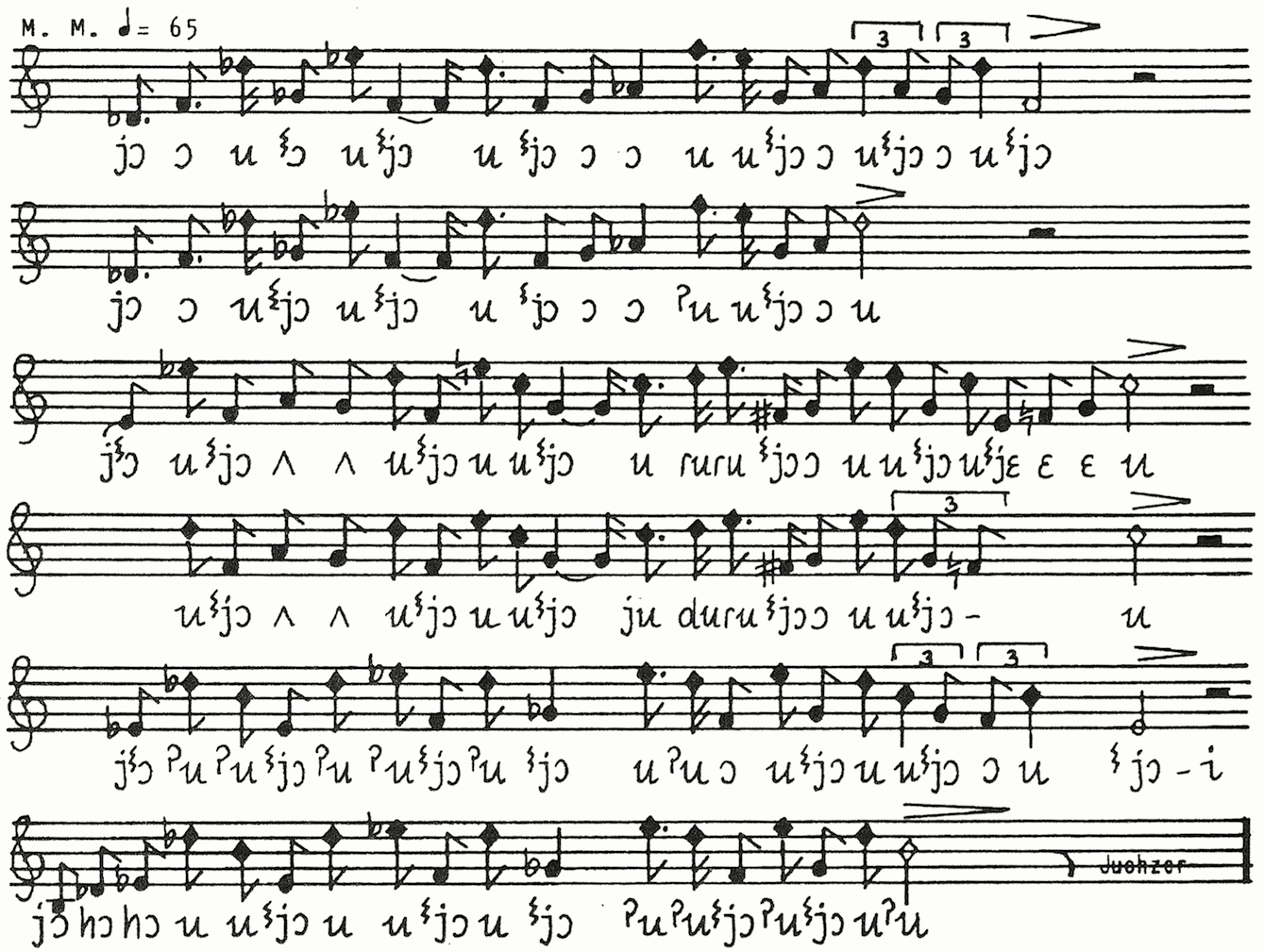
Vo dr Aige Flue,gejuuzt von Emmi Suter﹘Gwerder (Zemp 1979/1990: 3a), Transkription: F. Födermayr 1994: 264. Falsettöne werden durch rhombenförmige Notenköpfe dargestellt.
Es erübrigt sich zu sagen, daß F. Födermayr auch im Text keine Hypothesen über das Muotataler Jodelmetrum aufstellt. Der Gründe, weshalb auf diese Studie an dieser Stelle eingegangen wird, sind zweierlei:
Erstens zeigt Födermayrs Notation eindringlich, daß eine sich der metrischen Deutung enthalten wollende Transkription konsequenter Weise auf die Gruppierung der Noten mittels Balken verzichten muß, (es sei denn sie wiese dem Balken per definitionem eine andere als eine metrische Bedeutung zu, z. B. legato
). Indem sie die Tonfolge und die Tondauerverhältnisse mit hinreichender Annäherung überblickbar macht, ohne irgendwelche Elemente metrischer Deutung bereits vorzugeben, ist die phonetische Notation eine geeignete Ausgangsbasis für die Diskussion metrischer Auffassungen und Deutungsmöglichkeiten. Das Problem bei der Herstellung solcher Transkriptionen ist neben der Frage des Tonbeginns die sinnvolle Klassierung der Tondauern, darauf soll im spektrographischen Kapitel eingegangen werden. Grundsätzlich kann jede Jodeltranskription durch Weglassen der Taktstriche und Balken auf eine phonetische Form gebracht werden, so sie nicht als Rubato gedeutete, aber als solches nicht ausgewiesene und genauer beschriebene Dauern unterschlägt.
Ob diese Methode bei den Muotataler Jodeltranskriptionen Sichardts und Leutholds gangbar ist, hängt primär davon ab, ob der Muotataler Interpretationsstil ein Rubatostil ist.
Zweitens ist der Aufsatz von F. Födermayr und W. A. Deutsch für die vorliegende Arbeit eine wichtige Grundlage vor allem deshalb, weil er eine Untersuchung der Materialleiter des in Notenbeispiel 17 wiedergegebenen Jodels beinhaltet. Auf sie wird im zweiten Teil in Zusammenhang mit der Untersuchung des Muotataler Jodeltonsatzes eingegangen werden. In Zeile 5 und 6 des Notenbeispiels ist übrigens ersichtlich, daß auch die Tonhöhen phonetisch
notiert sind: Bei einer phonemischen
, d.h. tonalen Deutung wäre das h als ces zu schreiben.
Metrum und Rhythmus: ein theoretischer und methodischer Ansatz
Es kann nicht das Ziel dieser Arbeit sein, einen theoretischen Beitrag zur Rhythmusforschung zu leisten und noch weniger, einen neuen Metrumbegriff zu entwickeln.Versuchen Rhythmus-Metren-Definitionen zu verfassen war kein großer Erfolg beschieden, faßt Oskar Elschek (Elschek 1990: 23) das Ergebnis der in diese Richtung gehenden Bemühungen zusammen. Es ist jedoch notwendig, für meine Arbeit den Begriff des Metrums zu präzisieren und daher soll eine problemorientierte Arbeitsdefinition gegeben werden. Dienlich erscheint zu diesem Zweck die von Franz Födermayr formulierte Arbeitsdefinition (Födermayr 1990: 223 f.). Sie fußt auf zwei Voraussetzungen, einer theoretischen und einer empirischen. Die theoretische Grundlage ist die der schwedischen Rhythmusforschung, die
musikalischen Rhythmus als einedefiniert (Födermayr 1990: 223; vgl. Gabrielsson 1981: 27). Dazu tritt die musikalische Erfahrung solcher Fälle, in denenresponsedes Hörers auf bestimmte Schallfolgen
eine musikalische Impulsfolge vor dem gleichbleibenden Hintergrund einer real erklingenden oder bloß gedachten bzw. gefühlten zweiten Impulsfolge abläuft(Födermayr 1990: 223), in denen also die
Rhythmusresponse(RR) des Hörers zwei unterscheidbare, aufeinander bezogene Ebenen aufweist.
Ich möchte solche als Bezugs‐ oder Regulierungskonfigurationen dienenden Impulsfolgen als Metren bezeichnen und die vor diesem Hintergrund ablaufenden speziellen musikalischen Impulsfolgen als rhythmische Figuren oder Rhythmen. Die durch eine bestimmte Betonung gegliederte, vier Einheiten umfassende Impulsfolge z. B., die wir 4/4 Takt nennen, wäre also ein Metrum und die vor diesem tatsächlich erklingenden oder bloß vorgestellten bzw. gefühlten Hintergrund ablaufenden Impulsfolgen, die als aus der Division bzw. Multiplikation der Zählzeit entstanden aufgefaßt werden können, wären Rhythmen oder rhythmische Figuren.(Födermayr 1990: 223 f.). Der Gültigkeits‐ und Anwendungsbereich dieser Definition beschränkt sich ausdrücklich auf solche Musik, die die oben zitierte empirische Voraussetzung erfüllt:
Von Metren unterscheiden möchte ich jene sowohl quantitative wie qualitative Aspekte enthaltenden Impulsfolgen, wie wir sie etwa aus der nahöstlichen oder indischen Musik als distinkte Schlagmuster der Trommeln kennen. Diese möchte ich als rhythmische Modi bezeichnen, weil sie [...] über die bloße Bezugs‐ oder Regulierungsfunktion hinausgehen. Der Terminus Rhythmus könnte dann die generelle Bezeichnung für die Gestaltung der Zeitachse in der Musik abgeben.(Födermayr 1990: 224). Dieser anders gelagerte Fall trifft, wie die folgenden Untersuchungen zeigen werden, auf den Muotataler Jodel nicht zu, es gibt keine
rhythmischen Modiim Muotataler Jodel. 74
Franz Födermayrs Metrumdefinition erweist sich in mehrerlei Hinsicht als zu denjenigen Problemen passend, die bei der Erforschung des Jodelmetrums begegnen:
Erstens läßt der Begriff Impulskonfiguration
in seiner Allgemeinheit offen, um welche spezielle Art von Impulsen es sich jeweils handelt und nach welchen Prinzipien solche Konfigurationen aufgebaut sind. So kann die Jodelforschung z. B. untersuchen, ob das Muotataler Jodelmetrum der Riemannschen Metrumkonzeption entspricht oder einer anderen.
Zweitens fordert das Verständnis des Metrums als response des Hörers
Untersuchungen heraus, die über eine bloße musikalische Formanalyse oder eine physikalische Schallanalyse hinausgehen: Wie fassen Muotataler Juuzer ihre Jüüz' metrisch auf und wie die Forscher? Gibt es auch bei den Juuzern, so wie bei den Forschern, metrische Auffassungsunterschiede? Auch der Juuzer ist ja ein Hörer, insbesondere hat er seine Jodelmelodien irgendwann erworben und sie dabei als Hörender und Nachvollziehender metrisch gedeutet. Bei diesem Überlieferungsprozeß spielte vielleicht auch die visuelle Komponente eine Rolle. Die metrische Deutung des Hörers wird auch durch die Körperbewegungen des Ausführenden beeinflußt, es macht z. B. einen Unterschied, ob die Körperbewegung des Ausführenden ein binäres oder ein ternäres Metrum ausdrückt.
Daher wäre die von der Musikpsychologie übernommene theoretische Grundlage für musikethnologische Zwecke zu erweitern und musikalischer Rhythmus und Metrum als response nicht nur auf Akustisches, sondern auch auf das mit dem Akustischen verbundene optische und Taktile zu definieren. Gerade als Forschungsmethode spielt die Analyse von Bewegungsabläufen eine wichtige Rolle (Kubik 1973: 171﹣188). Die Metrumresponse selbst kann wiederum auf verschiedenen Ebenen beobachtbar sein: auf akustischer, taktiler oder visueller.
Der letztere Fall ist nicht nur bei Körperbewegungen gegeben, sondern auch beim Lesen einer Transkription. Taktangaben, Taktstriche und Balken sind ebenso als Metrumresponse
zu werten wie das Mitklatschen, Mitschunkeln oder Mitwippen, sofern diese Zeichen, Laute und Bewegungen zu den rhythmischen Figuren den definitionsgemäßen gleichbleibenden Hintergrund
bilden.
Drittens kann diese Metrumresponse auch in einer bloß gedachten bzw. gefühlten
Impulsfolge bestehen, wie das beim Jodelmetrum meist der Fall ist. Der Musikforschung erwächst damit die Aufgabe, Befragungsmethoden zu entwickeln, die es dem Informanten ermöglichen, das von ihm gefühlte und für den wissenschaftlichen Beobachter bislang ungreifbare Metrum in beobachtbarer und beschreibbarer Form darzustellen. Eine Möglichkeit ist die, die Informanten zu bitten,
75
beim Jodeln den Takt zu klopfen
. Davon soll im zweiten Teil im Feldforschungsbericht die Rede sein. Die Unhörbarkeit und Unsichtbarkeit eines bloß vorgestellten
Metrums dürfte der Grund dafür sein, daß verschiedene Aufzeichner zu verschiedenen Auffassungen über das Muotataler Jodelmetrum gelangten.
Die metrischen Auffassungen der Ausführenden und der Aufzeichner zu eruieren und zu vergleichen ist allerdings nur ein erster Schritt, an den weitere Fragestellungen anschließen: Welche physikalischen Eigenschaften der Schallfolge korrelieren mit welchen metrischen Auffassungen und Deutungen? An welchen Eigenschaften der Klangfolge orientieren sich die Muotataler Juuzer, an welchen die Aufzeichner, wenn sie einen Jodel metrisch deuten? Diese Frage nach den Deutungsmustern ist eng mit der Frage nach dem Jodeltonsatz
verbunden, der Frage nach den melodischen und harmonischen Schemata und ihrer Verknüpfung mit Metrum und Rhythmus. Ein weiterer Fragenkomplex betrifft den historischen Wandel. Die Geschichte der wissenschaftlichen Auffassungen über das Muotataler Jodelmetrum beginnt bei Gaßmann mit gewöhnlichen acht‐ und sechzehntaktigen Schemata, setzt sich bei Sichardt fort mit irregulären Taktwechseln und geht weiter bei Leuthold mit einer gänzlichen oder fast gänzlichen Metrumlosigkeit.
Man könnte sie beschreiben als Geschichte der fortschreitenden Auflösung des Muotataler Jodelmetrums. Entspricht dieser Geschichte irgendeine Muotataler Realität? Oder geht die Entwicklung, wie Betschart anzudeuten scheint, gerade in die umgekehrte Richtung? Gibt es Jodelmelodien, die im Laufe von Überlieferungsprozessen metrisch umgedeutet wurden und weisen solche Umdeutungen eine gemeinsame Tendenz auf, etwa die eines Metrumverlustes oder einer Umwandlung von ternären in binäre Ordnungen etc.? Gibt es eine Zunahme von Rubatointerpretation? Gerade weil das Jodelmetrum nicht wie bei Tanzmusik tatsächlich erklingt
, sondern bloß vorgestellt
ist, ist mit metrischen Umdeutungen im Überlieferungsprozeß zu rechnen. Der Muotataler, der sich eine Jodelmelodie aneignet, ist in einer ähnlichen Lage wie der wissenschaftliche Aufzeichner: Beide hören eine Tonfolge, die kein tatsächlich erklingendes Metrum enthält, beide konstruieren ein Metrum, indem sie intuitiv bestimmte Eigenschaften der Tonfolge als Indizien, als Anhaltspunkte nehmen. Der Muotataler Juuzer hat dem wissenschaftlichen Beobachter lediglich eine größere Repertoire‐ und Stilkenntnis voraus. Abstrakter formuliert: Der Jodler hat andere Deutungsmuster als der wissenschaftliche Beobachter, weil seine musikalische Sozialisation in einer anderen musikalischen Umwelt stattfand. Der Jodelforscher muß daher, um brauchbare Hypothesen über die Deutungsmuster bilden zu können, diese musikalische Umwelt erforschen und zwar alle Bereiche dieser Umwelt und nicht bloß den Jodel, den Tierlockruf, das Lied und vielleicht noch
76
die Holztrompetenmusik. Ein wesentlicher Teil, nämlich die Tanz‐ und Unterhaltungsmusik, interessierte die Jodelforschung bisher nur am Rande, nämlich bei Jodelmelodien, deren Ähnlichkeit mit Tanzmusik unüberhörbar war. Subtilere, weniger handgreifliche Zusammenhänge zwischen Jodel und Tanzmusik wurden nicht gesucht und daher auch nicht gefunden. Weiters wird eine Jodelforschung, die den hier skizzierten Ansatz verfolgt, ihre metrischen Hypothesen nicht allein auf Intuitionen aufbauen, sondern diese stilkritisch hinterfragen.
Die Anwendung des Födermayrschen Metrumkonzepts in der alpenländischen Jodelforschung hat also weitreichende methodische Konsequenzen. Sie wirft allerdings auch theoretische Probleme auf. Zunächst erhebt sich die Frage, wie der Begriff gleichbleibender Hintergrund
zu verstehen ist. Intuitiv ist klar, daß ohne etwas Gleichbleibendes
in einer Impulsfolge schwerlich von einem Metrum gesprochen werden kann. Ich möchte den Begriff des Gleichbleibenden sehr streng auffassen und unter Metrum die gleichmäßige Wiederholung eines Impulses oder einer Impulskonfiguration verstehen. Gleichmäßig heißt in gleichen Zeitabständen, wobei die Zeit auf der phonemischen
Ebene gemeint ist, die Möglichkeit der Verlangsamung und Beschleunigung des Tempos (ritardando, accelerando, rubato) somit inbegriffen ist. Der Minimalfall eines Metrums ist die gleichmäßige Wiederholung eines Impulses: ・・・・・・・・・ mit gleichstarker Betonung. Die mathematisch einfachste Gliederung ist die binäre ・'・'・'・'・', die ternäre kann nach den Betonungsverhältnissen klassifiziert werden in 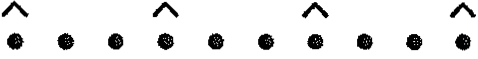 ,
, 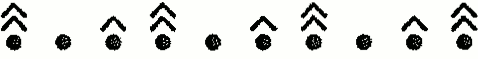 und
und  . Das mathematisch einfachere muß nicht unbedingt das psychologisch einfachere sein (Leibold 1936). Binäre und ternäre Gruppen sind meist durch weitere Betonungsabstufung zu Takten organisiert und bilden so die bekannten
. Das mathematisch einfachere muß nicht unbedingt das psychologisch einfachere sein (Leibold 1936). Binäre und ternäre Gruppen sind meist durch weitere Betonungsabstufung zu Takten organisiert und bilden so die bekannten additiven
und divisiven
Metren. Takte können wiederum zu Großtakten organisiert sein. Beim unregelmäßigen Taktwechsel bilden die Taktbeginne, die Schwerstzeiten, keine metrische Ordnung, sondern eine rhythmische Figur vor dem Hintergrund eines gleichmäßig durchlaufenden Pulses: ・・・・・・・・・.
Die Differenzierung Metrum/Rhythmus stellt ein wahrnehmungspsychologisches Problem, das man mit der bekannten Frage vergleichen könnte, ob zuerst die Henne oder zuerst das Ei da ist. Man könnte geneigt sein, das metrische Verstehen als einen Prozeß zu beschreiben, in dem zuerst Rhythmen erkannt werden, die hernach metrisch gedeutet werden. Eine solche Beschreibung zielte auf die Erfahrung, daß es Musik gibt, bei der die Betonungsverhältnisse, d.h. die Konfiguration der Schwer‐ und Leichtzeiten und damit der Takt, latent sind und erst aus den Rhythmen erschlossen werden müssen. Ein Beispiel wäre der Rhythmus des letzten Segmente von Notenbeispiel 17: , der bei der Anwendung der Regel der möglichst synkopenarmen Deutung die zwei Lösungen und zuläßt, während 77 alle anderen Möglichkeiten der binären und ternären Achtelgruppierung ausgeschlossen werden. (Welche Regeln für die metrische Deutung der Muotataler Jüüzli nun tatsächlich brauchbar sind, muß freilich erst gezeigt werden, es geht hier nur um ein Beispiel für die metrische Deutung einer rhythmischen Figur). Der Einwand nicht gegen diese Methode, aber gegen die Auffassung, beim Verstehen eines Jodels sei der Rhythmus dem Metrum vorgängig, besteht in dem Hinweis darauf, daß die notierte rhythmische Figur selbst bereits das Produkt einer Deutung ist (und zwar jener, die den irrationalen Tondauerverhältnissen der musikalischen Wirklichkeit ganzzahlige, niedrigzahlige Proportionen zuordnet, im obigen Beispiel 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:2:3/2:1/2:1:1:1:1:4) und daß bei dieser Deutung ein Metrum als Bezugskonfiguration verwendet wird. Im übernächsten Kapitel wird an einem Fallbeispiel gezeigt, daß sich diese Deutung mathematisch nicht durch die bloße Klassierung der Tondauern simulieren läßt, Sondern nur mithilfe der Passung eines metrischen Gitters. Erst vor dem Hintergrund eines Metrums wird eine Folge von Tondauern bzw. von Tonbeginnimpulsen als Rhythmus verständlich. Die rhythmisch-metrische Deutung eines Jodels stellte sich demnach als stufenförmiger Prozeß dar, in dem der Hörer zuerst in den auditiven Impulsen Regelmäßigkeiten wahrnimmt, daraus einen durchlaufenden Puls (noch ohne Betonungsverhältnisse) konstruiert, sodann vor diesem Hintergrund eine rhythmische Figur erkennt, von dieser wiederum auf die grundlegenden Betonungsverhältnisse (binäre oder ternäre metrische Basis) schließt, wonach großräumigere rhythmische Strukturen (z. B. Harmoniewechsel) genau erkennbar werden, die wiederum auf die höhere Organisation des Metrums (Takte, Großtakte) schließen lassen.
Diese Darstellung der gegenseitigen Erhellung von Metrischem und Rhythmischem als schöne Stufenfolge mag zwar in Einzelfällen zutreffen, als allgemeingültiges Gesetz formuliert wäre sie jedoch kritisierbar. Ein erster, theoretischer Einwand lautete, daß weder die Vorgängigkeit des Metrischen noch die Stufenfolge des Verstehens aus Födermayrs Definition ableitbar ist, weil das gestaltpsychologische Konzept von Figur und Hintergrund
, auf dem sie basiert, ein holistisches Konzept ist, das weder eine Priorität des Hintergrundes noch der Figur zuläßt und über die Reihenfolge einzelner Schritte des Gestalterkennungsprozesses nichts aussagt. Ein zweiter, praktischer Einwand wäre, daß mein eigener Verstehensprozeß sich nicht an die oben skizzierte Stufenfolge hält, zumindest nicht in denjenigen Fällen, in denen er der Selbstbeobachtung zugänglich ist. Das sind natürlich die Fälle, in denen das Verstehen auf Schwierigkeiten stößt. Bei manchen Jüüzli konnte ich die Takt
78
beginne sofort an den regelmäßigen Harmoniewechseln erkennen, nicht jedoch die Binnenstruktur der Takte (3/4 oder 6/8 ?). Meist geht das Gestalterkennen jedoch so rasch vor sich, daß ich die dabei ablaufenden Prozesse nicht beobachten konnte. Ein solcher Fall ist das Schlußritardando: Die bloß gedachte bzw. gefühlte
Impulsfolge des Metrums wird vom Hörer verlangsamt, andernfalls entstünde eine Synkope an ungewöhnlicher Stelle und eine Finalis auf leichterer Zeit, kurz: eine unplausible, stilfremde Form; es liegt die Annahme nahe, daß hier höhere
Ebenen der skizzierten Stufenfolge auf die unterste zurückwirken. Von einer Stufenfolge, einer Konstruktion der rhythmisch-metrischen Gestalt in aufeinander aufbauenden Schritten, kann dann natürlich nicht mehr die Rede sein. Das musikalische Verstehen ist dann wohl eher als ein Prozeß zu denken, in dem auf die gehörte Klangfolge Deutungsmuster, Formschemata gepaßt werden, die selbst bereits komplexere (rhythmisch-metrisch-melodisch-harmonische) Ganzheiten darstellen. Diese Passung mag urplötzlich einrasten und die ganze Klangfolge auf einmal erfassen. Oder sie mag an einer Stelle beginnen und sukzessive auf die ganze Klangfolge ausgedehnt werden, dabei können auf die Zukunft des noch zu Erklingenden gerichtete Erwartungen auftreten, aber auch an eine nachträgliche Deutung des schon Erklungenen und im Gedächtnis Haftenden ist zu denken. Es können einzelne Stellen der Klangfolge dem applizierten Deutungsmuster widerstreben, es können sogar miteinander unvereinbare Deutungsmuster, die jede mehr oder minder gut auf die Klangfolge passen, miteinander konkurrieren.
Wahrnehmungspsychologische Überlegungen sind deswegen wichtig, weil ein Gutteil der vorliegenden Arbeit in Hypothesenbildungen besteht und diese umso glaubhafter erscheinen, je besser ihre Konstruktion dem tatsächlichen Gestaltwahrnehmungsprozeß entspricht. Die oben skizzierten zwei Gestaltwahrnehmungsmodelle haben methodologische Konsequenz. Dem Stufenmodell entspricht eine bottom-up-Konstruktion, dem holistischen Modell eine top-down-Konstruktion der Hypothesen. Die bottom-up-Methode benötigt ein set von Regeln, die top-down-Methode ein set von Formschemata. Zwar ist mit der Entscheidung für die Metrumdefinition Franz Födermayrs und auf Grund der geschilderten Beobachtungen und Vermutungen die Entscheidung bereits zugunsten des gestaltpsychologischen Holismus und der top-down-Konstruktion gefallen. Doch möchte ich in manchen Fällen ergänzend den einen oder anderen Konstruktionsschritt des bottom-up-Modells verwenden. Daher will ich beide Methoden näher erläutern. Zuvor möchte ich jedoch auf die Grundlagen eingehen, nämlich auf die von der schwedischen Rhythmusforschung übernommene Konzeption.
79Die schwedische Rhythmusforschung unterscheidet Rhythmus
auf drei Ebenen: Rhythmus, wie er in der Notation zum Ausdruck kommt, Rhythmus als Folge von Schallereignissen auf der physikalischen Ebene und Rhythmus als Reaktion (response) des Hörers auf Schallfolgen auf der psychischen Ebene (Bengtsson 1977; Bengtsson & Gabrielsson 1983). Ich möchte auf der physikalischen Ebene lediglich von Schallereignissen und Schallfolgen sprechen und den Terminus Rhythmus für die psychische und die notenschriftliche Ebene reservieren. Weiters legt es Födermayrs Konzeption nahe, im psychischen Bereich zwei Ebenen zu unterscheiden: 1. die uninterpretierte Impulsfolge und 2. die rhythmisch-metrische Gestalt. Man könnte die erste die phonetische und die zweite die phonemische Ebene bezeichnen. Zwischen beiden liegt die Mustererkennung, der Verstehensprozeß. (Das Stufenmodell der Wahrnehmung schiebt dazwischen noch mehrere weitere Ebenen ein). Diese Adaption des schwedischen Konzepts im Sinne der kognitiven Psychologie (Anderson 1989) soll ausführlicher dargestellt werden.
Unter Impuls verstehe ich ganz allgemein die plötzliche Veränderung einer Größe, sei es der Lautstärke, der Tonhöhe, der Klangfarbe. Plötzliche Veränderungen physikalischer Schallparameter werden bei Überschreitung der bekannten psychoakustischen Schwellenwerte wahrgenommen und bewirken psychische Impulse. Von diesen anfänglich uninterpretierten Impulsen werden die rhythmisch-metrisch relevanten ausgewählt und im rhythmisch-metrischen Verstehensprozeß weiterverarbeitet. Im Muotataler Jodel z. B. sind es vor allem die Tonbeginne, die rhythmisch-metrisch relevant sind, wobei im übernächsten Kapitel noch genauer zu spezifizieren sein wird, was hier unter Tonbeginn zu verstehen ist; als irrelevant wird sich hingegen die Verwendung verschiedener Konsonanten in den Jodelsilben erweisen. In der heutigen Muotataler Tanzmusik stellen Lautstärkeimpulse und Tonbeginne im Baßbereich das Metrum dar. In ein‐ und zweistimmigen Jüüzli wird das Metrum nicht explizit dargestellt, sondern erst im Deutungsprozeß erschlossen, wobei es – zumindest auf wissenschaftlicher Seite – zu erstaunlich divergenten Lösungen kommt.
Außer den direkt mit der physikalischen Ebene des Schalls in Beziehung stehenden auditiven Impulsen gibt es Impulse, die bereits selbst ein Deutungsprodukt sind. Um solche handelt es sich z. B. beim Wechsel des als führend
empfundenen Tones im Melodieverlauf sowie bei den in eine einstimmige Melodie hineininterpretierten Harmoniewechseln. Die latente Harmonik kann metrisch ebenso relevant sein wie die manifeste einer akkordischen Begleitung oder eines Baßverlaufes. Voraussetzung für die Möglichkeit metrischer Relevanz ist lediglich, daß die Wechsel ausreichend regelmäßig erfolgen. Da die führenden Melodietöne
80
und – außer im Satz Note gegen Note
– auch die Harmonien nicht so oft wechseln wie die Töne, können sie als Anhaltspunkte für die Betonungsverhältnisse des Metrums fungieren. Das gilt für die Lamellophonmusik in Zimbabwe genauso wie für den alpenländischen Jodel, so sehr sich Melodiebildung und Harmonik in den beiden Musikkulturen auch unterscheiden. Wenn es, wie H. J. Leuthold behauptet, ein Muotataler Jodelmelos gibt, das immer nur linear melodisch, nie harmonisch empfunden
ist (Leuthold 1981: 100), dann entfällt eine das Metrum strukturierende Komponente und es stellte sich die Frage, ob dafür ein funktionales Äquivalent vorhanden ist oder ob diesem Melos tatsächlich jedes Metrum fehlt
(Leuthold 1981: 58). Ein solches funktionales Äquivalent könnten die im melodischen Verlauf als führend empfundenen Töne sein. Ich möchte weiter unten ein Beispiel für eine darauf basierende metrische Deutung geben.
Wichtig ist in dieser Konzeption, daß der Begriff des Impulses allgemeiner gefaßt und nicht auf den Lautstärkeimpuls allein beschränkt wird. Jeder Beginn von etwas Neuem ist ein Impuls, sei es der Beginn des nächsten Tones, eines Vibrato oder einer bloß vorgestellten Harmonie. Es gibt stärkere und schwächere Impulse, wobei die seltener sich verändernden Größen im allgemeinen stärkere Impulse zu bewirken imstande sind, besonders, wenn die kurzfristigeren Details als von diesen Größen abhängig begriffen werden.
All die metrisch relevanten, stärkeren und schwächeren Impulse bilden eine Impulsfolge, an die im metrisch-rhythmischen Deutungsprozeß ein Metrum angepaßt wird, indem so weit wie möglich die stärkeren Impulse mit schwereren, die schwächeren mit leichteren metrischen Zeiten zur Deckung gebracht und identifiziert werden, wobei im Fall von Tempoänderungen und Rubati diese metrische Decke nach Bedarf gedehnt und gestaucht wird, – so könnte man sich nach einem modifizierten Stufenmodell die Funktionsweise der metrisch-rhythmischen Deutung vorstellen. Auch dieses Modell ist kritisierbar: An welcher Stelle eine latente Harmonie von der nächsten, ein führender Ton vom nächsten abgelöst wird, ist unter anderem von dem unterstellten Metrum abhängig. Zeitpunkt und Stärke des Impulses sind selbst von dem Metrum mitbestimmt, für dessen Konstruktion sie die feste Basis abgeben sollten. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz. An Hand eines Jodels von Marie Ablondi, transkribiert durch Wolfgang Sichardt (Notenbeispiel 18), soll diese gegenseitige Abhängigkeit und die dadurch ermöglichte metrische Mehrdeutigkeit aufgezeigt werden. Aus Sichardts Beitext seien die in diesem Zusammenhang wichtigen Stellen zitiert: Dur-Jodler, harmonikale Melodik, jedoch mit linearen Einschlägen. Barocktyp. [...] Gemessene Melodiebewegung, tonräumlich wie
81
rhythmisch. [...] Pointierter Taktwechsel, typische
(Sichardt 1939: 15 f.). Dem ist zu entnehmen, daß sowohl melodische als auch neuzeit
Muotatal-Rhythmik
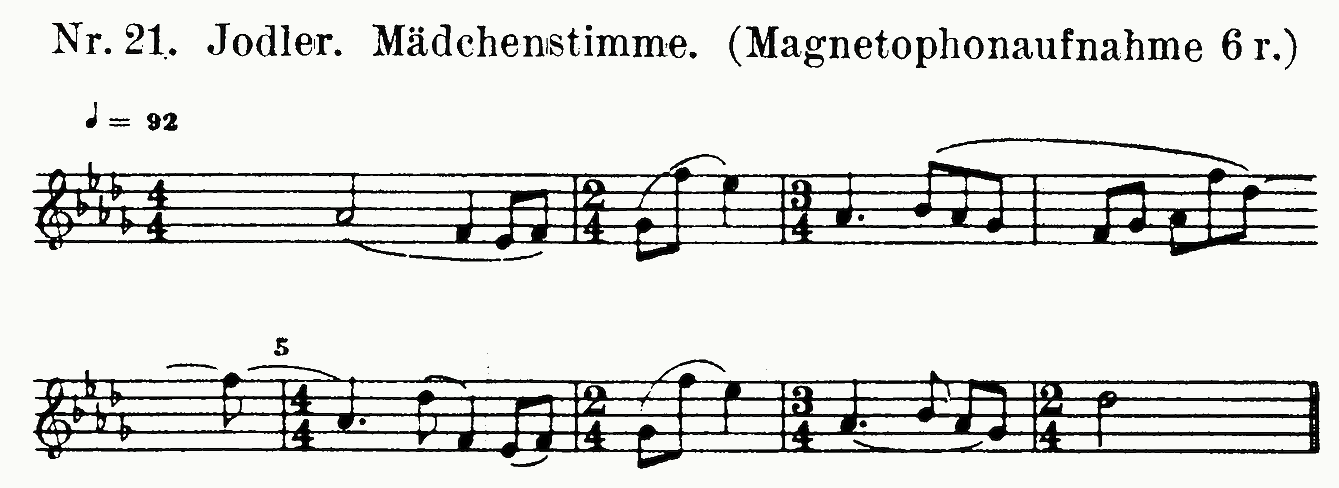


82
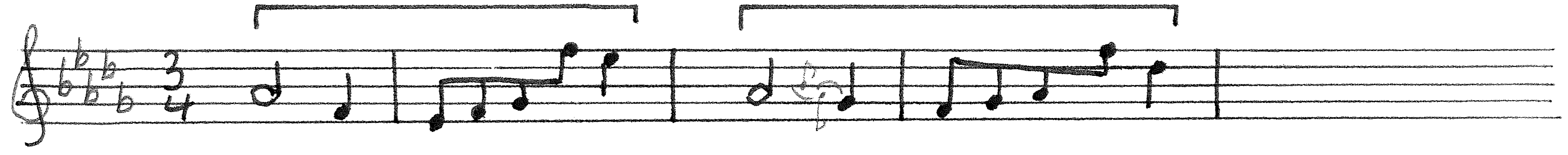
Augenmusik, die es freilich in der oral tradierten Musik kaum geben kann. Doch geht es mir an dieser Stelle noch nicht um eine Widerlegung der Sichardtschen Deutung, sondern um das Aufzeigen einer Mehrdeutigkeit, die dadurch ermöglicht wird, daß bei der Unterstellung anderer Betonungsverhältnisse auch die melodischen Bezüge und die harmonischen Fortschreitungen sich ändern und zwar dergestalt, daß sie genau die unterstellten Betonungsverhältnisse bestätigen. Dieses feed back kann wie folgt veranschaulicht werden:
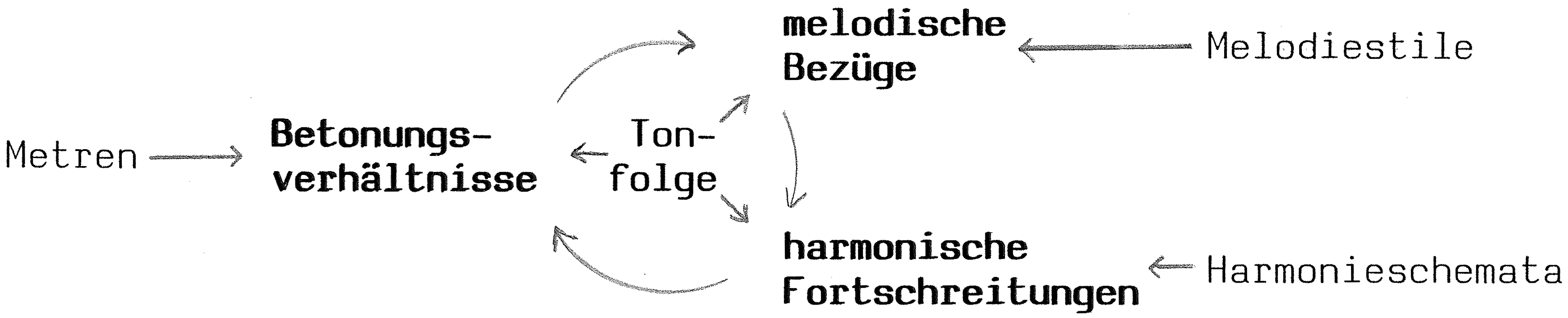
Barocktyp,
neuzeitliche Harmonik,
musica alpina) und von universalen Gestaltgesetzen (wie z. B. dem Gesetz der Nähe: Sekundbeziehungen; dem Gesetz der Ähnlichkeit: motivische Entsprechungen). Letztere sind im Modell nicht eingezeichnet.
In der im feed-back-Modell beschrieben Situation befindet sich der Hörer, der nur einstimmige Jüüzli-Interpretationen kennt. Bei den zwei‐ und dreistimmigen Interpretationen sind die harmonischen Fortschreitungen manifester und damit ist die Mehrdeutigkeit geringer. Das Modell macht den Forschungsansatz deutlich: Es gilt zu eruieren, welche Deutungsmuster im musikalischen Bewußtsein der Juuzer vorhanden sind bzw. vorhanden sein müssen. Daher muß die vergleichende Methode die Muotataler Musik als Ganzes erforschen. Dabei wird es günstig sein, mit dem leichter Verständlichen und Eindeutigeren zu beginnen und schrittweise zu den schwierigeren Fällen vorzustoßen. Am Anfang müßte demnach die Analyse der Tanzmusik und der dreistimmigen Jüüz' stehen, am Ende die Jüüzli, die die Muotataler Juuzer selbst als verdreht
bezeichnen und als mehrstimmig schlecht oder gar nicht realisierbar. Wie weit diese Ergebnisse
83
der Realität entsprechen, kann sodann die ethnologische Methode zu Tage bringen. Sie zielt freilich auf die gegenwärtige Realität ab. Da sich Musik und musikalische Deutungsmuster mit der Zeit ändern, können metrische Deutungen alter Aufnahmen und Aufzeichnungen, wenn die Sänger gestorben sind, nicht mehr ethnomethodologisch überprüft werden, besonders in den potentiell mehrdeutigen Fällen wird eine letzte Sicherheit und Eindeutigkeit nicht mehr zu erreichen sein.
Die Entdeckung der motivischen Entsprechung ist zugegebendermaßen ein starkes Argument gegen Sichardts taktwechselnde Deutung in Notenbeispiel 18 und für die 3/4-taktige Alternative. Mit diesen zwei Möglichkeiten ist das Thema Mehrdeutigkeit bei diesem Jodel jedoch keineswegs erschöpft. Von dem geradtaktigen Beginn der Sichardtschen Notation ausgehend ist eine dritte Auffassung formulierbar, die ebenfalls einige Plausibilität besitzt:

muotatalerisch
erscheint, ist der Parallelismus gebrochener Sexten (vgl. Notenbeispiel 16), er ist in der 3/2-Auffassung deutlicher als in den andern beiden Deutungen. Folgende Reduktion veranschaulicht die variierte Motivwiederholung:
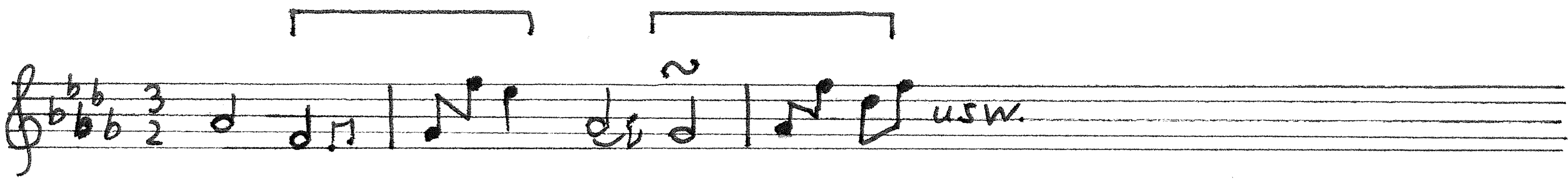
Damit ist eine aussichtsreiche Vorgangsweise bereits skizziert, die im Wesentlichen der im feed-back-Modell dargestellten holistischen
Erkenntnisweise entspricht. Einzelne Schritte des Stufenmodells
können mit Erfolg dort angewendet werden, wo die Problemkomplexität gering ist, wo also nicht die dieses Modell unbrauchbar machenden Rubati und metrischen Mehrdeutigkeiten auftauchen und wo deshalb ein einzelner Deutungsschritt zum Regelkalkül formalisiert werden kann. Solche Regeln können auf psychoakustischen Grundlagen, auf Gestaltgesetzen oder auf kulturellen Deutungsmustern basieren.
Im letzteren Fall stellt sich immer die Frage nach der Ausnahme von der Regel
nach Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Daher sind die aufgestellten Deutungsregeln auf ihre Grundlagen hin zu untersuchen. Es wäre weiters naiv zu glauben, mit den im Material erkannten Regelhaftigkeiten die musikalischen Konzepte der Juuzer entdeckt zu haben. Solche Regeln sind zuallererst eine wissenschaftliche Konstruktion. In der Linguistik wird diese Problematik unter dem Begriff der Natürlichkeit
diskutiert und gefordert, daß the internal structure of the grammar must be isomorphic to the speaker's underlying psychological structure
(Linell 1979: 9; zitiert nach Scheutz 1985: 16). Nun geht es in der vorliegenden Arbeit weder um die Erstellung einer Universalen Grammatik der Musik noch um die Erstellung eines Muotataler Jodeltonsatzes
, dieser soll vielmehr nur ein Mittel sein zur Konstruktion bzw. Rekonstruktion des Metrums. Daher will ich auf die Natürlichkeitsdiskussion nicht einsteigen und von vornherein auch solche Regeln zulassen, die ganz offensichtlich in einer underlying psychological structure
nicht
85
verankert sein können. Eine solche Regel folgt z. B. aus folgendem: Wenn die Transkription einer Jodelmelodie keine als gezählte Zeiten ausgeschriebenen Rubati enthält und wenn sie ein wiederkehrendes Motiv aufweist, dann beträgt der Abstand zwischen dem Motiv und seiner Wiederkehr ein ganzzahliges Vielfaches einer zusammengesetzten metrischen Einheit (z. B. eines Taktes), vorausgesetzt, daß kein Taktwechsel zugrunde liegt und daß das Motiv und seine Wiederkehr dieselben metrischen Betonungsverhältnisse haben. Dieser Satz ist eine Tautologie. Dennoch hat er eine methodische Konsequenz: Wenn, wie in Notenbeispiel 18, eine Motivwiederholung entdeckt wird und der Abstand zwischen dem Motiv und seiner Wiederkehr z. B. zwölf Achteln beträgt, dann ist es höchstwahrscheinlich sinnlos, einen 4/4-Takt zu vermuten, allein ein 3/8, 6/8, 2/4, 3/4 oder 3/2 ist wahrscheinlich, (vorausgesetzt es liegt ein echtes Metrum zugrunde und nicht ein Taktwechsel).
Das gilt zumindest für die mir bisher bekannt gewordene musica alpina. Der springende Punkt ist die Voraussetzung, daß das Motiv und seine Wiederkehr dieselben metrischen Betonungsverhältnisse haben, eine Voraussetzung, von der es bei ungeradtaktiger musica alpina allerdings charakteristische Ausnahmen gibt und zwar wegen der Möglichkeit hemiolenartiger Bildungen: Motivwiederholung nach drei Achteln – sieht aus wie ein 3/8-Takt – oder nach vier und acht Achteln ist durchaus möglich, wenn auch selten. Das Motiv und seine Wiederkehr haben hier nicht dieselben metrischen Betonungsverhältnisse und nehmen im metrischen Gefüge eine unähnliche Lage ein. Am einfachsten ist die Schlußweise bei der Motivwiederkehr nach sechs Achteln: Wahrscheinlich sind der 3/4 und der 6/8 Takt, alle anderen Taktarten sind unwahrscheinlich.
Wichtig im Zusammenhang mit der Natürlichkeitsdiskussion ist, daß diese Methode zwar bestimmte Taktarten vermuten läßt, aber keinerlei Anhaltspunkte für die Lage der Leicht‐ und Schwerzeiten gibt. Es ist intuitiv klar, daß die natürliche metrische Deutung mit der Wahrnehmung konkreter, schwererer und leichterer Impulse beginnt und nicht unsinnlich mit der Abschätzung von Motivabständen und der abstrakten Postulierung eines Metrums, das dann erst in einem dritten Schritt auf die Tonfolge appliziert, auf Passung überprüft und quasi versinnlicht wird.
In Notenbeispiel 4 stehen fast alle Taktstriche vor Sextabwärtssprüngen, was darauf schließen läßt, daß Wolfgang Sichardt diese Motivwiederkehr als metrisch relevant erachtete (und daß es gerade diese Annahme war, die ihn bei diesem Stück zu einem taktwechselnden Verständnis zwang). Fraglich ist allerdings, ob er in der oben explizierten abstrakt-methodischen Weise verging. Jedenfalls bleibt unklar, warum er den ersten Ton des Sprunges auf Schwerstzeit setzte, umsomehr als er eine starke Betonung der zweiten Schlagzeit
(Sichardt 1939: 39) konstatiert, die damit ebenfalls als Taktbeginn in Frage gekommen wäre.
Die Frage ist indes, ob für Marie Ablondi und andere Muotataler Kenner dieses Juuz die unregelmäßig aufeinanderfolgenden Sextsprünge überhaupt metrisch relevant sind. Zu einem anderen Ergebnis gelangte man beispielsweise, nähme man als Anhaltspunkt die Wiederkehr der tiefen Lage (fis', eis' und dis') im A-Teil, die folgenden Rhythmus ergibt:
Wie das letzte Beispiel zeigt, kann die Methode, aus Abständen auf Metrisches zu schließen, von Motiven auf Wiederkehrendes schlechthin verallgemeinert werden. Es können, wie es in diesem Beispiel geschah, Merkmalsklassen definiert werden und gemessen werden, in welchen Abständen Töne der Merkmalsklasse auftreten. Auf Grund der sich ergebenden rhythmischen Figur können dann metrische Hypothesen gebildet werden. Der Erfolg dieser Methode hängt von der Definition der Merkmalsklasse ab. Im günstigsten Fall ist bereits bekannt, welche Eigenschaften in einem Musikstil Metrisches indizieren. Ansonsten ist es ratsam, auf Gestaltgesetze zu bauen. Die Auswertung der Motive ist sinnvoll wegen des Gesetzes der Ähnlichkeit: Diese ist am größten, wenn die Motivwiederkehr die selben Betonungsverhältnisse aufweist, andernfalls ist sie verringert und kann im Extremfall gänzlich schwinden und zur reinen Augenmusik
werden, – auf deren Unmöglichkeit in oral tradierter Musik beruht die Effektivität dieser Methode. Das Gesetz der Ähnlichkeit steht auch hinter der Klassierung nach Höhenlagen. Im letzten Beispiel kommt dazu noch das Gesetz der Nähe: Die Töne der tiefen Lage folgen aufeinander mit einer Ausnahme in Sekundschritten.
Diese können psychologisch freilich nur dann wirksam werden, wenn sie nicht so weit auseinanderliegen, daß sich das Gefühl des Zusammenhangs nicht mehr einstellt. Ein Spezialfall ist die Klassierung der Töne nach Stimmregistern.
Beim Jodel bietet sich weiters die Klassierung nach Jodelsilben an. Zwar kann auf Grund der Gestaltgesetze mit Sicherheit angenommen werden, daß die durch Sekundnachbarschaften, Höhenlagen und Stimmregister sowie Jodelsilben gebildeten Impulsfolgen als Rhythmen wahrgenommen werden. Daß diese mit
87
den Betonungsverhältnissen des Metrums in irgendeinem regelhaften Zusammenhang stehen, kann jedoch nicht von vornherein angenommen werden. Bei welcher Merkmalskategorie die Methode greift, hängt davon ab, welche Merkmale für den stilkundigen Hörer metrisch relevant sind und auf welche Merkmalskategorien sich das Metrum sekundär auswirkt.
Zuletzt soll noch das Verhältnis zwischen Rhythmus und Metrum genauer betrachtet werden. Das gestaltpsychologische Konzept von Figur und Hintergrund besagt primär, daß sich die Aufmerksamkeit des Hörers normalerweise auf die Figur, also den Rhythmus richtet. Weiters unterscheidet es metrische und rhythmische Impulse, ohne über ihren strukturellen Zusammenhang etwas auszusagen, positiv ausgedrückt: ohne sich auf eine spezielle Art des strukturellen Zusammenhangs im Vorhinein festzulegen. Franz Födermayrs Beispiel des 4/4 Taktes, vor dem rhythmische Figuren ablaufen, die als aus der Division bzw. Multiplikation der [metrischen] Zählzeit entstanden aufgefaßt werden können
(Födermayr 1990: 223 f.), ist als Beispiel und als Denkmöglichkeit doppelt relativiert, auf Grund von Födermayrs Definition sind auch Rhythmen denkbar, die zur metrischen Zählzeit in einem nichtrationalen Zahlenverhältnis stehend besser beschrieben werden können, (– natürlich nicht mit den Mitteln der traditionellen Notenschrift).
Und umgekehrt sind Metren denkbar, deren periodisch wiederkehrende Impulsabstände in einem nichtrationalen Zahlenverhältnis stehen, während die vor diesem Hintergrund ablaufenden Rhythmen als aus der Division und Multiplikation dieser Impulsabstände entstanden aufgefaßt werden können. Der erste Fall ist gegeben, wenn beim punktierten Rhythmus
das Verhältnis des langen Tones zum kurzen zwischen 3:1 und 2:1 liegt und vom ausführenden Musiker nicht eine bestimmte rationale Proportion, sondern ein nicht zu scharf und nicht zu weich Punktieren
intendiert ist. Der zweite Fall liegt vor, wenn z. B. ein Innviertler oder Hausruckviertler Geiger einen als 3/4 Takt mit gestauchtem 1. und 2. Viertel und gedehntem 3. Viertel (oder annähernd als 7/8 Takt) transkribierbaren Landlertakt
intendiert und dabei das 1. und 2. Viertel in zwei gleich lange Achteln teilt. Drittens ist mit der definitorischen Festlegung, daß zwischen Rhythmus und Metrum eine Beziehung besteht, keineswegs gemeint, daß möglichst viele rhythmische Impulse mit metrischen Impulsen zusammenfallen müssen oder daß stärkere rhythmische Impulse überwiegend auf schwereren Zeiten stehen müssen. Es gibt Musik, in der sich der Rhythmus, z. B. einer Gesangsstimme, sehr frei über dem von der instrumentalen Begleitung dargestellten Metrum bewegt Und es gibt Musik, in der die Melodie vorwiegend auf die off beats setzt, sodaß ein Transkribent, wenn er primär von der Melodie ausgeht, zu einer falschen Deutung des Metrums gelangt. (Vgl. die Ausführungen von Gerhard Kubik in: Artur Simon (Hsg.), Musik in Afrika, Berlin 1983).
Bei der metrischen Deutung der Muotataler Jüüzli ist besonders der letztgenannte Punkt zu bedenken und zwar im Zusammenhang mit der Frage der Latenz des Jodelmetrums. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die in der Definition Franz Födermayrs getroffene Unterscheidung zwischen metrischer und rhythmischer Impulsfolge und zwischen real erklingender und bloß gedachter bzw. gefühlter Impulsfolge, wobei letztere Unterscheidung nur beim Metrum getroffen wird. Ob beim Musikhören auch bloß vorgestellte rhythmische Impulse eine Rolle spielen möchte ich dahingestellt sein lassen, es ist für das Problem des Jodelmetrums unerheblich. Wichtig erscheint mir der naheliegende Gedanke der Möglichkeit metrischer Impulsfolgen, die zum Teil aus real erklingenden, zum Teil aus bloß vorgestellten Impulsen bestehen. Das Metrum ist dann nur teilweise latent. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden: Entweder die real erklingenden Impulse reichen nicht aus für eine (Re)konstruktion des Metrums, die Klangfolge ist metrisch mehrdeutig. Oder sie lassen eindeutig erkennen, welches Metrum vorliegt, der Hörer vervollständigt das Metrum durch Hinzufügung bloß gedachter bzw. gefühlter Impulse. Wenn z. B. in einer Folge gleichabständiger Impulse der 2., 4. und 6., nicht aber der 8. Impuls stärker betont ist, dann wird sich der Hörer auf ein binäres Metrum einstellen bzw. einschwingen und die fehlende Betonung ergänzen. Metrum kann im Sinne der kognitiven Psychologie als Erwartung des Hörers verstanden werden. Da Impuls als plötzliche Veränderung einer Größe definiert wurde, ist Metrum als periodische Konfiguration von Veränderungserwartungen aufzufassen, die der Hörer auf Grund von auditiven Stimuli entwickelt. Die richtige
und vollständige Metrumresponse kann sich u. U. erst nach dem mehrmaligen Hören oder dem Auswendiglernen eines Musikstücke einstellen. Dabei kann es auch zur Deutung des Vorhergehenden im Lichte des Nachfolgenden kommen, es ist nicht unbedingt zu erwarten, daß bei allen Muotataler Jüüzli das Metrum den ersten paar Tönen eindeutig zu entnehmen ist.
Wenn z. B. bei einem Juuz beim 13. und 19. Zählwert ein Harmoniewechsel stattfindet, dann wird der Hörer, wenn er das Stück besser kennengelernt hat, beim 7. Zählwert eine metrische Schwerzeit hinzudenken, wenn nichts dagegenspricht.
Die bisherigen Überlegungen machen deutlich, daß der Begriff des latenten metrischen Impulses differenziert werden muß: Es gibt Impulse, die zunächst nur unscharf geortet werden können, wie die Harmoniewechsel in Notenbeispiel 18. Und es gibt Stellen, die zunächst überhaupt kein Vorhandensein eines metrischen Impulses erkennen lassen.
Mit der Unterscheidung in rhythmische und metrische Impulse taucht die Frage auf, ob es Impulse gibt, die sowohl rhythmisch als auch metrisch sind. Wenn Metrum das Gleichbleibende, das periodisch Wiederkehrende ist, das der Hörer in einer Impulsfolge erkennt und fühlt, dann ist Rhythmus das vom Metrum Abwei
89
chende, das die erkannte und gefühlte Periodizität Kontrapunktierende. Die Unterscheidung Rhythmus/Metrum ist eine strenge Dichotomie ohne Überschneidungen. Um methodische Probleme, die sich daraus vielleicht ergeben könnten, zu vermeiden, möchte ich die Teilung der Stärke eines Impulses in einen metrischen und einen rhythmischen Anteil zulassen. Diese Teilung mag künstlich, rein analytisch
erscheinen, Zudem lassen sich solche Anteile schwerlich messen oder berechnen. Die Skala der metrischen Schwere besitzt zwar einen absoluten Nullpunkt, ist jedoch sonst eine bloße Rangskala, eine Ordinalskala; man kann nicht sagen, diese Zeit sei doppelt so schwer wie jene oder die Schweredifferenz sei genau so und so groß. F. Lerdahl und R. Jackendoff (Lerdahl, Jackendoff 1983) nehmen an, daß die Schweredifferenz mit zunehmender Schwere, und d.h. auch mit zunehmendem zeitlichen Abstand, abnimmt bis hin zur Ununterscheidbarkeit.
Tatsächlich gibt es in der europäischen Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts, die die beiden Autoren untersuchen, weit häufiger Abweichungen vom Acht‐ und Sechzehntaktschema als Taktwechsel. Die beiden Autoren bemühen sich, Universalien der musikalischen Grammatik zu finden. Z. Helman meint dazu, daß angesichts des gegenwärtigen Standes der Forschung die aufgestellten Modelle keineswegs die Bedingungen der Universalität erfüllen.
(Helman 1988: 193). Müßte die Suche nach musikalischen Universalien nicht die Musik der ganzen Welt als empirische Grundlage nehmen und nicht nur einen schmalen Ausschnitt aus der europäischen Kunstmusikgeschichte? Was nun das Problem der metrischen und rhythmischen Anteile an Impulsen betrifft: es tritt in der Analysepraxis kaum auf, weil die Impulse nach Merkmalskategorien differenziert werden und in den Merkmalsklassen die binäre Codierung (Impuls = 1, kein Impuls = 0) meist ausreicht. Ein Problem tritt erst bei der Synthese bzw. Koinzidenzprüfung auf und zwar in Form der Frage nach der Gewichtigkeit der einzelnen Impulskategorien (Tonbeginnimpulse, Höhenlagenimpulse, Sekundschrittimpulse, Harmoniewechselimpulse etc.). Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, ist die Analyse von metrisch bereits vollständig gedeuteten Jodeln, also die Analyse von Transkriptionen. Die Frage ist dann, welchem Aufzeichner bzw. welchen Aufzeichnungen am ehesten noch zu vertrauen ist. Am besten erscheint es mir, das Häufige und Gewöhnliche als Material für eine solche Analyse zu wählen und das sind die im Acht‐ und Sechzehntaktschema transkribierten Jodel aus dem Muotatal und der Innerschweiz.
Sind die metrisch relevanten Merkmale einmal bekannt, so könnte ein formalisiertes Metrumerkennungsverfahren entwickelt werden, das zumindest die weniger komplexen Fälle lösen können sollte: Es werden Merkmalsklassen gebildet, die aus psychoakustischen, gestaltpsychologischen und stilistischen Gründen rhythmisch-metrisch relevant sein können. Sodann wird auf jeder Merkmalsebene 90 die Impulsfolge festgestellt. Aus den Impulsfolgen werden die Periodizitäten herausgerechnet und auf Koinzidenz überprüft. Die koinzidierenden Periodizitäten stellen miteinander ein Metrum dar. Dieses ist entweder das von den Ausführenden selbst empfundene Metrum – oder es ist ein Artefakt. Zur Erläuterung dieser Skepsis muß ich etwas weiter ausholen.
Den folgenden Wiener Dudler hörte ich von der Wienerliedsängerin und Dudlerin Trude Mally, die von dem Akkordeonisten Pepi Matauschek und dem Kontragitarristen Poldi Kroupa begleitet wurde. Ich gebe nur den Vordersatz des ersten Teils wieder, und zwar vorerst noch ohne die Betonungsverhältnisse des Metrums. Ob meine Erinnerung in allen Einzelheiten der Wirklichkeit entspricht tut hier nichts zur Sache, es geht lediglich um ein geeignetes Beispiel (Notenbeispiel 19).
Zwei Motive kehren wieder, der Abstand zwischen Motiv und seiner Wiederkehr beträgt jedesmal 12 Achteln, was einen 3/2, 3/4, 2/4 oder 6/8 Takt wahrscheinlich, einen 4/4 Takt unwahrscheinlich erscheinen läßt. Wo liegen die metrischen Zeiten? Alle Notenwerte sind ganzzahlige Vielfache einer Achtel, es ist daher naheliegend, im ersten Deutungsschritt ein Achtelmetrum zugrundezulegen. Das ist nur naheliegend, nicht zwingend, denn es könnte ebenso eine durchlaufende Folge von punktierten Achteln als gleichmäßiger Puls grundgelegt werden. Es könnte das Achtelmetrum auch um eine Sechzehntel verschoben placiert werden, derart daß alle Töne zu Synkopen würden. Solche Lösungen widersprächen allerdings dem Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten metrischen Impulse, ein Gesetz, das mir auf dieser untersten Stufe der metrischen Deutung so selbstverständlich erscheint, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß jemand daran zweifeln oder obige Tonfolge anders empfinden könnte, genausowenig wie ich mir vorstellen kann, daß jemand bei einem schwarzafrikanischen Musikstück den metrischen Puls genau zwischen den Schlägen des Elementarpulses
(G. Kubik) empfindet, was übrigens bei höherem Tempo schon allein aus psychoakustischen Gründen unmöglich sein dürfte. Auch bei langsamerem Tempo ist eine psychologische Argumentation möglich: Wenn Metrum eine periodische Konfiguration von Impulserwartungen ist, dann wird der Hörer auf Grund der ersten fünf Tonbeginnimpulse die Fortsetzung des Achtelpulses erwarten und keinerlei Veranlassung haben, zwischen den Achteln etwas oder gar
91
etwas Gewichtiges zu erwarten, es sei denn, Beweggründe, die außerhalb des gehörten Inzipits liegen, veranlaßten ihn dazu, wie z. B. die Erinnerung an ein Stück, das genauso beginnt und dann mit Sechzehnteln weitergeht. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei diesem Gesetz auf der Stufe des gleichmäßigen Pulses um eine musikalische Universalie. Daß das Gesetz auf den nächsthöheren Stufen des Schlages
und des Taktes
ebenso uneinschränkt gilt, ist jedoch zu bezweifeln: Es ist möglich, eine Kette von Synkopen oder off beats zu singen und sich den Schlag oder beat dazu im Geiste vorzustellen. Ein Hörer kann dann allerdings den off beat als beat, die Synkope als Schwerzeit deuten, es sei denn er kennt das Stück (mitsamt der dazugehörigen, das Metrum darstellenden Begleitung) oder er sieht, wie der Ausführende sich im Takt
dazu bewegt. Die Deutung mit den wenigsten hinzugedachten metrischen Impulsen ist sozusagen die bequemste, die einfachste Lösung, die der geringsten Anzahl von Zusatzannahmen
bedarf. Es ist fraglich, ob eine schriftlose Musik, die diesem Gesetz nicht entspricht, überhaupt tradierbar, überhaupt überlebensfähig ist. Sie müßte ständig dazu tendieren, im Sinne der bequemeren Lösung umgedeutet zu werden. Daher wage ich zu behaupten, daß das Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten metrischen Impulse bei der Deutung der Betonungsverhältnisse schriftloser Musik im Allgemeinen zutrifft und seltene Ausnahmen hauptsächlich in solchen Fällen vorkommen, in denen eine Melodie, die normalerweise vor dem Hintergrund einer das Metrum darstellenden Begleitung erklingt, ohne diese Begleitung zum Erklingen gebracht wird und sowohl der Ausführende als auch der Hörer, der das Stück oder die Gattung erkennt, sich die fehlende Begleitung dazudenken.
Ein solcher Fall ist der Dudler Notenbeispiel 19. Der Hörer, der zwar die tonale europäische Musik kennt, nicht aber dieses Stück, kommt bei einstimmiger Ausführung der Melodie höchstwahrscheinlich zu folgender Auffassung:
Informationssystem für Volksliedarchive in Österreich
(INFOLK) als Pause-auf-1-Walzer
angeführt ist (Haid 1991: 104). Die Bezeichnung deckt nicht alles ab, was zu diesem Typus gehört, außer der Pause auf Eins gibt es auch das Hinüberklingen des am 3. Viertel des vorhergehenden Taktes begonnenen Tones in den nächsten Takt in Form einer Synkope. Beim 16‐ und 32-taktigen Walzer wechseln schwerer und weniger schwerer Taktbeginn einander ab. Je zwei Takte bilden einen Doppeltakt
(Stockmann 1990: 38 f.). Hierbei ist die Stellung der schwereren Taktbeginne nicht abstrakt, etwa durch ein 16-Taktschema, schon vorgegeben, sondern wird durch die in der Abfolge der Harmoniewechsel erkannte Regelmäßigkeit festgelegt. Die Schwere dieser Taktbeginne liegt in der Harmoniewechselerwartung
. Beim Pause-auf-Eins
-Walzertyp stehen die Pausen oder Synkopen zumeist, wie auch im obigen Beispiel, auf den weniger schweren Taktbeginnen.
Keine Stelle des Melodieverlaufs macht darauf aufmerksam, daß hier Schwerzeiten stattfinden, sie werden allein durch den Baß dargestellt.
Höchstwahrscheinlich kann nur derjenige Hörer, der über eine große Walzer-Stilkenntnis verfügt, es diesem Dudler, wenn er unbegleitet vorgetragen wird, ankennen, wie er metrisch gemeint ist. Auch die Mikrorhythmik und Akzentuierung, die bei einer Interpretation im 3/2 Takt sicherlich anders wäre als bei einer Interpretation im 3/4 Takt, kann nur demjenigen Hörer etwas verraten, der diese Eigenheiten als Kennzeichen des Walzerischen zu deuten weiß. Zu den musikalisch-stilistischen Faktoren kommt noch der außermusikalische Kontext. Der Wienerliedliebhaber, der diesen Dudler noch nicht kennt, könnte ganz anders reagieren, wenn man ihm die Melodie vorsänge und ihm vorher sagte, es handle sich um ein lateinamerikanisches Stück. Sagte man ihm aber, es sei eine wienerische Melodie, dann aktivierte er seine Wienermusik-Deutungsmuster, die ihn allein zu der 3/4-Auffassung führen müßten, denn die – aus rein innermusikalischen Gründen zwar näherliegende – 3/2-Auffassung ergäbe eine für Wienermusik untypische und unwahrscheinliche Gestalt.
Das gleiche gilt übrigens für den folgenden Appenzeller Walzer (Notenbeispiel 20), wenn er ohne die im Appenzell übliche Begleitung durch zweite Geige, Hackbrett, Violoncello und Kontrabaß von einer Violine allein gespielt wird. Ich habe das Stück Mitte der Achtzigerjahre von dem damals etwa siebzigjährigen Appenzeller Tanzgeiger Hans Kegel gelernt und auf diversen Tanzböden und Bühnen immer wieder gerne gespielt. Die Aufzeichnung könnte gegebenenfalls überprüft werden an Hand der handschriftlichen Noten Hans Kegels, von denen der Hackbrettspieler des Duos Appenzeller Space Schöttle
Töbi Tobler, [Eine kurze Textpassage wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen], Appenzell Außerrhoden, eine Fotokopie besitzt.
[Anm.]
*)[Hans Kegels Notenbuch befindet sich heute im Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik Roothuus Gonten.].
Pause-auf-Eins-Typ vor, der problemlos in den 3/2 Takt umgedeutet werden könnte, wodurch eine achttaktige Form entstünde. Nur gäbe das Stück dann als
Appenzeller Musikkeinen Sinn, die Achttakter im Dreiertakt, die im Appenzell als
Ländleroder
Masolke(Mazurka) tradiert werden, haben einen völlig anderen melodischen Duktus. Auch hier führt allein die Kenntnis des Kanons von Gattungen zur richtigen metrischen Deutung. Sie zwingt zu einem weit höheren Ausmaß an
hinzugedachtenmetrischen Impulsen als die 3/2-Auffassung, denn es müssen, wie auch in Notenbeispiel 19, alle leichteren Schwerzeiten substituiert werden.
Die beiden Beispielfälle sind natürlich wirklichkeitsfern konstruiert, in der realen Überlieferungspraxis der Wienerliedsänger und Appenzeller Tanzmusiker werden die Melodien ja nicht einstimmig tradiert, sondern mitsamt der Instrumentalbegleitung, die das Metrum akzentuiert. Darum sind die beiden Beispiele auch keine Wiederlegung des Gesetzes der möglichst wenig hinzugedachten metrischen Impulse, sondern gehören zu den in der Theorie vorgesehenen Ausnahmen. Dieses Gesetz kann jetzt präzisiert werden als Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten Schwerzeiten. Es besagt, daß ein Hörer eine Klangfolge in jene metrische Ordnung bringen wird, bei der er möglichst wenig Schwerzeiten hinzudenken muß. Ausnahmen sind Fälle von mehrstimmig konzipierter Musik, die unvollkommen erklingt und zwar so, daß die die Schwerzeiten darstellende Stimme fehlt und der Hörer, der das Stück oder die Gattung kennt, sich die fehlenden Betonungen dazudenkt. Möglicherweise gibt es auch beim Jodel solche Ausnahmen, sei es bei der einstimmigen Ausführung mehrstimmig konzipierter Jodel oder bei der Imitation von Tanzmusik. Die Jodelforschung muß mit dieser Möglichkeit rechnen. Das unterstreicht nochmals die Forderung, die in der Muotataler Musik vorkommenden Formschemata zu studieren, bevor an die metrische Analyse der schwierigeren Jodel herangegangen wird. Dennoch soll eine auf dem Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten Schwerzeiten basierende formalisierte Metrumkonstruktion an einem Beispiel gezeigt werden und zwar am 6. Segment von Notenbeispiel 17. Hierzu werden zuerst die Impulsfolgen auf den verschiedenen Merkmalsebenen abstrahiert (Tonbeginne, Registerwechsel, Sekundfortschreitungen etc.) und als graphisches Muster dargestellt:
94
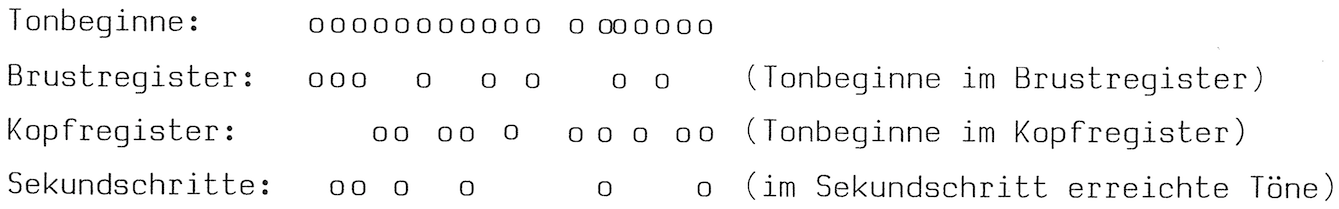
hinzugedachten
Schläge berechnet:
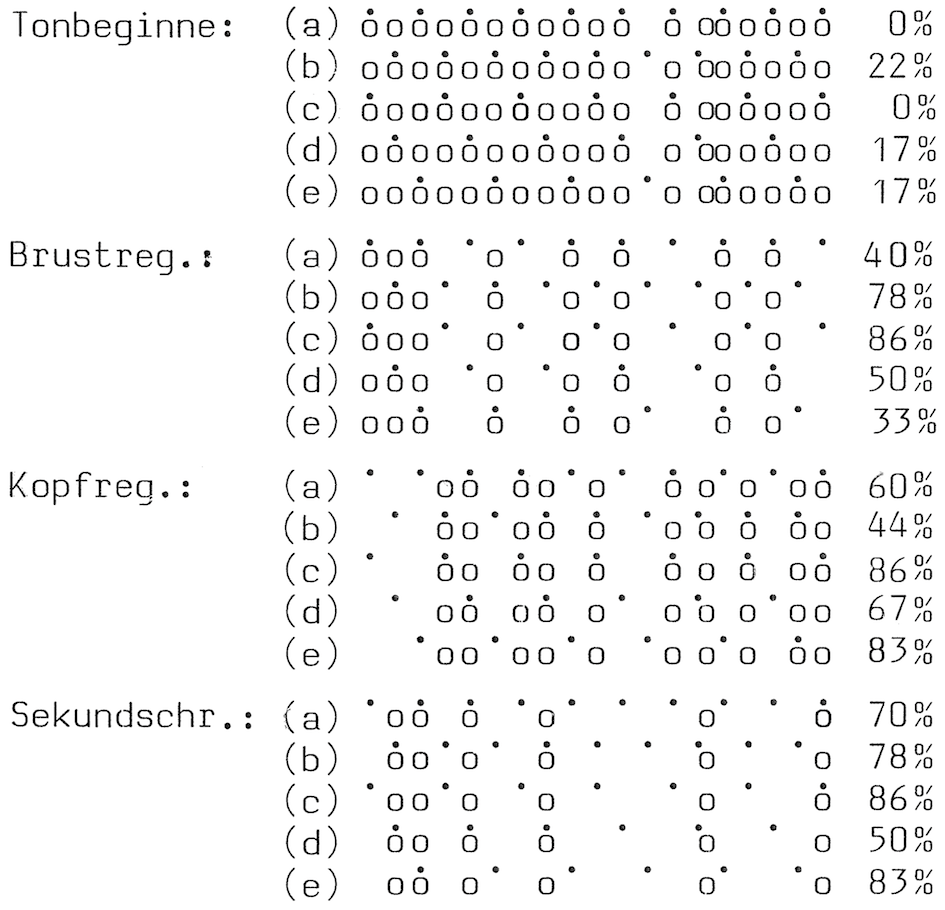
Das Minimum an hinzugedachten Schlägen liegt in jeder Merkmalsklasse bei einem anderen Metrum. Es drängt sich die Frage der Gewichtung auf, die jedoch nicht vorab entscheidbar ist. Zudem ist schon allein aus mathematisch-logischen Gründen bei den zwei binären Metren (a) und (b) der Prozentanteil beim Kopf-Register umso höher, je tiefer er beim Brustregister ist und umgekehrt. Selbst wenn man die metrische Relevanz der unspezifizierten Tonbeginne intuitiv höher bewertet, ergibt sich immer noch eine Zweideutigkeit zwischen Metrum (a) und Metrum (c).
Eine weitere, bei diesem Beispiel sehr naheliegende Möglichkeit ist die Analyse der Sekundgänge (Paul Hindemith). Hierzu wird die Melodie als einstimmige Darstellung einer Zweistimmigkeit aufgefaßt:
Da in den beiden Stimmen
nur eine einzige Tonwiederholung vorkommt, und zwar der vierte Ton der unteren Stimme, ist die durch die Sekundgänge der oberen Stimme erzeugte Impulsfolge mit der des Kopfregisters fast völlig identisch, sodaß eine Auswertung der Sekundgänge der unteren Stimme sowie der gesamten Sekundgänge genügt:
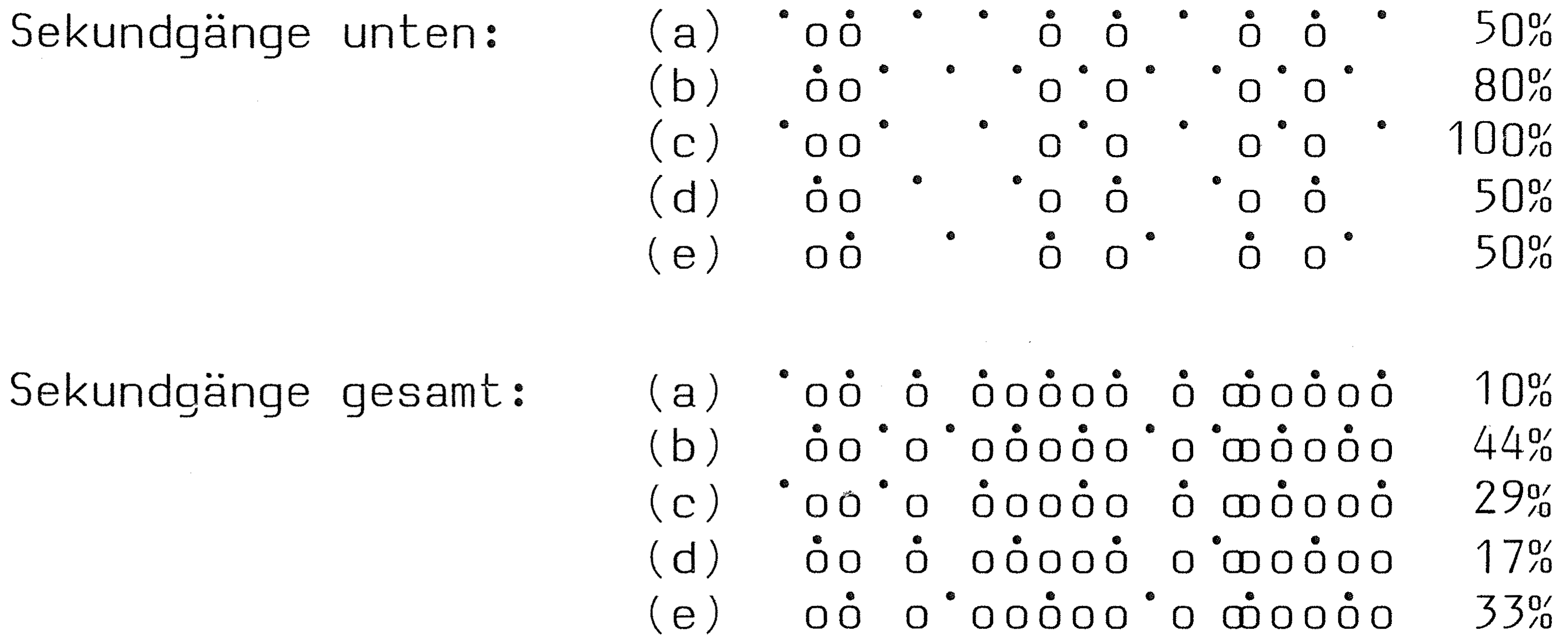
Stimmen
mit ein, so ergäbe die Koinzidenz der Metren (a) und (c) mit den gesamten Sekundgängen null Prozent dazugedachter Schläge, sodaß eine Entscheidung zugunsten eines der beiden Metren auch mit dieser Methode nicht herbeigeführt werden kann. Die Betrachtung der Sekundschritte und Sekundgänge erschien deshalb wesentlich, weil sie sowohl den Wechsel des als führend
empfundenen Tones als auch Harmoniewechsel anzeigen können, Vorgänge, die sehr wahrscheinlich metrisch relevant sind.
Wortwörtliche Motivwiederkehr gibt es in dieser Melodie nicht. Wenn man will, kann man einige wiederkehrende variierte Motive erkennen:

Diese Methode schränkt die große Anzahl theoretisch möglicher Lösungen auf einige wenige ein. Ihr Ergebnis ist nur dann sinnvoll, wenn sich unter den konstruierten Lösungen die richtige Lösung befindet. Das ist genau dann der Fall, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
- Es sind keine Dehnungen oder Kürzungen (Rubato) als gezählte Zeiten notiert
- Es liegt ein einheitliches, durchgehendes Metrum vor.
- Das Musikstück unterliegt dem Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten Schwerzeiten.
Um aus der Lösungsmenge die richtige Lösung (vorsichtiger: die plausibelste metrische Hypothese) zu extrahieren, sind weitere Schritte notwendig und zwar solche, die über die psychoakustischen und gestaltpsychologischen Grundlagen hinausgehen und kulturelle, stilspezifische Deutungsmuster verwenden. Solche weiteren Schritte können auf drei Ebenen gesetzt werden: a) auf der Ebene der applizierten Metren, b) auf der Ebene der einschränkenden Bedingungen und c) auf der Ebene der Impulsklassen.
- ) Sobald im Verlauf der Untersuchung ein erster Überblick gewonnen ist darüber, welche Metren im Muotatal existieren, kann sich die weitere Analyse auf diese Metren beschränken und muß nur in Fällen, in denen sie keinen Sinn ergeben, andere Möglichkeiten in Betracht ziehen.
- ) An bereits vollständig und richtig gedeuteten Jodeln können Eigenschaften beobachtet werden, die auf jeden oder zumindest fast jeden Jodel zutreffen. Damit lassen sich Regeln formulieren. Ein Beispiel wäre die Regel, daß die Finalis auf Taktbeginn steht oder daß im 3/4 Takt der Rhythmus unwahrscheinlich ist. Zu beachten ist auch hier, daß es Ausnahmen geben kann.
- ) Vielversprechend mag zunächst das Herausarbeiten der stilspezifischen metrisch relevanten Impulse erscheinen. Soweit es sich dabei jedoch um Harmoniewechsel und um Wechsel des als führend empfundenen Tones handelt, ist dies problematisch und zwar nicht wegen der an Notenbeispiel 18 bereits demonstrierten Mehrdeutigkeit, sondern wegen der Schwierigkeit, die komplizierten Abstraktions‐ und Synthesevorgänge des musikalischen Bewußtseins zu simulieren oder einen Algorithmus zu entwickeln, der zu demselben Ergebnis gelangt. Daher werde ich die über die harmonische und melodische Struktur der Muotataler Jodel zu gewinnenden Erkenntnisse auf andere Weise verwenden, nämlich zur Überprüfung der bereits konstruierten Lösungen auf ihre musikalische Sinnhaftigkeit.
All diese stilabhängigen Methoden sind allerdings mit dem Problem behaftet, daß sie richtig gedeutete Jüüzli, also vertrauenswürdige Aufzeichnungen zumindest einiger Jüüzli bereits voraussetzen. Ich möchte dieses Problem später an Hand der Quellen besprechen. Zunächst möchte ich den Gedanken wieder aufnehmen, daß der eben skizzierten bottom-up-Konstruktion eine holistische
top-down-Deutung vorzuziehen ist, die statt der bloßen Metren ganze, Rhythmisches, Metrisches, Harmonisches und Melodisches umfassende Formschemata appliziert und auf Passung überprüft. Sie könnte vielleicht verwechselt werden mit einer verbrämten intuitiven Deutung, die den gefundenen Sinn im Nachhinein rationalisiert und argumentativ aufbereitet. Der Unterschied ist jedoch der, daß die von mir angestrebte Vorgangsweise stets die Möglichkeit im Auge behält, daß die musikalischen Intuitionen der Muotataler Juuzer von den meinigen verschieden sein können. Sie wird daher sorgfältig prüfen, welche die Deutungsmuster sein können, die zum Verständnis der Muotataler Jüüzli notwendig sind.
Dadurch wird es möglich, Lösungen zu finden, auf die ich auf bloß intuitivem, d.h. von meinen Hörgewohnheiten bestimmtem Weg nicht gekommen wäre. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, und zwar an dem in Notenbeispiel 17 dargestellten Jodel. Meine spontane, intuitive Deutung dieser Tonaufnahme (Zemp 1990: 3a) war die:
Hinter dieser Intuition steht das Deutungsmuster der parallelen Sexten, der Beginn erscheint als ein einstimmig dargestellter, mit Nebennoten
umspielter Anstieg in Sextparallelen:
Jedes Fortschreiten der Sext ist ein Schwerzeiterlebnis. So entsteht ein 2/4-Takt-Eindruck und damit eine auf das Kommende gerichtete 2/4-Takt-Erwartung. Diese Erwartung wird auch keineswegs enttäuscht, sondern durch das Folgende in höchstem Maße erfüllt: Der Schlußton kommt auf Schwerstzeit sowohl im 5. als auch im 6. Segment. Ein Schluß auf Leichtzeit hätte mich alarmiert und mir bedeutet, daß etwas nicht stimmt
, sei es meine Deutung oder die Interpretation des Ausführenden. Meine Erwartung der Schwerzeitfinalis gründet auf meiner Bekanntschaft mit zahlreichen alpenländischen Jodeln.
Es gibt nun noch eine zweite Deutung. Ich entdeckte sie auf konstruktivem Weg und zwar durch Applikation des häufigsten Formschemas des alpenländischen Jodels, nämlich des periodisch gebauten Achttakters im 3/4 Takt:
Diese auf konstruktivem Weg entstandene Deutung befriedigt mich auch musikalisch-intuitiv. Intuitiv beglaubigt
wird sie durch das harmonische Schema T﹣D﹣D﹣T:
T﹣D﹣D﹣T ist mir als eines der häufigsten Harmonieschemata der musica alpina bekannt. Weitere intuitive Plausibilitäten sind der weibliche
Halbschluß und der männliche
Ganzschluß dieser periodisch gebauten Form. Die Verbindung von lydischer Tonart und Funktionsharmonik ist mir bereits von der Appenzeller Musik her geläufig. Die Schwerstzeiten (Taktbeginne) sind hier nicht durch – hineininterpretierte – Sextparallelen-Fortschreitungen, sondern durch – hineininterpretierte – Harmoniewechsel dargestellt. Auf rein intuitivem Weg ist diese Lösung wohl deshalb kaum zu entdecken, weil sie zahlreiche Nebennoten und Vorhalte beinhaltet und weil sie die Melodie auf dem zweiten Viertel des Taktes beginnen läßt.
Es kann an dieser Stelle noch nicht für die eine oder die andere Lösung plädiert werden. Vielmehr möchte ich mit dem Beispiel unterstreichen, daß es keine Gewähr dafür gibt, daß die intuitiv gefundene Lösung die richtige ist. Mit dieser begnügt sich jedoch die naiv-vorwissenschaftliche Deutung des Jodelmetrums. Sie hält das Metrum für etwas in der Klangfolge selbst Enthaltenes, objektiv Gegebenes, das es bloß zu entdecken gälte. Sie ist sich des Anteils der eigenen Interpretationsleistung am Zustandekommen der Lösung nicht bewußt. Oder sie hält allgemeine musikhistorische oder alpinmusikalische Stilkenntnisse für ausreichend, um über das Jodelmetrum ein bündiges Urteil abgeben zu können. Zudem verhindert die psychologische Beharrungs‐ und Vertiefungstendenz der einmal eingerasteten Deutung das Bewußtwerden von 99 Alternativen. Dadurch daß sie gleich bei der erstbesten einigermaßen einleuchtenden Lösung stehenbleibt, kommt die naive Metrumdeutung kaum je in die Verlegenheit, sich mehreren intuitivmusikalisch gleichwertigen Lösungen gegenüberzusehen. Die Konfrontation mit obigen Beispielen sollte sie nicht zur Bildung einer naiven Theorie der Mehrdeutigkeit anregen, sondern zur Aufgabe ihrer Prinzipien. Denn es ist sehr die Frage, ob eine vom Aufzeichner gefundene Mehrdeutigkeit auch für den Muotataler Juuzer besteht. Nur die Befragung der Ausführenden kann hier letzte Klarheit schaffen. Zur Bildung plausibler Hypothesen jedoch ist es notwendig, die Muotataler Musik ausführlicher zu studieren und nicht nur ein Dutzend Jüüzli und ein paar Holztrompetenstücke.
Der hier entworfene theoretische und methodische Ansatz führt ein aus der musikpsychologisch ausgerichteten Rhythmusforschung übernommenes Konzept mit dem intrakulturellen Forschungsansatz der Ethnomusikologie zusammen. Damit ist ein Programm erstellt, das nur in der Feldarbeit adäquat eingelöst werden kann. Die ihr vorausgehende Hypothesenbildung bedarf eines einigermaßen gesicherten Vorwissens. In Ermangelung eines Fachleutekonsenses
kann dieses Vorwissen nicht aus der Literatur einfach abgerufen werden, sondern muß erst im hermeneutischen Zirkel
erarbeitet werden. (Diesen Zirkel in die lineare Darstellungsform eines Buches zu bringen, ist ein Problem für sich). Eine sichere Grundlage bieten spektrographische Messungen, wertvolle Hinweise können statistische Untersuchung von Transkriptionen geben. Diese Ergebnisse lassen zwar keine Aussagen über die metrischen Betonungsverhältnisse zu, können aber doch meine Argumentation in entscheidenden Punkten abstützen. Deshalb sind die spektrographischen und statistischen Untersuchungen dem (noch unveröffentlichten) historisch-vergleichenden und ethnomethodischen Teil vorangestellt.
Jüüzlitranskriptionen in statistischer Untersuchung
Die starken Hinweise darauf, daß der Muotataler Jodelstil kein Rubatostil ist *) *) Sie werden im nächsten Kapitel erbracht. lassen die statistische Auswertung notenschriftlicher Aufzeichnungen sinnvoll und aussichtsreich erscheinen, weil davon ausgegangen werden kann, daß die Notenlängenverhältnisse hinreichend genau die Tondauerverhältnisse abbilden, die Länge einer Jüüzlinotation also eine hinreichend genaue Auskunft darüber gibt, wieviele metrische Einheiten das Jüüzli hat. Die statistische Untersuchung bedarf freilich einer solchen Vorannahme nicht, sie kann Häufigkeiten und Zusammenhänge feststellen, ohne vorauszusetzen, daß die untersuchten Zeichenketten mit der Musik, die sie zu beschreiben behaupten, sehr viel zu tun haben. Die Auffassung, daß der Muotataler Jodelstil kein Rubatostil ist, hat in Bezug auf die statistische Untersuchung nicht mehr als den Rang einer Hypothese, die zur Erklärung der herausgestellten Zusammenhänge herangezogen werden kann, aber nicht muß.Wesentlich ist für diese Untersuchung die begriffliche Unterscheidung in Länge (Summe der Notenwerte) und Dauer (in Sekunden: = Summe der Notenwerte mal 60 dividiert durch den Metronomwert). Es werden vorerst nur die Längen betrachtet. Die beiden Leitfragen sind:
- Wie ist die Häufigkeitsverteilung der Längen beschaffen bei den von den Transkribenten als taktwechselnd oder taktlos eingestuften Jüüzliinterpretationen. Gibt es bevorzugte Längen oder liegt eine Zufallsverteilung vor?
- Gibt es zwischen den taktwechselnden und taktlosen Notationen einerseits und den regulärtaktigen, d.h. ein einheitliches Taktmaß aufweisenden Transkriptionen andererseits hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Längen einen signifikanten Unterschied?
Der Fragestellung entsprechend kamen als Material für die Untersuchung nur solche Notationen in Betracht, mit denen der Transkribent eine Behauptung über die metrorhythmische Struktur verband, sei es über das Vorhandensein oder auch über das Nichtvorhandensein einer solchen. Die Transkriptionen Franz Födermayrs schieden somit aus, weil sie mit keiner derartigen Behauptung verknüpft sind.
Weiters wurden die Muotataler Jüüzliaufzeichnungen A. L. Gaßmanns ausgeschlossen, weil sie keine Transkriptionen von Tonaufnahmen sind, auch deshalb, weil fast alle regulärtaktig sind und die Kontrollgruppe der regulärtaktigen Notationen ohnehin groß genug ist. Das Material umfaßt somit die Jüüzlinotationen Wolfgang Sichardts und Heinrich J. Leutholds, jener beiden Autoren, die eine ausformulierte Theorie der Metrorhythmik des Muotataler Jodels entwickelt haben. Das Material enthält außer den 13 Jüüzlitranskriptionen Sichardts (Sichardt 1939) und den zwei von Leuthold transkribierten Bücheljüüz
(Leuthold 1981: 103) auch eine Notation Leutholds, die nicht
101
als Tonbandtranskription ausgewiesen ist (Leuthold 1981: 57). Sichardts taktwechselnde und Leutholds taktlose Notationen zu einer Gruppe zusammenzufassen lag deshalb nahe, weil Leuthold zu Sichardts Taktwechselnotierung kritisch Stellung nimmt und behauptet, daß diesem Muotathaler Rhythmus
in Wirklichkeit überhaupt jedes Metrum fehlt
(Leuthold 1981: 58).
Bei der Durchsichtung der Jüüzlinotationen fiel auf, daß sie zumeist mehrere Segmente oder Formabschnitte unterschieden. Diese Gliederung ist durch besondere Zeichen ausgedrückt: Doppelstrich , Schlußstrich und Wiederholungszeichen . Das ermöglichte es, der statistischen Untersuchung als Material die einzelnen Abschnitte zugrundezulegen. Die Segmentierung erschien aus mehreren Gründen sinnvoll, ja notwendig: Erstens ist in einigen Transkriptionen Sichardts ein Teil taktwechselnd, der andere regulärtaktig. Die Segmentierung verbessert also die Differenzierung in taktwechselnde und regulärtaktige Notationen. Zweitens erhöht sie die Vergleichbarkeit des Materials insofern, als die zwischen den Abschnitten häufig aufscheinenden längeren Pausen, die von den Sängerinnen und Sängern vielleicht gar nicht immer als gezählte Zeiten gemeint waren, aus der Untersuchung herausfallen. Das gleiche gilt für die Schlußnoten der Abschnitte, sie wurden ebenfalls entfernt. Zwar wurden ihre Längen in Tab. 1 und 2 noch eingetragen (Zahl nach dem Pluszeichen), aber in der Auswertung nicht weiter berücksichtigt. Drittens vermehrt die Segmentierung die Zahl der untersuchbaren Objekte auf eine statistisch relevante Gesamtheit von 49 Abschnitten.
Ein weiteres Problem war es, ein Maß für die Länge der Abschnitte zu definieren. Am einfachsten wäre es gewesen, einen bestimmten Notenwert, z. B. die Achtelnote, als Vergleichsbasis zugrunde zu legen. Doch weiß ich aus meiner Erfahrung als Transkribent, daß die Entscheidung, ob ein Musikstück mit Achteln und Vierteln oder mit doppelt so großen – oder halb so langen – Notenwerten aufzuzeichnen ist, zum Teil willkürlich ist, besonders bei Musik, für die sich noch keine einheitliche Notationstradition herausgebildet hat, – und das ist bei den taktwechselnden
Muotataler Jüüzli der Fall. Daher bestimmte ich die als Vergleichsbasis dienende Einheit, im Folgenden Vergleichseinheit genannt, wie folgt: in den Transkriptionen Sichardts ist die Vergleichseinheit der zweitlängste Notenwert einer (meist mehrere Abschnitte umfassenden) Jüüzlinotation, außer es ist dieser Wert eine Punktierte, in diesem Fall wurde der drittlängste Notenwert als Vergleichseinheit definiert. In den Transkriptionen Leutholds wurde der drittlängste Notenwert eines Abschnitts als Vergleichseinheit bestimmt. Die Schlußnoten der Abschnitte wurden als durchgestrichen
betrachtet und weder bei Sichardt noch bei Leuthold in diese Kalkulation einbezogen. Die Längen der Abschnitte wurden nun als Vielfache der Vergleichseinheit ausgedrückt und in Tabelle 1 und 2 eingetragen. Dehnungen und Kürzungen wurden nicht berücksichtigt.
102
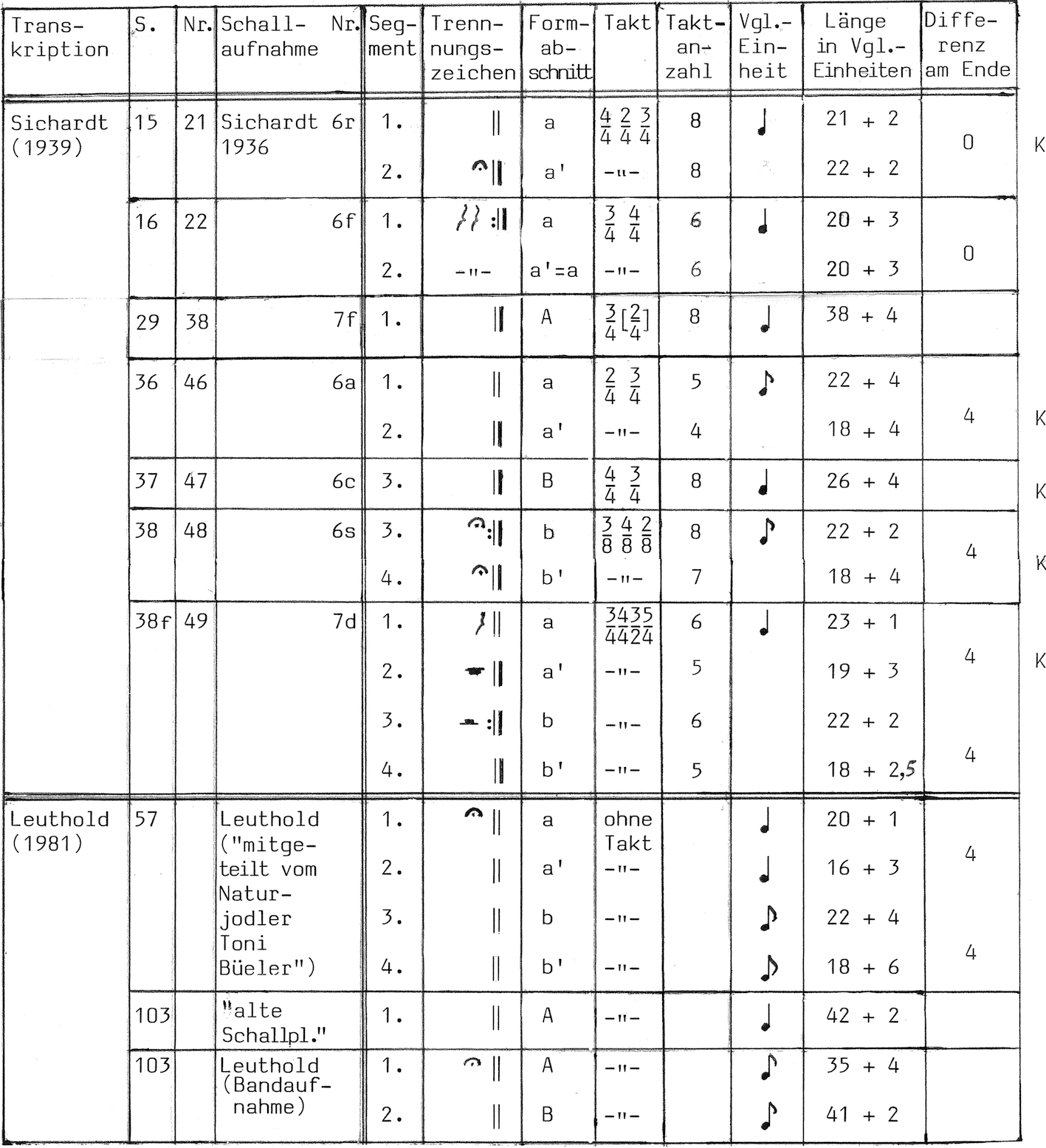
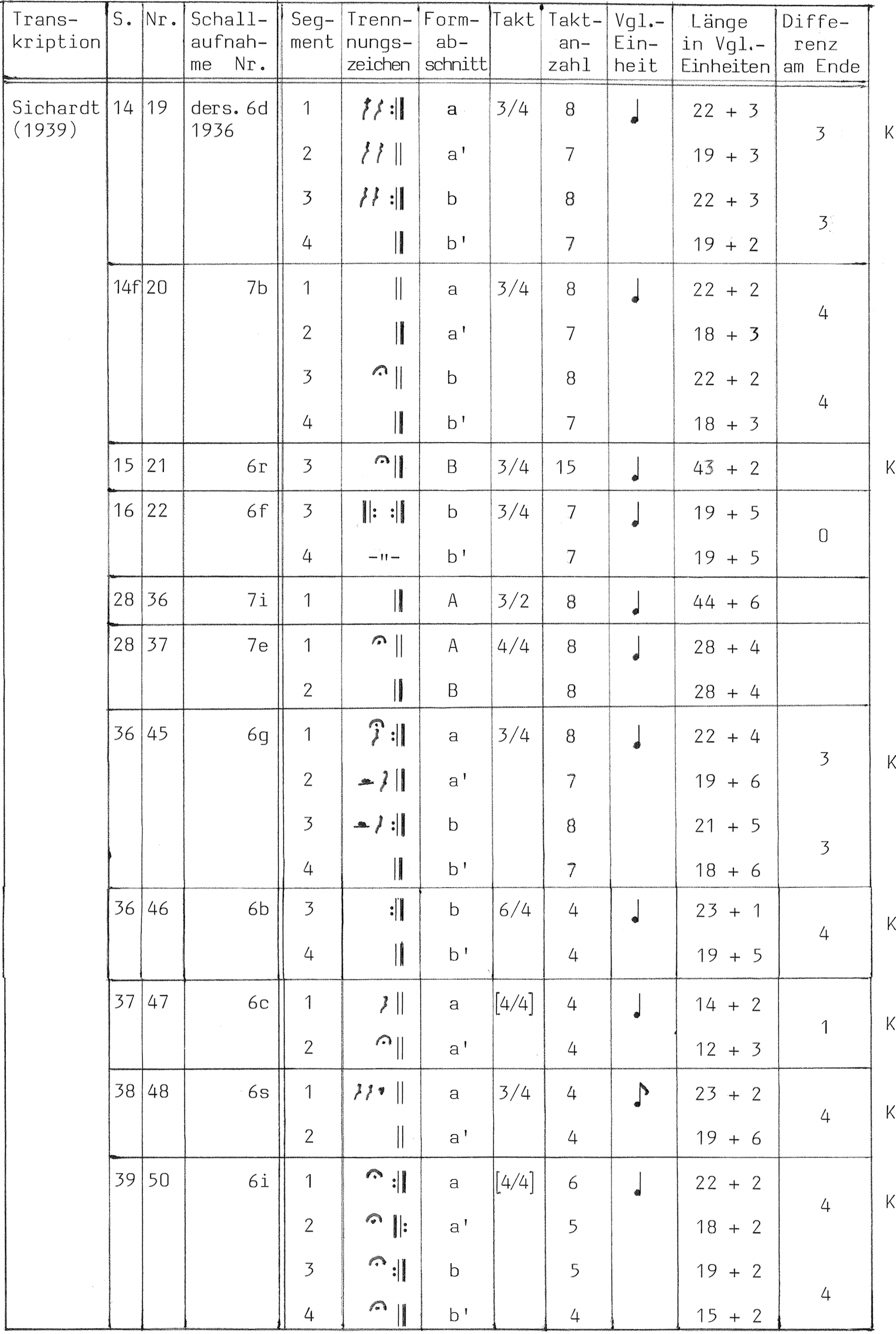
Von den 49 Abschnitten sind 28 regulärtaktig, 14 taktwechselnd und 7 taktlos. Die Entscheidung, ob ein Abschnitt als taktwechselnd einzustufen sei, erfolgte durch Zählung der Notenwerte in den einzelnen Takten. Bei Sichardt sind die Taktwechsel ohnehin in fast allen Fällen bezeichnet. Nur in einem einzigen Fall (Sichardt 1939: 29, Nr. 38) fehlt dieser Hinweis. Bei Max Peter Baumann (Baumann 1976: 191) findet sich ein Wiederabdruck dieses Jodels, bei dem der erste Taktstrich in der 2. Zeile – kommentarlos – weggelassen ist. Hielt Baumann ihn für einen Druckfehler? Ein Druckfehler ist wohl eher das Fehlen der Taktwechselbezeichnung. Sichardt hat bei der Variante dieses Jodels (Sichardt 1939: 36 Nr. 46) an der gleichen Stelle ebenfalls einen Taktstrich gesetzt. Glücklicherweise ist dieses Detail für die Einstufung der Transkription belanglos: Auch Baumanns Notation ist taktwechselnd, der Taktwechsel ist ohne Veränderung der Notenwerte gar nicht eliminierbar.
Taktangaben fehlen auch in zwei regulärtaktigen Transkriptionen Sichardts (Sichardt 1939: 37 Nr. 47 und 39 Nr. 50). Ich habe in Tab. 1 und 2 die fehlenden Taktangaben ergänzt und in Klammer gesetzt. Nach dem Beginn des Schlußtons beginnende Schlußtakte, mitunter voll Pausen, wurden nicht mitgezählt.
Um dem Einwand, ich hätte die Transkriptionen so zurechtinterpretiert
, daß am Ende das von mir gewünschte Ergebnis herauskomme, zu begegnen, habe ich mich der eigenen musikalischen Deutung so weit wie möglich enthalten. Eine Ausnahme bildet die in Tabelle 1 und 2 aufscheinende Spalte Formabschnitt
.
Die Entscheidung, ob ein Abschnitt eine variierte Wiederholung des vorigen Abschnitts ist oder ein musikalisch neuer Teil, ist ohne musikalische Deutung nicht möglich. Bei der Erstellung dieser Spalte wurden drei Fälle unterschieden:
105
Großbuchstaben bezeichnen Abschnitte, die nicht wiederholt werden, Kleinbuchstaben Abschnitte, die wiederholt werden, was fast immer in leicht veränderter Form geschieht, weshalb alle Wiederholungen, egal ob verändert oder nicht, mit a' und b' bezeichnet wurden. Die alphabetische Reihenfolge gibt die Reihenfolge der Abschnitte in der Notation an, z. B. hat W. Sichardts Transkription Nr. 21 (Sichardt 1939: 15) die Abschnitte a, a', B in dieser Reihenfolge.
Die bei der Wiederholung auftretende Veränderung betrifft meist auch die Länge: Längenveränderungen in Form von zusätzlichen oder fehlenden Tönen treten am Anfang und/oder am Ende, nie in der Mitte des wiederholten Abschnitts auf. Im Fall der Längendifferenz am Ende ist die Wiederholung immer kürzer. Die Transkribenten schreiben hier oft ein Wiederholungszeichen mit erstem und zweitem Schluß. Da die Längendifferenz am Abschnittsbeginn selten, die am Abschnittsende häufig auftritt, wurde nur letztere in Tab. 1 und 2 eingetragen.
Der erste und zugleich der wichtigste Schritt ist die Darstellung der Häufigkeit der verschiedenen Längen taktwechselnd und taktlos notierter Jüüzliabschnitte. (Siehe Abb. 1). Es zeigt sich keineswegs, wie bei metrisch freier
Musik vielleicht erwartet werden könnte, eine Zufallsverteilung, sondern eine bimodale Verteilung, bei der in dem schmalen Bereich zwischen 18 und 23 Vergleichseinheiten ein Großteil der Werte (71% bzw. 15 von 21) konzentriert ist und ein zweites Dichtemaximum bei der doppelten Länge um die 39 Einheiten herum liegt.
Noch erstaunlicher ist der Vergleich mit der ebenfalls in Abb. 1 dargestellten Verteilung der Längen der regulärtaktig notierten Abschnitte. Auch hier liegen 3/4 der Werte (21 von 28) in demselben schmalen Bereich. Taktwechselnde, taktlose und regulärtaktige Jüüzlinotationen scheinen denselben Gesetzen unterworfen zu sein. Haben die taktwechselnden
und die metrisch ungebundenen
Jüüzli vielleicht dieselben Metren und Taktschemata wie die regulärtaktigen, nur daß die Aufzeichner das Metrum nicht erkannten? Oder sind umgekehrt die von Wolfgang Sichardt für manche Jüüzli behaupteten regulären Metren eine Mißdeutung und die regulärtaktig notierten Segmente in Wirklichkeit ebenso irregulär wie die anderen?
An der Ähnlichkeit der beiden Verteilungen würde auch die Entfernung der vier beinahe regulärtaktigen Abschnitte, bei denen nur ein einziger Takt von den anderen abweicht (Sichardt 1939: 29 Nr. 38 A, 37 Nr. 47 B und 38 Nr. 48 b und b') nichts ändern, weil diese vier Segmente sehr verschiedene Längen haben und die Struktur der Verteilung nicht beeinflussen.
106

Dicke Linie: taktwechselnd und taktlos notierte Abschnitte, dünne Linie: regulärtaktige Notationen.
Daß in Abb. 1 die nicht wiederholten Abschnitte (Großbuchstaben) allesamt länger erscheinen als die wiederholten (Kleinbuchstaben), liegt natürlich auch an der gewählten Definition der Vergleichseinheit. Doch handelt es sich dabei nicht bloß um ein definitionsabhängiges Artefakt, auch andere von mir ausprobierte Definitionen zeitigten eine Tendenz zur im Durchschnitt größeren Länge der unwiederholten Abschnitte. Ferner zeigte die Betrachtung der Transkriptionen, daß sechs der neun unwiederholten, aber nur einer der 20 wiederholten Abschnitte in sich selbst bereits eine Wiederholung enthalten, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der abkürzenden Schreibweise mit Wiederholungszeichen notiert, sondern ausgeschrieben ist. Die im Durchschnitt größere Länge der unwiederholten Abschnitte dürfte also zumindest zum Teil dadurch verursacht sein, daß sie zumeist ausgeschriebene Wiederholungen sind. (Ich hätte diese ausnotierten Wiederholungen in zwei Abschnitte teilen können, doch wollte ich mich bei der Erstellung des Materials der eigenen musikalischen Deutung enthalten und nur die in Zeichen ausgedrückten Deutungen der Transkribenten zugrundelegen).
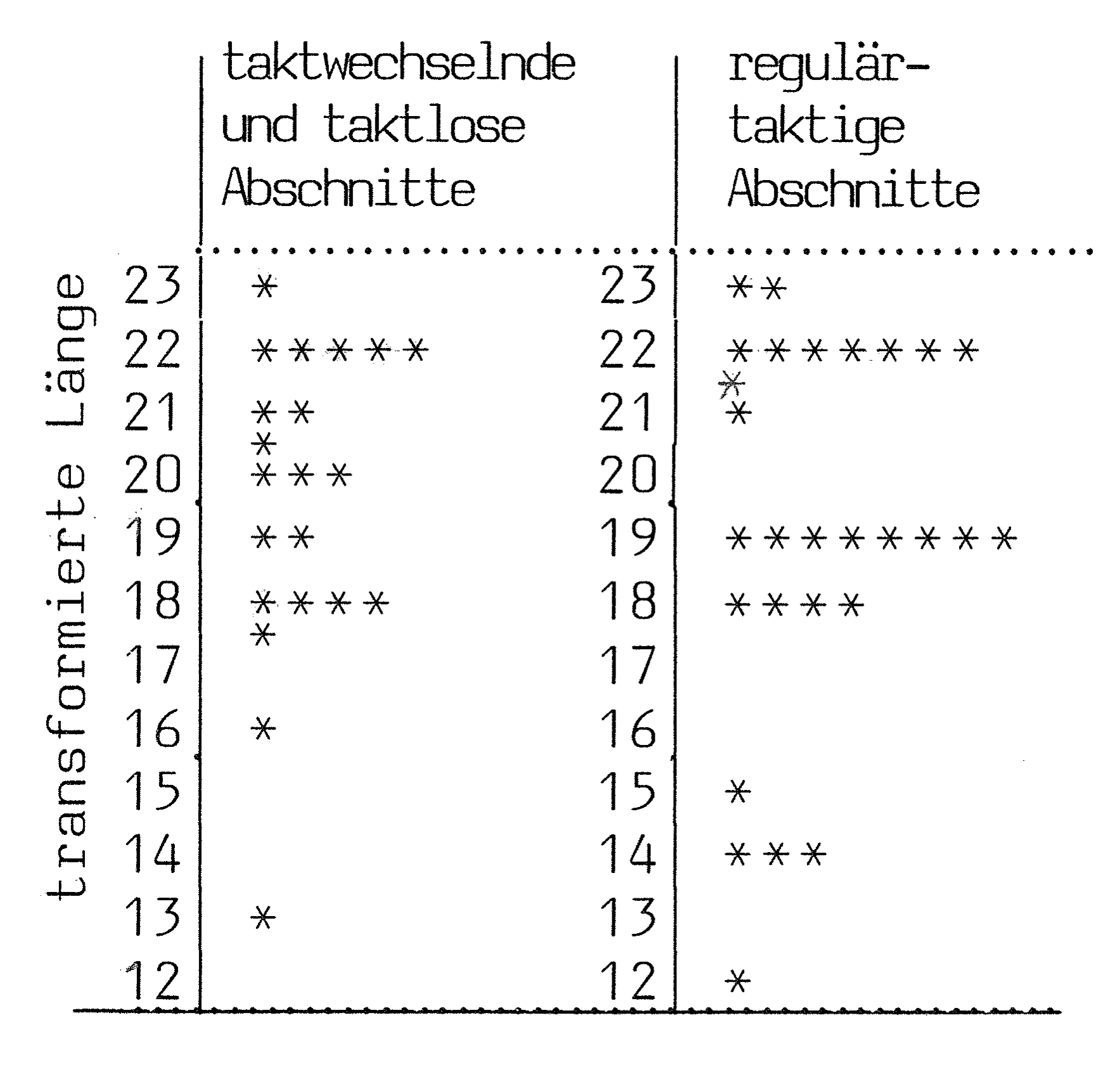
Die Verteilung der Längen der taktwechselnden und taktlosen Abschnitte ist in Abb.3 noch weiter von einer Gleichverteilung entfernt: Wegen 17−√2 = 24,04 müßten
50% der transformierten Längen im Bereich zwischen 17 und 24,04 (entspricht 12,02) liegen, tatsächlich sind es jedoch 90%. Nur 10% der Werte liegen in der anderen Hälfte zwischen 12,02 und 17. Wären die Längen taktwechselnder bzw. taktloser Jodelmelodien im Muotatal tatsächlich gleich‐ oder zufallsverteilt, dann wäre die Chance Sichardts und Leutholds, unter 13 aufgenommenen Jodelabschnitten (– und um soviele handelt es sich abzüglich der Wiederholungen –) elf mit der transformierten Länge 17 bis 24 haben, gleich der Chance, mit dreizehn Münzwürfen elf mal Zahl
zu erhalten. Sie läge bei 1/100. Die Chance, daß 10 der 13 Längen in dem Drittel zwischen 17,5 und 22,05 liegen, wie es der Fall ist, läge bei etwa zwei Tausendstel. Daß diese Häufigkeitsverteilung ein Artefakt der Transkription ist, kann als völlig unwahrscheinlich ausgeschlossen werden, zumal die Transkribenten diese Abschnitte keinem metrisch-formalem Schema unterwerfen.
Die einzig plausible Annahme ist, daß diese Häufigkeitsverteilung in irgendeiner Weise in den Jüüzli selbst vorhanden ist.
Daß die regulärtaktigen Abschnitte in Abb. 3 eine ganz ähnliche Verteilung aufweisen werden, war vorauszusehen, die Transformation halbiert ja nur die wenigen längeren Werte von Abb. 1. Die auffallende Lücke zwischen den Maxima bei 19 und bei 22 Einheiten dürfte dadurch verursacht sein, daß die Wiederholungen a' und b' zumeist um 3 oder 4 Vergleichseinheiten kürzer sind als die Abschnitte a und b. Tatsächlich zeigt die Längenverteilung der a‐ und b-Abschnitte nicht diese Doppelzüngigkeit, ebensowenig die der a'‐ und b'-Abschnitte (Abb. 4 und 5).
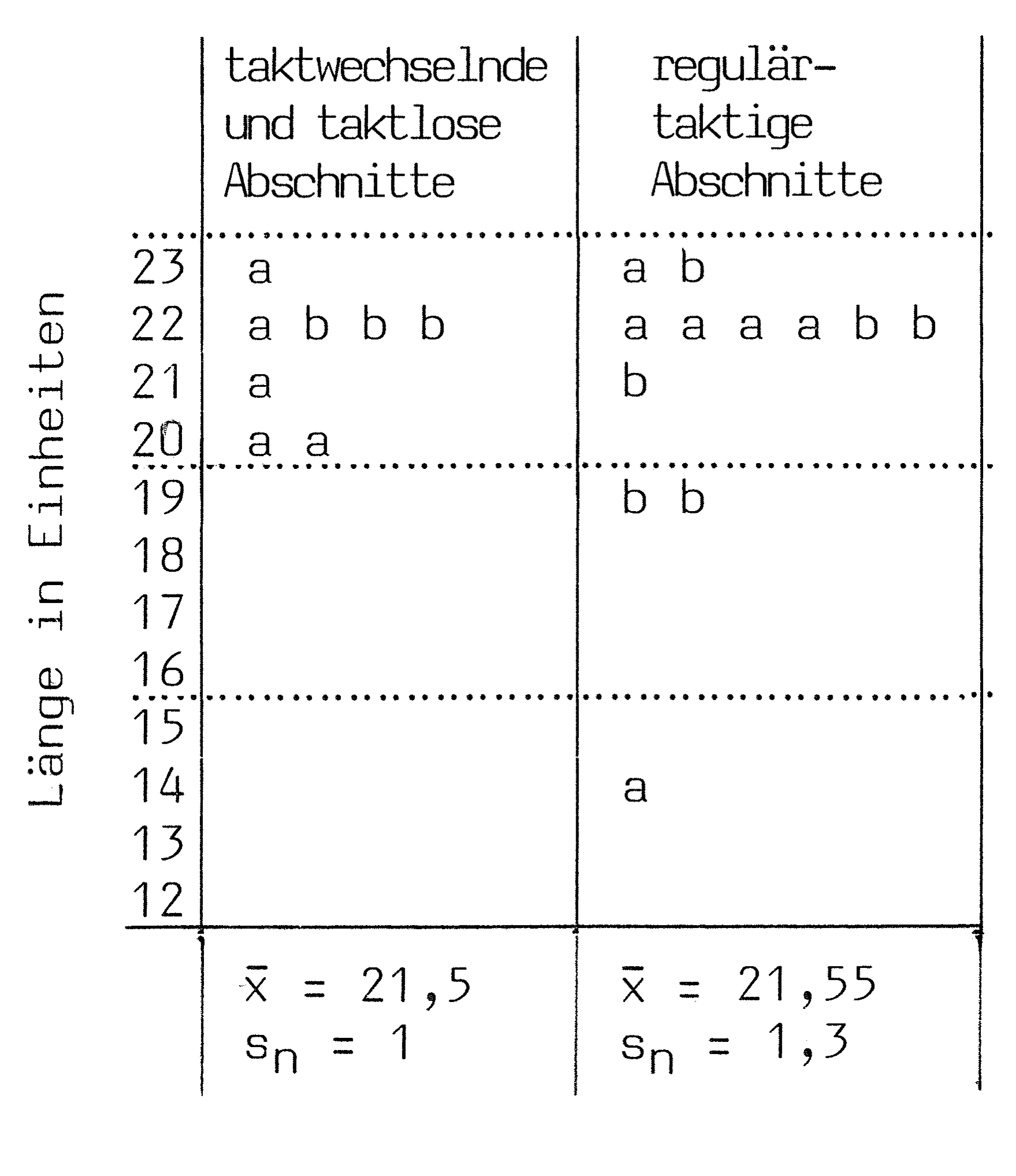
|

|
In Abb. 4 und 5 sind auch die Mittelwerte und die Standardabweichungen eingetragen. Vor ihrer Berechnung wurden die beiden Ausreißer bei 14 und bei 12 Einheiten eliminiert. Sie wären auch Ausreißer geblieben, wären sie durch Verdoppelung auf 28 und 24 Einheiten transformiert worden. (Der Ausdruck Einheit
bezeichnet in Abb. 4 und 5 die Vergleichseinheit, doch sind die Längen auch als transformierte Längen
anzusehen, da sie sich alle im Raum einer Oktave
befinden). Diese Eliminierung erschien auch deshalb gerechtfertigt, weil die beiden Ausreißer zusammengehörten (Abschnitt und seine Wiederholung).
Mittelwerte und Standardabweichungen zeigen weder in Abb.4 noch in Abb. 5 einen wesentlichen Unterschied zwischen den taktwechselnden und taktlosen und den regulärtaktigen Notationen auf.
Die statistische Untersuchung der Längen konnte bisher keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Notationen entdecken. Taktwechselnde und taktlose wie regulärtaktige Abschnitte bevorzugen dieselbe Länge. Davon abweichende Längen sind in beiden Gruppen selten.
Gesucht sind nun Hypothesen, die die große Häufigkeit von Längen um die zwanzig Vergleichseinheiten sowohl bei den taktwechselnd und taktlos als auch bei den regulärtaktig notierten Jodelweisen zu erklären imstande sind. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß diese Häufigkeit weder ein Zufallsergebnis der Feldforschung noch ein Artefakt der Transkription sein kann. Zwei Erklärungsansätze bieten sich an: ein metrisch formaler und ein physiologischer. Der metrisch-formale Ansatz behauptet, daß alle Muotataler Jodelweisen eine metrisch-formale Struktur haben, daß es im Muotataler Juuz bestimmte Formschemata gibt und daher nur solche Segmentlängen auftreten können, zu denen ein Formschema existiert, wodurch sich die große Häufigkeit bestimmter Segmentlängen erklärt. Zu denken ist natürlich an die bekannten 4‐, 8‐ und 16-taktigen Schemata im 3/4-Takt, aber auch an andere, vielleicht noch unbekannte Schemata. Der metrisch-formale Ansatz steht damit nicht nur vor der Schwierigkeit, solche Formschemata auch in den bisher als taktwechselnd oder taktlos gedeuteten Jüüzli nachzuweisen, sondern auch vor dem Problem, Abweichungen vom Formschema, wie sie etwa in Notenbeispiel 3 gegeben zu sein scheinen, erklären zu müssen.
Der physiologische oder pneumatische Erklärungsansatz behauptet, daß die Konzentration der Segmentlängen auf den Bereich um die 20 Einheiten durch die Begrenztheit der Atemluft bedingt ist. Hier muß ich etwas weiter ausholen: Der Muotataler Jodelforscher Peter Betschart sagte mir, daß die Juuzer einen Teil
eines Jodels mit einem einzigen Atem juuzen. Inmitten der Melodie Atem zu holen sei nicht Muotataler Art. Manche Juuzer schafften es sogar, einen Teil
mitsamt seiner Wiederholung in einem Atem zu juuzen. Die von Hugo Zemp herausgegebenen
110
Feldaufnahmen bestätigen und illustrieren diese Aussagen Betscharts. Auch Zemp erwähnt diese Praxis: Bei gewissen Jüüzli können die Teile auch ohne Unterbrechung wiederholt werden, vorausgesetzt die Ausführenden haben genügend Atem, um dies in einem Zug zu tun
(Zemp 1990). Der physiologische Erklärungsansatz baut auf diesen Beobachtungen auf. Er behauptet, daß die Längen der Segmente ein atemphysiologisches Optimum oder Maximum darstellen. Er fordert daher eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Länge, Tempo und Dauer der Segmente. Die Eleganz dieser Hypothese besteht darin, daß unter ihrem Blickwinkel der Unterschied zwischen Taktwechsel, Taktlosigkeit und Regulärtaktigkeit irrelevant ist: Das Optimum der Segment-Dauer ist, weil physiologisch bedingt, vom Metrum unabhängig. Allerdings ist dieser Ansatz genötigt, eine Erklärung dafür zu finden, wieso das Optimum an Länge und Dauer auch eine untere Schranke hat.
Weiters stellt ihn die Tatsache, daß Länge (ausgedrückt in Notenwerten) nicht identisch ist mit der Dauer (ausgedrückt in Sekunden), vor erhebliche Probleme.
Denn selbst wenn die Untersuchung zeigen sollte, daß die Segmentdauern sich tatsächlich um einen bestimmten Zeitwert häufen, bliebe noch immer die Frage offen, wie die Häufung der Segmentdauern eine Häufung der Segmentlängen bewirkt. In der selben Zeitdauer hätten ja – bei anderem Tempo – auch etwas mehr oder etwas weniger Zählwerte Platz. Der physiologische Ansatz müßte also zeigen, daß es außer einer bevorzugten Dauer auch ein bevorzugtes Tempo gibt. Dieses sowie die untere Schranke des Zeitdauer-Optimums müßten nicht unbedingt eine physiologische Ursache haben, die pneumatische Hypothese zielt primär auf die obere Schranke der Segment-Dauer ab und ließe für das Übrige durchaus auch kulturelle Faktoren als Erklärungen gelten.
Da für die statistische Überprüfung der physiologischen Hypothese zusätzliche Daten benötigt werden und eine neue Tabelle erstellt werden muß, wird zunächst die metrisch-formale Hypothese statistisch untersucht.
111Überprüfung der metrisch-formalen Hypothese
In dem nun folgenden Teil der statistischen Untersuchung geht es darum, herauszustellen, ob die in Tab. 1 und 2 aufgelisteten Daten mit der metrisch-formalen Hypothese verträglich sind.Der erste Untersuchungsschritt gilt der Längendifferenz zwischen Abschnitt und seiner Wiederholung und zwar jener Längendifferenz, die am Ende der Wiederholung auftritt. Sie ist in Tab. 1 und 2 in der letzten Spalte vermerkt. Die Tabellen zeigen, daß nur die Differenzen 0, 1, 3 und 4 auftreten. 1 kommt nur einmal vor, 3 tritt nur in den regulärtaktigen Notationen auf, die taktwechselnden und taktlosen Notationen weisen nur die zwei Differenzen 0 und 4 auf. (Siehe Abb. 6).
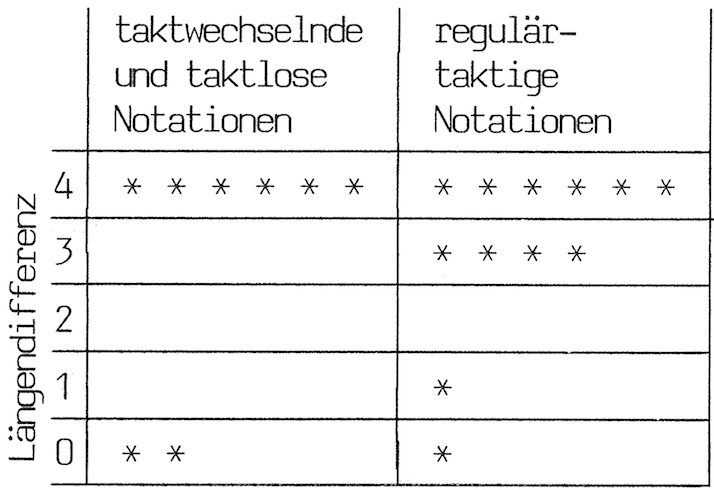
Hier zeigt sich übrigens erstmals ein Unterschied zwischen den zwei Gruppen: Die Streuung auf verschiedene Differenzen ist bei den regulärtaktigen Notationen etwas größer. Die Differenzen 3 und 1 treten nur in den regulärtaktigen Notationen auf. Um es polemisch zu formulieren: Gerade bei den als irregulär eingestuften Jüüzli ist die Regularität am größten. Ob die Längendifferenzen allerdings wirklich metrisch bedingt sind, kann die statistische Analyse nicht zeigen, sie kann bloß Verdachtsmomente bereitstellen.
Der metrisch-formale Ansatz vermutet, daß diese Differenzen metrisch relevant sind und zwar als Differenz zwischen weiblichem
Halbschluß und männlichem
Ganzschluß von periodisch gebauten Formen. Er behauptet, daß die in Abb. 6 dargestellte Verteilung dadurch zu erklären sei, daß die metrisch-formale Struktur, bei der die Differenz 3 auftritt, von den Transkriptoren häufiger erkannt wurde als diejenige, bei der die Differenz 4 auftritt. Die Transkriptoren hätten letztere Struktur oft nicht erkannt und solche Jüüz' für taktwechselnd oder taktlos gehalten. In Wirklichkeit aber hätten sie dasselbe metrisch-formale Schema wie die regulärtaktig notierten mit der Differenz 4.
Diese Vermutung werde zudem dadurch gestützt, daß all diese Abschnitte, egal ob regulärtaktig oder anders notiert, ungefähr dieselbe Länge haben.
Ein erster Einwand gegen diese Hypothese könnte lauten, daß die Größe der Differenz bloß ein notationstechnisches Artefakt sei. Daß die letzte Note vor dem Wiederholungszeichen als Finalis eines musikalischen Abschnitts empfunden werde, sei nicht erwiesen. Es gibt allerdings ein Indiz dafür: Mit einer einzigen Ausnahme steht in allen Fällen vor dem Wiederholungszeichen eine Pause oder eine überdurchschnittlich lange Note oder eine Note mit Fermate. Dasselbe ist bei den Doppelstrichen der Fall. Und da Pausen, überdurchschnittlich lange Noten und Fermaten in den Muotataler Transkriptionen Sichardts und Leutholds an anderen Stellen äußerst selten sind, dürfen sie als Indiz dafür gelten, daß vor dem Wiederholungszeichen zumindest der Transkribent eine Finalis empfunden hat. Die eine Ausnahme (Sichardt 1939: 36 Nr. Nr. 46 b und b') wird in den folgenden Untersuchungen weggelassen. Ihre Eliminierung ändert das Ergebnis nicht: Es handelt sich um eine dem Durchschnitt entsprechende regulärtaktige Form mit der Differenz 4.
Ein anderer Einwand könnte lauten, daß die in Abb. 6 dargestellten Differenzen ein durch die Definition der Vergleichseinheit erzeugtes Artefakt ist. Jedoch wird aus einer Drei durch Verdoppelungen und Halbierungen niemals eine Vier. Wegen der binären Struktur unserer Notenschrift ist der Unterschied zwischen drei Achteln und vier Achteln (oder Vierteln) nicht wegerklärbar. Auch aus der Eins können nur Zweierpotenzen werden und keine anderen Werte. Und die Null bleibt immer eine Null.
Allerdings könnte eine skeptische Gegenhypothese aufgestellt werden, die die in Abb. 6 zutagetretende große Häufigkeit der Längendifferenz 4 damit erklärt, daß es sich bei diesen Verlängerungen um Formeln handle, die an die Melodien angehängt werden und keinerlei Rückschlüsse auf die metrische Struktur der taktwechselnden oder taktlosen Jüüzli zuließen. Formeln, die vielleicht aus den regulärtaktigen Jüüzli, bei denen sie durchaus ins metrische Schema passen können, ins taktwechselnde oder taktlose Repertoire übernommen wurden. Jedenfalls dürfe, selbst wenn sich herausstellte, daß bei den regulärtaktigen Jüüzli diese Schlußformeln in metrische Schema passen, nicht der Umkehrschluß gezogen werden, daß alle Jüüzli mit der Längendifferenz 4 regulärtaktig seien. Und darüberhinaus könne nicht als erwiesen gelten, daß die regulärtaktig transkribierten Jüüzli wirklich regulärtaktig seien, ihre Regulärtaktigkeit beruhe möglicherweise auf einer Fehlinterpretation der Transkribenten.
113Die damit aufgeworfene Frage nach dem Zusammenhang zwischen Formschemata, Längendifferenzen und Taktarten kann die statistische Methode nur hinsichtlich der in den Transkriptionen ausgewiesenen Längenverhältnissen, Taktarten und Taktanzahlen beantworten.
Zunächst wurde der Zusammenhang zwischen Segmentlänge und Längendifferenz untersucht. Hierzu wurde von jedem der 19 Segmentpaare das erste Segment genommen und in Abb. 7 die Längen gegen die Längendifferenzen aufgetragen.
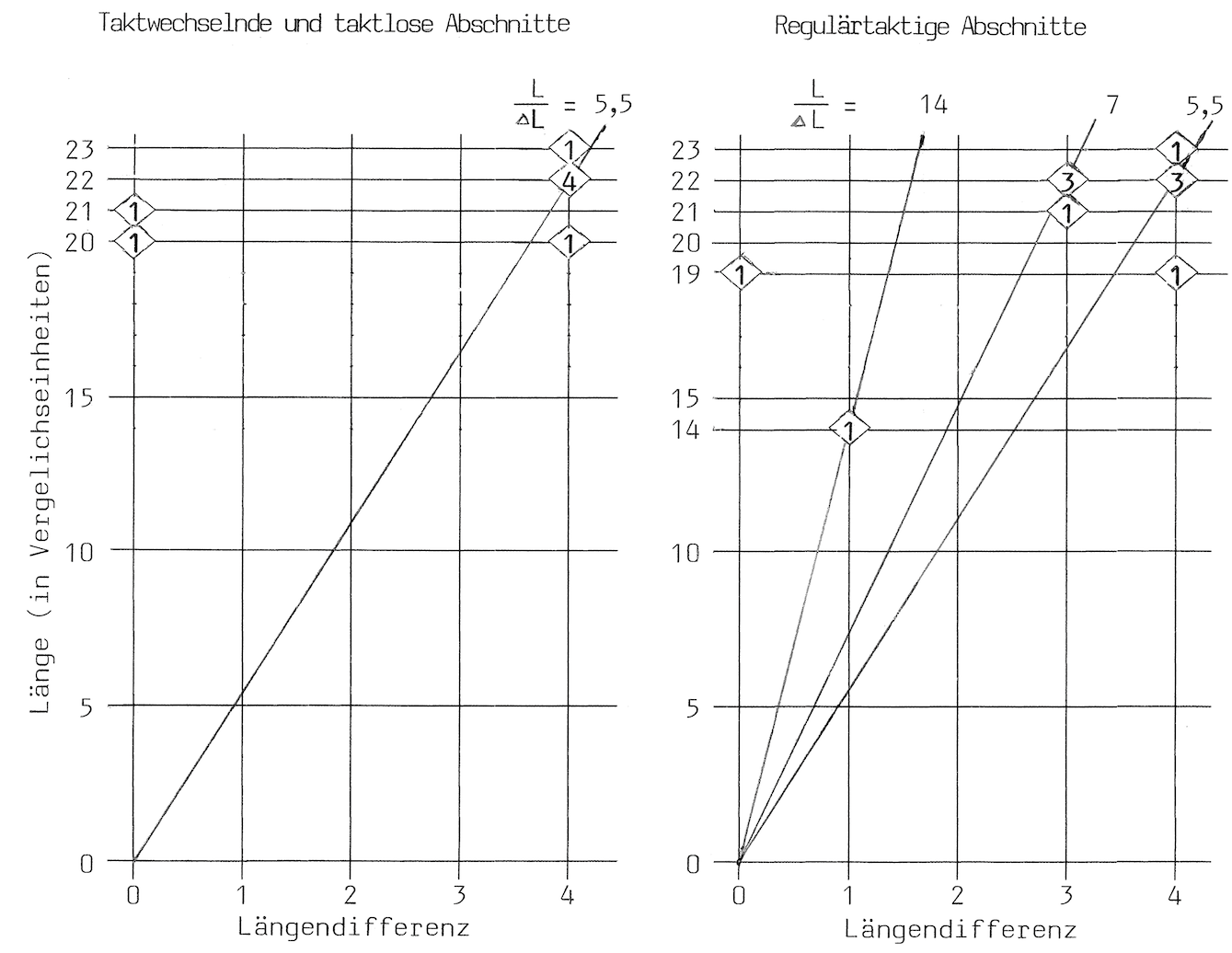
Diese Abbildung zeigt, daß die Längendifferenz keineswegs etwa linear mit der Länge ansteigt. Vielmehr lassen sich nach dem Verhältnis Länge/Längendifferenz deutlich vier Arten unterscheiden. Dieses Verhältnis ist von der Definition der Vergleichseinheit, ja sogar von der binären Ordnung des Notensystems
114
und d.h. von der Transformation durch Halbierungen und Verdoppelungen unabhängig. (Das Verhältnis bliebe dasselbe, wenn man etwa statt mit Verdoppelungen und Halbierung mit Verdreifachungen und Drittelungen die Daten transformierte). Jedem notierten Jüüzlisegment mit Wiederholung läßt sich eindeutig die Maßzahl Länge/Längendifferenz zuordnen. Die Verteilung dieser Maßzahlen (Abb. 8) ist multimodal, die vier Arten lassen sich deutlich unterscheiden. Taktwechselnde, taktlose sowie regulärtaktige Abschnitte werden hier nicht unterschieden:
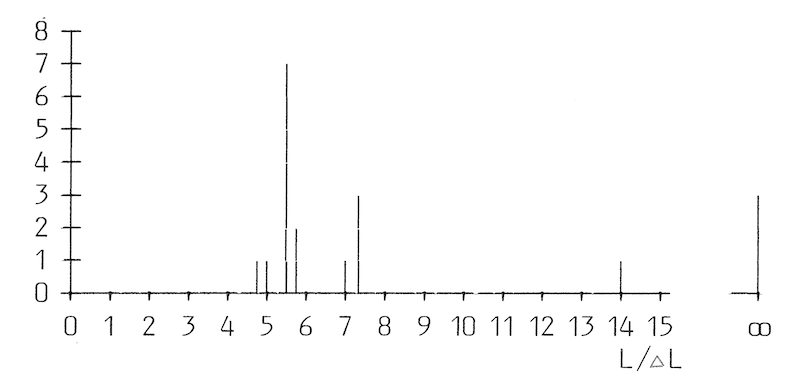
Doch seien die vier Arten besser an Hand der Abb. 7 diskutiert, da sie mehr Informationen enthält. Die erste Art mit der Längendifferenz Null und der Verhältnismaßzahl Unendlich ist für die metrisch-formale Hypothese irrelevant. Die 2. Art ist das eine Segment mit der Länge 14 und der Längendifferenz 1. Es handelt sich um das Segment, das schon einmal seiner abweichenden Länge als Ausreißer auffiel (Abb. 4) und nun auch in der Längendifferenz eine Sonderstellung einnimmt, weil es als einziges Segment die Längendifferenz 1 hat. Interessant sind vor allem die 3. Art mit der Längendifferenz 3 und die 4. Art mit der Längendifferenz 4. Es handelt sich um die beiden umfangreichsten Gruppen. Sie unterscheiden sich nur in ihrer Längendifferenz und ihrer durchschnittlichen Längenverhältnismaßzahl, nicht jedoch in ihrer durchschnittlichen Länge. Die dritte Art ist ausschließlich regulärtaktig notiert, die 4. Art sowohl regulärtaktig als auch taktwechselnd und taktlos. Wie bereits erwähnt, vermutet der metrisch-formale Ansatz, daß diese beiden Arten sich im Metrum unterscheiden und daß das Metrum der 4. Art oft nicht erkannt wurde.
Diese Vermutung legt es nahe zu untersuchen, welche Taktarten und Taktanzahlen in den regulärtaktig transkribierten Jüüzliabschnitten vorkommen. Sollte sich herausstellen, daß Notationen der 3. und 4. Art zwei verschiedene Taktarten aufweisen, dann wäre die Vermutung des metrisch-formalen Ansatzes zwar 115 nicht verifiziert, er hätte aber wenigstens einen ersten Anhaltspunkt dafür gewonnen, welches Metrum hinter den taktwechselnden und taktlosen Notationen stehen könnte.
Die Verteilung der regulärtaktig transkribierten, wiederholten Abschnitte (Abb. 9) zeigt, daß die Abschnitte mit der Längendifferenz 3 ausschließlich im 3/4 Takt notiert wurden, während die Abschnitte mit der Längendifferenz 4 teils im 3/4, teils im geraden Takt geschrieben sind.
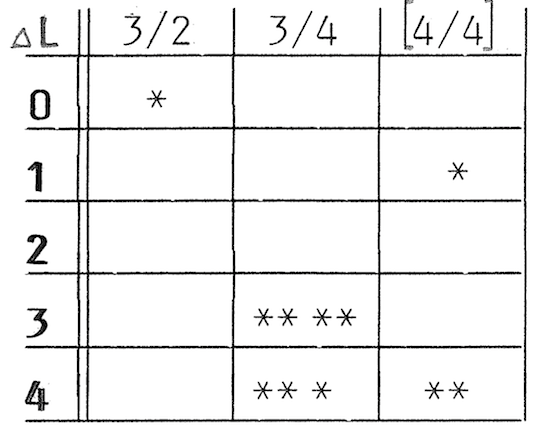
Jeder Stern steht für einen wiederholten Abschnitt.
Die Streuung der Abschnitte mit der Längendifferenz 4 ist indes noch größer, wenn man die Taktanzahl, also das metrische Formschema, mitberücksichtigt.
(Siehe Abb. 10):
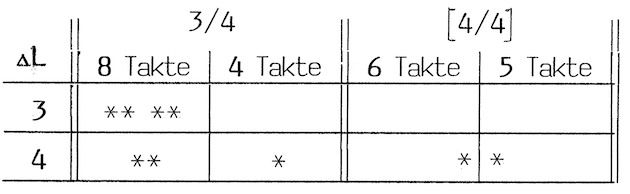
Die 21 bis 23 Vergleichseinheiten sind in den achttaktig notierten Abschnitten ternär, im viertaktig notierten Abschnitt binär organisiert:
Achttakter: a: x| xxx|xxx | xxx|xxx | xxx|xxx |xxx|x(x) || (Zemp 1990: 3d und 11c)
a': x| xxx|xxx | xxx|xxx | xxx|xxx |x |]
Viertakter: a: x|xx xx xx |xx xx xx |xx xx xx |xx xx x || (Sichardt 1939: Nr. 48)
a': x|xx xx xx |xx xx xx |xx xx xx |x |]
(Die Wiederholungen sind um 3 bzw. 4 Vergleichseinheiten kürzer. Die Wiederholung der Achttakter hat sieben Takte. Der in der achttaktigen Form in Klammer gesetzte weibliche Schluß tritt nur bei der Längendifferenz A auf).
116
Die geradtaktigen Deutungen haben folgende Struktur:
a, (b): (|xx x)x|xx xx|xx xx|xx xx|xx xx|xx x || a', (b'): (|xx x)x|xx xx|xx xx|xx xx|xx x |] (Sichardt 1939:Nr. 50)Alle grundsätzlichen Möglichkeiten der abendländischen Musiktradition, 22 Einheiten in eine metrische Form zu bringen, wurden hier ergriffen, – fragt sich nur, ob von den Muotataler Juuzern oder von Wolfgang Sichardt.
Die Hoffnung des metrisch-formalen Ansatzes, aus den regulartaktigen Transkriptionen ein Schema abziehen zu können, das er dann auf die taktwechselnden und taktlosen Notationen nur noch zu applizieren bräuchte, haben sich nicht erfüllt. Das bedeutet freilich nicht seine Falsifikation, vielmehr zwingt es den metrisch-formalen Ansatz zur Radikalisierung seiner Hypothese: Das Mißtrauen sei auf die regulärtaktigen Transkriptionen auszudehnen. Zumindest was die Abschnitte betreffe, die eine Länge um die 22 Einheiten und eine Längendifferenz zur Wiederholung von 4 Einheiten haben, gäben auch die regulärtaktigen Notationen das Metrum nicht richtig wieder. Von den drei oben aufgelisteten Lösungen könne bestenfalls eine richtig sein. Oder es seien alle falsch.
Seinen radikalen Zweifel sieht der metrisch-formale Ansatz bestärkt durch Differenzen in den Deutungen der einzelnen Autoren, die gerade bei zwei von den drei oben angeführten Jodeln auftreten. Alfred Leonz Gaßmann deutet die metrische Struktur einer Variante genau umgekehrt wie Sichardt. Vergleiche Notenbeispiel 21 mit Notenbeispiel 22: Sichardts ternär organisierte Vierteln sind bei Gaßmann binär organisierte Achteln im 3/4 Takt. Und eine Variante des von Sichardt geradtaktig aufgefaßten Stückes findet sich bei Leuthold und zwar ebenfalls mit binären Achteln im 3/4 Takt, vergleiche Notenbeispiel
23 mit Notenbeispiel 24. Leuthold gibt hier ein Kurzgsätzli
wieder, das besonders beliebt war bei uns Schulbuben
(Leuthold 1981: 96). Höchstwahrscheinlich hat auch er selbst diesen Jodel gesungen, jedenfalls muß hier der Aufzeichnung des Metrums ein Höchstmaß an Authentizität zuerkannt werden, so sehr man Leutholds Auffassungen in anderen Dingen auch bezweifeln mag. Leuthold berichtet unter Berufung auf Gaßmann, daß dieser Jodel auch im Kanton Schwyz bekannt sei (Leuthold 1981: 97). Auf Sichardts Deutung des Tonsystems dieses Jodels, die auch von seinen übrigen Muotataler Transkriptionen stark abweicht, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

|

Gesungen von den Schwestern Agnes und Agata Zurmühle, Weggis﹘Mätteli 1906(Gaßmann 1961: 311). |
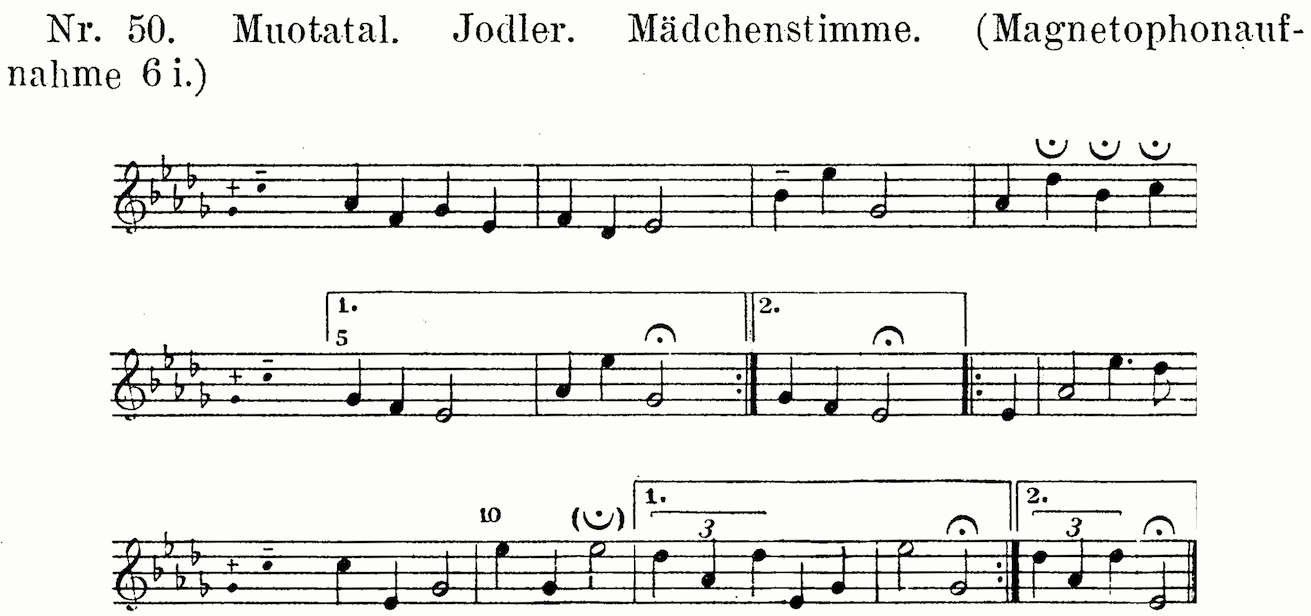
Kurzgsätzli(Leuthold 1981: 96).
Im Kanton Schwyz ist der Ruf als, schreibDelä-delä-Jodelbekannt
Auf der von Hugo Zemp herausgegebenen CD befinden sich 2 weitere Varianten dieser Melodie (Zemp 1990: 3d und 11c).
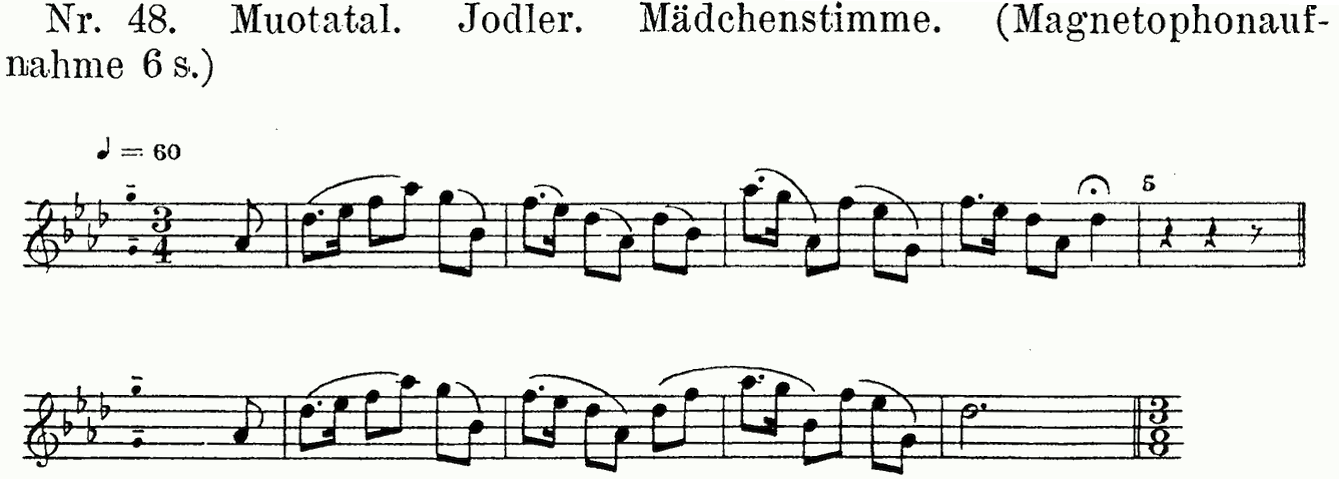
Kurzgsätzliwohl schwerlich bezweifelt werden kann, wäre das Formschema für die fraglichen Segmentpaare wie folgt aufzustellen:
a': = 18 Einheiten + Schlußton
Die Aufstellung des Formschemas und die mit ihm verknüpfte metrisch-formale Vermutung ist freilich nicht unangreifbar: Von den zwei der Schemakonstruktion zugrundeliegenden Beispielen gebe nur eines zweifelsfrei das intendierte Metrum an. Die Annahme, auf der allein die Schemakonstruktion vorläufig beruht, nämlich daß die Zentralschweizer Forscher das Jodelmetrum besser verstanden hätten als Sichardt, werde widerlegt durch die mit dem konstruierten Schema verknüpfte Hypothese, gewisse Jodel seien im Sinne des Schemas metrisch intendiert. Denn die Hypothese spreche dem Zentralschweizer H. J. Leuthold ab, den Jodel Notenbeispiel 13 richtig gedeutet zu haben. Warum sollte A. L. Gaßmanns Notationen ein größeres Vertrauen entgegengebracht werden? Von einer Annahme, die sich selbst widerlegt, sei nicht viel zu halten. Der Hinweis auf das häufige Vorkommen dieses metrischen Formschemas in Jodel 120 aufzeichnungen sei zwar richtig, doch sei das notierte Metrum nicht deskriptiv, sondern hypothetisch, es sei eine von der Kunstmusik oder Tanzmusik hergeholte, künstlich auf die Jodel applizierte metrische Ordnung. Zudem beruhe das vorgeschlagene Verfahren der Schemaapplikation vorerst allein auf der numerischen Passung von Jodel und Schema. Die inhaltliche Passung müsse erst noch gezeigt werden. Gerade aber mittels inhaltlicher Analyse sei im theoretischen Kapitel die potentielle Mehrdeutigkeit an einigen Jodeln bereits demonstriert worden und aufgezeigt worden, daß auch andere als tanzmusikschemakonforme metrische Auffassungen möglich sein könnten. Und dies sei das Hauptargument: Tradiert würden Musikstücke, nicht Formschemata, und es wäre sehr ungewöhnlich, wenn eine funktional ungebundene, weder einer choreographischen Abfolge noch dem Versmaß eines Textes verpflichtete Gattung sich sklavisch an metrisch-formale Schemata hielte. Und selbst wenn die Jodelmelodien tatsächlich von instrumentalen Tanzweisen abstammen sollten, (was vielleicht das Vorherrschen bestimmter Segmentlängen erklären könnte), so wäre noch immer mit einer Variantenbildung zu rechnen, die den Jodel von seiner ursprünglichen metrischen Ordnung entferne, (vielleicht ohne daß sich seine Länge nennenswert ändere). Die zugegebenermaßen erklärungsbedürftige Häufigkeit bestimmter Segmentlängen könnte möglicherweise eine andere Erklärung finden als durch die Annahme metrisch-formaler Schemata als Konzepte und Deutungsmuster der Juuzer oder durch die Abstammung der Jodel von der Instrumentalmusik. Unwahrscheinlich sei auch, daß die Konzepte der Juuzer so unsinnlich-abstrakt sein sollten wie die aus inhaltsleeren Schwer‐ und Leichtzeiten bestehenden metrischen Formschemata. Binde man aber, wie es im Theoriekapitel geschah, den Schwerzeitbegriff inhaltlich, z. B. an die Harmoniewechsel oder den Wechsel der als führend empfundenen Töne, dann erscheine es noch fragwürdiger, aus einer bloß numerischen Tatsache weitreichende Folgerungen zu ziehen. Zudem sei nicht erwiesen, daß dem für diese Folgerungen so wichtigen Unterschied zwischen der Längendifferenz von drei und der von vier notierten Einheiten überhaupt eine metrische Bedeutung zukomme, – er könnte durch ausgeschriebene Ritardandi verursacht sein. Das könne nur an klingendem Material überprüft werden. Mit einem Wort: Beim derzeitigen Stand der Untersuchung sei der metrisch-formale Ansatz bestenfalls zu einer vagen Vermutung gediehen, die den Namen Hypothese nicht verdiene.
Es gibt natürlich einen Grund dafür, weshalb ich für die statistische Untersuchung nicht meine eigenen Transkriptionen, die dieselben Häufigkeitsverteilungen ergeben würden, herangezogen habe: Es könnte behauptet werden, daß diese Verteilungen nur deshalb zustande kämen, weil ich das Material in bestimmte Taktschemata gedrängt
hätte. Gegen die taktwechselnden und taktlosen Transkriptionen kann dieser Vorwurf, der seit Max Peter Baumann (Baumann 1976) im Raum steht, schwerlich erhoben werden. Sie sind daher das ideale Material für die
121
Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten, die ohne das bewußte Zutun der Transkribenten hinter ihrem Rücken
, das heißt in den Jodelmelodien selbst,vorhanden sind.
Welche Gesetzmäßigkeiten das sind, darüber kann man beim jetztigen Stand der Untersuchung verschiedener Meinung sein. Der metrisch-formale Ansatz braucht lediglich konstatieren, daß die bisherigen Ergebnisse seiner Hypothese nicht widersprechen. Sie erlauben ihm sogar die Präzisierung der Hypothese: Die Ausreißer
um die Länge von 13 und 26 Vergleichseinheiten seien geradtaktige
4‐ und 8-Taktgruppen. Die übrigen Formen um die Länge von 20 und 40 Vergleichseinheiten stünden im Dreiertakt,wobei zwei Fälle zu unterscheiden seien: Ist der weibliche Schluß des Vordersatzes einer periodisch gebauten Form 3 Vergleichseinheiten länger als der männliche Schluß des Nachsatzes, so sind die Vergleichseinheiten ternär, ist der weibliche Schluß des Vordersatzes 4 Vergleichseinheiten länger als der männliche Schluß des Nachsatzes, so sind die Vergleichseinheiten binär organisiert. Es handle sich somit um in der musica alpina überaus gewöhnliche Formschemata, wie sie nicht nur in Jodeltranskriptionen, sondern auch in der Tanzmusik vorkommen und wie sie in Notenbeispiel 1, 2 und 12 sichtbar sind.
Und in Anbetracht der spektrographischen Meßergebnisse sei davon auszugehen, daß der Unterschied zwischen den Längendifferenzen 3 und 4 nicht auf Ritardandi oder Rubati, sondern auf echte Zählzeitdifferenzen zurückgeht. Zusammen mit den spektrographischen Meßergebnissen bilde die statistische Untersuchung eine Indizienkette, die die metrisch-formale Hypothese aussichtsreich genug erscheinen lasse, um sie auch inhaltlich zu prüfen. Und was die Konzepte der Juuzer anlange: der metrisch-formale Ansatz habe niemals von Konzepten gesprochen, sondern von metrisch-formalen Strukturen und von Formschemata. Ob diese Formschemata konzeptualisiert sind und als Konzepte die gezeigten Häufigkeitsverteilungen unmittelbar verursachen oder ob nur die einzelnen Jodelmelodien konzeptualisiert sind, – ihr schemakonformer Aufbau bedürfte dann einer zusätzlichen Erklärung –, sei jetzt noch gar nicht die Frage. Zuerst müsse gezeigt werden, ob die Formschemata überhaupt inhaltlich passen.
Hier könnte eingewendet werden, daß die vielen Abweichungen von den Formschemata, wie sie sogar in den Jodelaufzeichnungen der klassischen Volksliedforschung, etwa bei A. L. Gaßmann, nicht jedoch in der Tanzmusik vorkämen, doch zeigten, daß beim Jodel keine Formschemata konzeptualisiert seien. Es habe wenig Sinn, nach Formschemata zu suchen, die im Bewußtsein der Juuzer gar nicht vorhanden sind. Ein solches Unternehmen produziere Artefakte, die keine Erklärungskraft besäßen. Genau darum gehe es jedoch: um eine Erklärung der auffälligen Häufigkeiteverteilung der Längen von Jüüzlitranskriptionen.
122Überprüfung der pneumatischen Hypothese
Um den Zusammenhang zwischen Länge, Tempo und Dauer studieren zu können, wurden aus den Transkriptionen diejenigen ausgewählt, die Metronomangaben enthalten.
Die für die Untersuchung relevanten Eigenschaften wurden in Tabelle 3 aufgelistet. Der Begriff Segment
wurde der Fragestellung entsprechend neu definiert. Nicht auf Formabschnitte kam es hier an, sondern auf in einem Atemzug durchgesungene Passagen. Daher wurden diesmal nicht nur Doppelstriche und Schlußstriche, sondern auch das im Sinne der Transkriptionstradition der Berliner Schule als Atemzeichen gedeutete Zeichen " als Segmenttrennung gewertet. Wiederholungszeichen wurden nur dort als Segmenttrennung aufgefaßt, wo davor eine Pause oder eine ungewöhnlich lange Note steht. (Dadurch entfielen zwei Segmenttrennungen, die in Tabelle 1 und 2 enthalten sind). In 10 der 30 in Tabelle 3 aufgelisteten Fälle gibt das Notenbild kein ausreichendes Indiz dafür her, ob beim Trennungszeichen wirklich geatmet wurde, weil davor keine Pause steht. Eingedenk der Aussagen von Hugo Zemp (Zemp 1990) und Peter Betschart, aus denen hervorgeht, daß vor einem melodisch neuen Teil immer geatmet wird, sind unter den zehn Fällen nur vier echte Zweifelsfälle (Nr. 20 a und b, Nr. 21 a und Nr. 22 b). Unter der Annahme, daß nicht geatmet wird, ergaben sich Segmentdauern zwischen 27 und 30 Sekunden.
Da auf der von Hugo Zemp herausgegebenen CD die Segmentdauer in solchen Fällen nur etwa 20 Sekunden beträgt (Zemp 1990: Nr. 3b und c, 9b), erschien diese Annahme unplausibel. Deshalb wurde unterstellt, daß die Ausführenden vor der Wiederholung geatmet haben.
Ich hätte statt Sichardts Transkriptionen auch meine eigenen, die auf die Frage der Atempausen genauer eingehen, zugrundelegen können, doch erschien es mir unangebracht, das sample mitten in der Untersuchung auszuwechseln. Es ist ohnenhin bereits kleiner als das von Tab. 1 und 2, da Leuthold keine Metronomangaben macht und auch Sichardt dies bei einigen Transkriptionen unterläßt.
Das sample enthält daher ausschließlich Transkriptionen von Wolfgang Sichardt.
Auch die Segmentlänge wurde in Tab. 3 anders berechnet: Erstens wurde diesmal auch der Schlußton mitgezählt. Die Fermaten wurden hierbei aber nicht berücksichtigt. Zweitens wurden statt der eingangs definierten Vergleichseinheiten jetzt diejenigen Einheiten gezählt, auf die sich die Metronomangabe bezieht. Zuvor wurden zwecks Homogenisierung des Materials die drei niedrigsten Metronomwerte verdoppelt, z. B. = 120 statt = 60. Das erschien auch inhaltlich gerechtfertigt, weil die halb so kleine Einheit in diesen Transkriptionen tatsächlich vorkommt, in zwei davon sogar als häufigster Wert. Sodann wurde aus der Länge und dem Metronomwert die Zeitdauer der Segmente berechnet.
123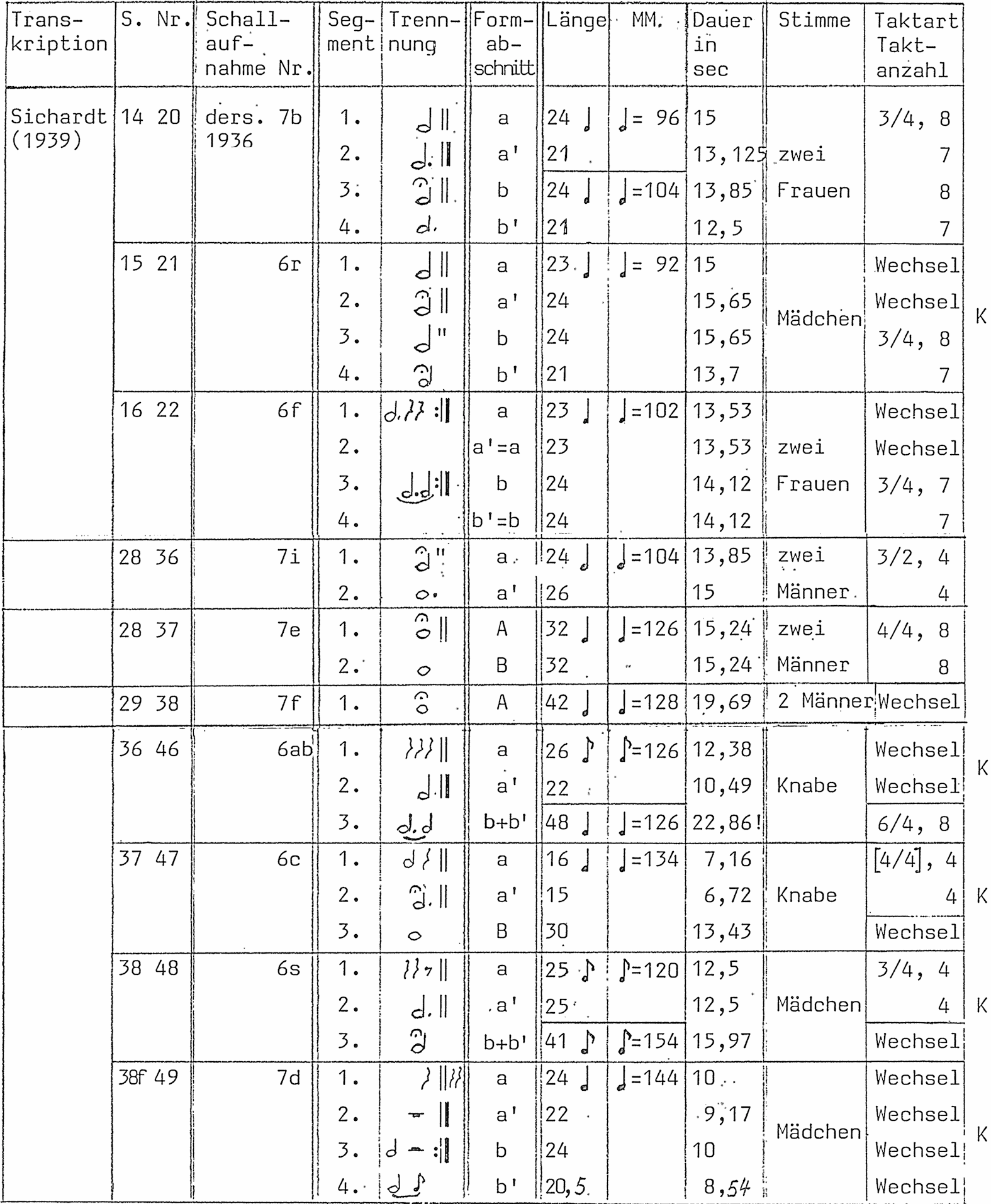
Teilmit einem Atem zu singen, auch im Jahr 1936 schon üblich war. Das ist deshalb höchst wahrscheinlich, weil in Sichardts Transkriptionen zwischen Vorder‐ und Nachsatz von periodisch gebauten Formen häufig längere Pausen notiert sind, während inmitten des Melodieverlaufs keine Pausen vorkommen (mit Ausnahme einer Achtelpause in Nr. 47). Dieses durch das Atemholen bedingte Auseinanderreißen von Vorder‐ und Nachsatz ist auch auf der von Zemp herausgegebenen CD (Zemp 1990) zu hören. In anderen alpenländischen Jodellandschaften ist dieses Auseinanderreißen nicht zu beobachten und es wird auch inmitten des Melodieverlaufs Luft geholt. Den Transkriptionen Sichardts nach zu schließen dürfte der Muotataler Interpretationss
Zu beachten ist allerdings, daß etwa die Hälfte von Sichardts Muotataler Jodelaufnahmen mit Kindern gemacht wurden (Marie und ? Ablondi). Deren Tempi sind im Durchschnitt um 10 Metronomeinheiten schneller als die der Erwachsenen und das bereits ohne Miteinrechnung des Bücheljuuz Nr. 45 B, der auch auf der CD (Zemp 1990: 3h) von Frau Suter﹘Gwerder sehr schnell gejuuzt wird. Ein langsameres Tempo der Erwachsenen zeigt auch der Variantenvergleich Nr. 37 ﹣ Nr. 47, nicht jedoch Nr. 38 ﹣ Nr. 46. Ob dieser Unterschied statistisch signifikant ist, wurde nicht untersucht. Es liegt ohnehin nahe, das Material in zwei Gruppen zu teilen: die Jodel der Kinder und die Jodel der Erwachsenen. Die Jodel der Kinder umfassen 5 Nummern mit insgesamt 17 Segmenten, die Jodel der Erwachsenen 5 Nummern mit insgesamt 13 Segmenten.
Auffallend ist, daß die taktwechselnd notierten Segmente ungleich auf die beiden Gruppen verteilt sind: Der Anteil der Kinder an den gesamten 30 Jodelsegmenten ist 57%, an den taktwechselnd notierten jedoch 77%. Um diesen Zusammenhang genauer untersuchen zu können, wurde kurz auf die umfangreichere Gesamtheit von Tab. 1 und 2 zurückgegriffen, und zwar auf die einzelnen Melodien, d.h. a und a' wurden als eine Einheit A gerechnet, b und b' als eine Einheit B. Greift man lediglich die Transkriptionen Sichardts heraus und läßt die Notationen Leutholds beiseite, so zeigt sich folgende Verteilung:
| Kinder | Erwachsene |
taktwechselnd notierte Melodien | 6 | 2 | 8
regulärtaktig notierte Melodien | 10 | 6 | 16
Summe | 16 | 8 | 24
vorgregorianisch
eingestuften Jodeln.
Hierbei wurden die 13 Muotataler Jodeltranskriptionen Sichardts als Gesamtheit
125
genommen:
| Kinder | Erwachsene |
vorgregorianische Jodel | 6 | 0 | 6
übrige Jodel | 2 | 5 | 7
Summe | 8 | 5 | 13
vorgregorianischen
Jodel der Sichardtschen Aufnahmen stammen von den beiden Ablondi-Kindern. Daß Sichardt die bereits erwähnten Männer-Varianten (Nr. 36 und 37) der vorgregorianischen
Knaben-Interpretationen (Nr. 47 und Nr . 46) stilistisch nicht ebenfalls der Vorgregorianik, sondern dem Mittelalter zuordnete, dürfte an der Zweistimmigkeit liegen, die Sichardt als volkstümliche Abwandlung ältesten abendländischen Organalstils
(Sichardt 1939: 27) ansah.
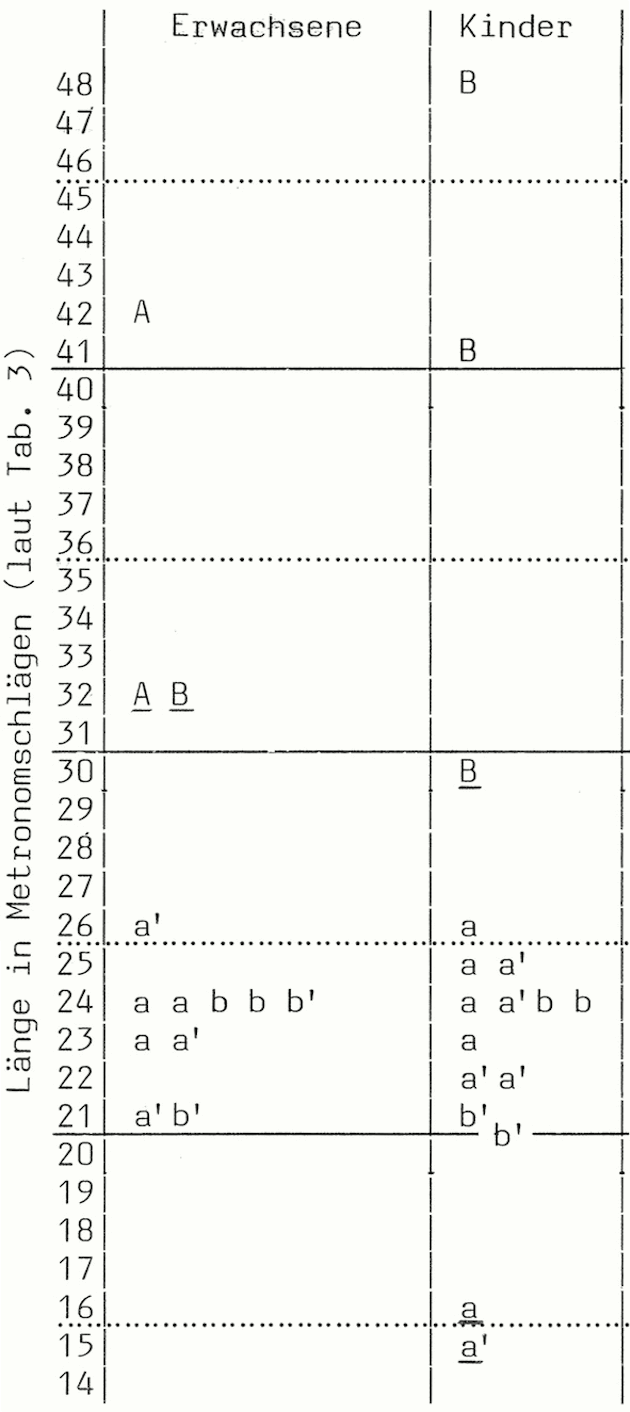
Laut der pneumatischen Hypothese ist die Häufung der Segmentlängen im Bereich von 20,5 bis 26 Einheiten durch eine optimale Segmentdauer und ein bevorzugtes Tempo bedingt. Ein solches zeigen die Transkriptionen jedoch nicht auf, wie in Abb. 12 zu ersehen ist.
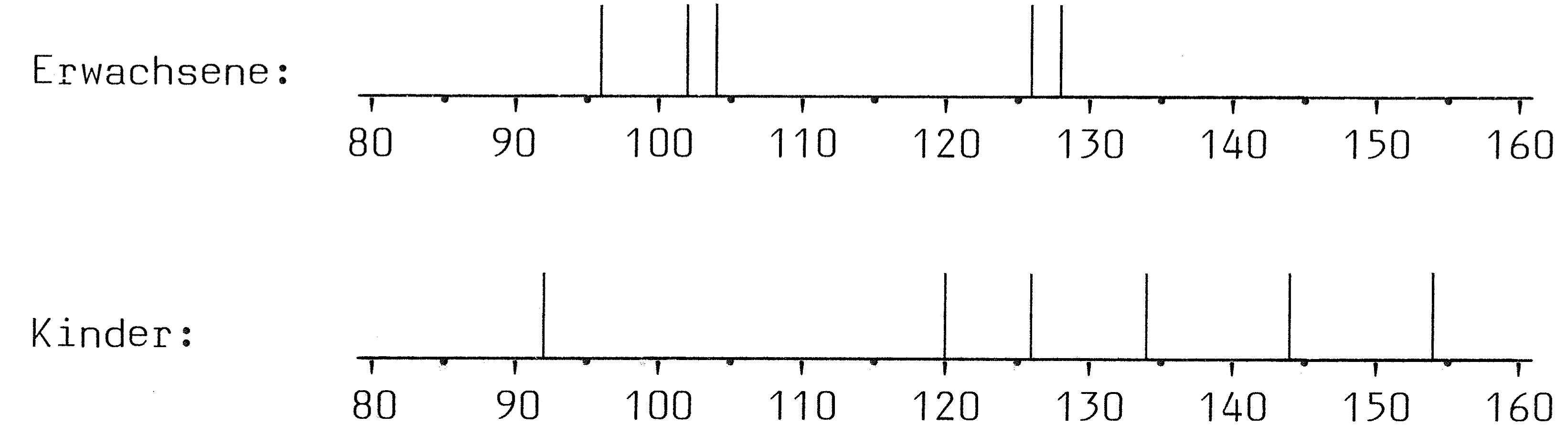
Damit ist der physiologische Ansatz nicht widerlegt, vielmehr verfeinert er seine Hypothese und behauptet, das bevorzugte Tempo der Erwachsenen liege um den Metronomwert 100 und die höheren Tempi um 128 dienten dazu, Abschnitte samt Wiederholung in einem Atemzug zu juuzen. Sie dienten ferner dazu, das Stück mit der ungewöhnlichen Länge von 32 Einheiten zu bewältigen, diese seltene Ausnahme sei jedoch für die Hypothese nicht relevant. Über die Tempowahl der Kinder ließe sich vorerst wenig sagen außer daß es sich beim Jodel um Erwachsenenmusik handle, die von den Kindern nach ihren psychologischen und physiologischen Möglichkeiten imitiert werde, was die Streuung der Tempi verursachen dürfte. Die Kausalität sei nun die: Eine optimale Atemsegmentdauer von 14 Sekunden und ein bevorzugtes Tempo von MM=100 bewirke, daß sich im Muotataler Jodelrepertoire Melodien durchsetzen, die eine Länge von um die 23,5 Einheiten haben (bzw. ohne Schlußton um die 20 Einheiten). So erkläre sich die in Abb. 1 und Abb. 11 dargestellte große Häufigkeit solcher Melodien.
127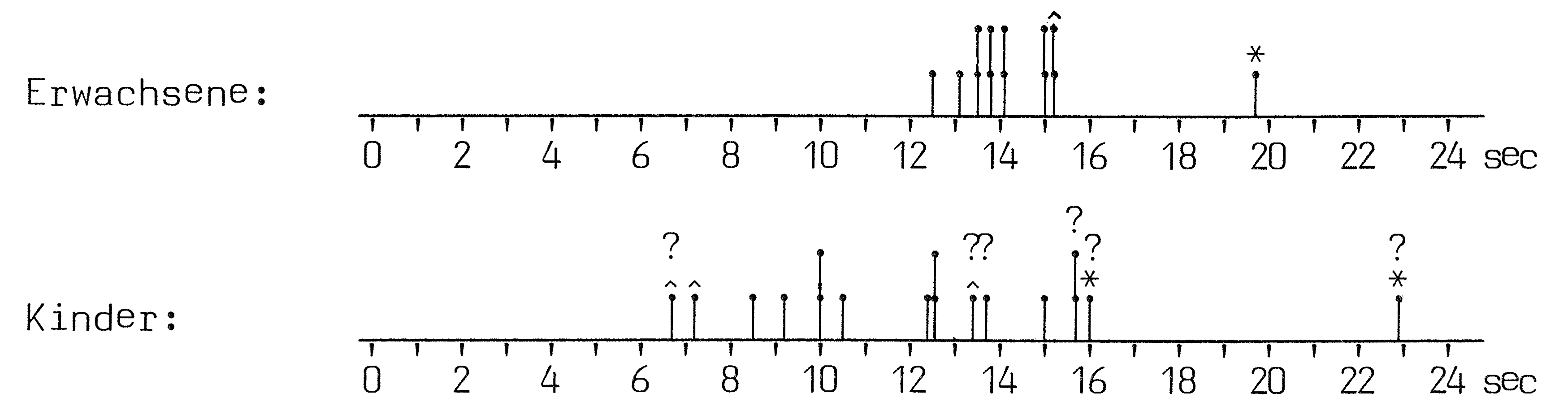
^ Segmentfamilie mit abweichender Länge,
* musikalischer Abschnitt + Wiederholung in einem Atemzug.
? Zweifelsfälle
Wie schon auf Grund der Metronomwerte zu erwarten war, ist die Streuung der Segmentdauern bei den Kindern erheblich größer. Bei 7 Segmenten ist es unsicher, ob sie wirklich in einem Atemzug gejuuzt wurden, ob nicht das Wiederholungszeichen in Nr. 46 B und 48 B und das Zäsurzeichen " in Nr. 21 a', b und b und in Nr. 47 B doch als Atempause zu verstehen wären. Und in Nr. 47 a' steht inmitten der Melodie eine Achtelpause. Van dem Zweifel sind die vier höchsten Dauerwerte der Segmente der Kinder betroffen. Unter Ausklammerung der sieben bezweifelten Fälle ergibt sich ein Mittelwert von 10,8 Sekunden bei einer Standardabweichung von sn−1 = 2,3 sec.
Zur Veranschaulichung sei ein Länge-Dauer-Streudiagramm der Jodelsegmente der Erwachsenen angefügt (Abb. 14).
Fünf Jodeltranskriptionen mit sechs Metronomangaben sind freilich eine zu schmale Grundlage, um hier von einer Stützung der pneumatischen Hypothese sprechen zu können. Doch selbst wenn sich das Ergebnis mit einer größeren Stichprobe wiederholen ließe, stützte es nicht unbedingt diese Hypothese, weil sich dieselben Daten auch auf andere Weise erklären ließen. Jede der drei Größen Länge, Tempo und Dauer könnte die von den beiden andern abgeleitete sein. Es läge daher
128
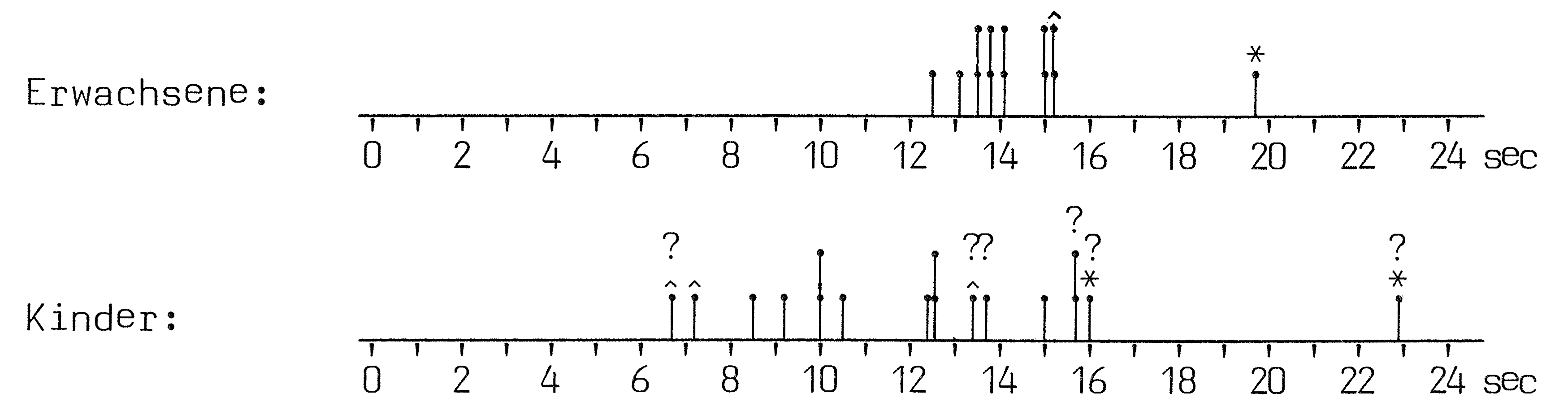
Diese ist schon eine sehr spezielle Gegenhypothese, vielleicht wären noch andere konstruierbar. Anzumerken ist, daß jede Gegenhypothese auf den metrisch-formalen Ansatz zurückführt. Denn jede Negation der Annahme, daß unter den drei Größen 129 die Länge die abgeleitete ist, muß sie als vorgegebene Größe betrachten und steht alsdann vor dem Problem, die Häufigkeit bestimmter Längen bei taktwechselnd und taktlos notierten Jüüzli irgendwie erklären zu müssen. Und da wohl kaum anzunehmen sein wird, daß die Muotataler beim Juuzen die Töne zählen, bleibt nur die Möglichkeit, die Wirksamkeit von Formschemata zu unterstellen. Diese wiederum dürfen nur eine geringe Variation der Länge zulassen, was nahelegt anzunehmen, daß sie durch ein Metrum und eine Taktanzahl konstituiert sind.
Die in Abb. 11 bis 14 dargestellten Verteilungen lassen also sowohl die pneumatische als auch die metrisch-formale Hypothese zu, sie bieten keine Entscheidungsgrundlage. Die Untersuchung könnte nun entweder mit einer Statistik der größeren Materialfülle meiner eigenen Transkriptionen fortsetzen oder in die Analyse der musikalischen Formen einsteigen. Ich werde die letztere Möglichkeit wählen (zweiter, noch nicht veröffentlichter Teil meiner Arbeit).
Was an dem in Tab. 3 zusammengestellten Material noch gezeigt werden kann, ist der allgemeine Zusammenhang zwischen der Streuung der Segmentlängen und der Streuung der Segmentdauern:
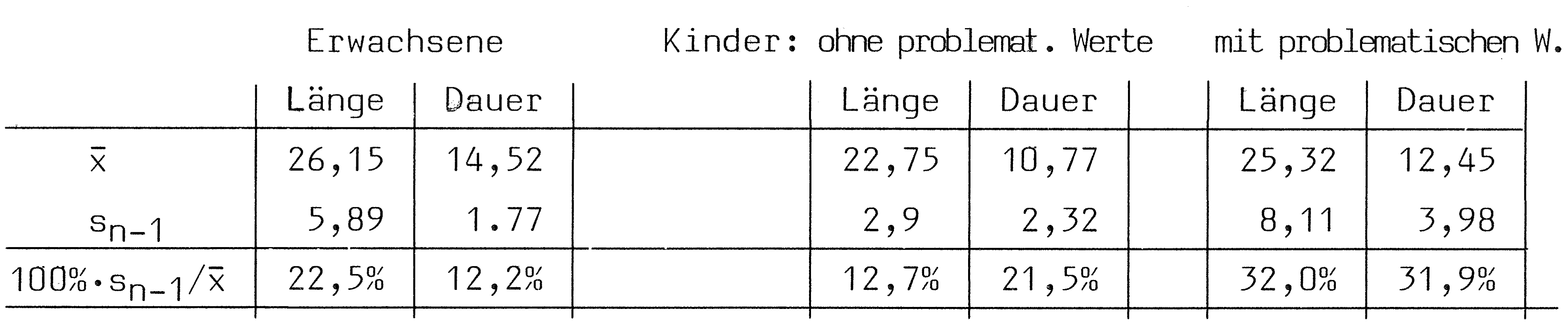
Spektrographische Untersuchung
Die Jodelrubatofrage mit sonagraphischen Mitteln einer Beantwortung näherbringen zu wollen, beinhaltet eine Reihe von Problemen und bedarf der theoretischen Vorüberlegungen, die den Zusammenhang zwischen physikalisch-akustischer und wahrnehmungs‐ und verstehensmäßiger Ebene betreffen. Ich will zuerst den Begriff des Rubato im Rahmen der oben explizierten Metrumkonzeption definieren und sodann darlegen, inwiefern die mathematische Auswertung sonagraphischer Meßdaten zur Erhellung der Metrorhythmik des Jodels beitragen kann.
Metrum wurde im Theoriekapitel als eine real erklingende oder bloß gedachte bzw. gefühlte Impulsfolge
definiert, die zum Vordergrund der rhythmischen Gestalt einen gleichbleibenden Hintergrund
bildet, der als Bezugs‐ oder Regulierungskonfiguration dient
. Ich habe gleichbleibend
in einem sehr strengem Sinn aufgefaßt und unter Metrum die (mehrmalige) Wiederholung eines Impulses oder einer Impulskonfiguration in gleichen Zeitabständen verstanden, wobei ich Zeit auf der phonemischen
Ebene, d.h. auf der Ebene der metrorhythmischen Bedeutung meinte und so die Möglichkeit von Verlangsamungen und Beschleunigungen des Tempos, in dem die metrischen Impulse aufeinanderfolgen, ausdrücklich vorsah. Rubato definiere ich nun als kurzfristige Temposchwankung der metrischen Impulsabfolge. Damit wird der Zeitbegriff aufgespalten und verdoppelt. Es gibt einerseits die gezählte Zeit
bzw. Zählzeit
auf der metrorhythmischen Ebene, sie wird in der traditionellen Notenschrift durch die Längenwerte der Noten ausgedrückt. Und andererseits gibt es die Zeitdauer auf der Ebene der psychologischen Zeit. Die Rede, daß gleiche Zeiten ungleich lang dauern können, ist dann keineswegs paradox, sie beschreibt adäquat die beim Rubato gegebene Situation. Die Spaltung des Zeitbegriffes wird zu einer Verdreifachung, sobald dazu noch die physikalische Zeit, gemessen in Sekunden, miteinbezogen wird. Das alles nötigt zu einer Präzisierung des Sprachgebrauchs, die ich wie folgt vornehmen möchte:
Die Länge eines Ausschnitts aus einem Musikstück (z. B. eines Tones) ist die Anzahl der metrischen Zeiteinheiten (Zählzeiten) dieses Ausschnitte.
Die psychologische Dauer eines musikalischen Ausschnitts kann nicht gemessen oder gezählt, wohl aber vom Hörer beschrieben werden. Sie ist nicht genau identisch mit der physikalischen Dauer, die exakt meßbar ist und in Sekunden angegeben wird. In den folgenden Untersuchungen wird der Unterschied zwischen psychologischer und physikalischer Dauer zumeist vernachlässigt, es wird nur dann von ihm die Rede sein, wenn er sich bemerkbar macht.
Das Verhältnis zwischen Länge und Dauer ist das Tempo. Es ist hier wiederum zwischen dem psychologischen und dem physikalischen Tempo zu unterscheiden.
Letzteres wird angegeben in Zählzeiten pro Minute (Metronomwert). Genaugenommen ist das hier als physikalisch
bezeichnete Tempo ein Verhältnis zwischen einer musikalisch-konzeptuellen und einer physikalischen Größe.
Kurzfristige Temposchwankungen bzw. Rubati werden in der traditionellen Notenschrift wie auch in der musikwissenschaftlichen Transkriptionsschrift als Abweichungen vom vorherrschenden Normaltempo oder vom Durchschnittstempo angegeben. (z. B. mit acc.....a tempo
oder mithilfe der bekannten diakritischen Zeichen). Beansprucht eine metrische Zeit (d.h. eine Länge) mehr Zeitdauer als ihr auf Grund des Durchschnitts‐ oder des Normaltempos zukäme, so ist von einer Dehnung die Rede. Im umgekehrten Fall möchte ich von einer Stauchung sprechen. (Sichardt spricht hier von Drängung
(s. o.), doch ist mir das Wort zu sehr emotional gefärbt. Hornbostel und Abraham reden von Verlängerung
und Verkürzung
(Abraham & Hornbostel1909). Bartok spricht von Dehnung
und Kürzung
(Bartok 1959: 109) und diesen Sprachgebrauch habe auch ich in den vorigen Kapiteln gepflogen.
Doch hat die Bezeichnung Stauchung nicht nur den Vorteil, daß sie den aus rein sprachlichen Gründen den adäquateren Gegenbegriff zur Dehnung darstellt, sie macht auch die Bezeichnung Kürzung bzw. Verkürzung frei, etwas anderes zu bezeichnen. (Dazu siehe unten im nächsten Absatz). Wie beim Tempo ist auch bei Dehnung und Stauchung zwischen psychologischer und physikalischer zu unterscheiden. Die psychologische Dehnung oder Stauchung ist die Differenz zwischen der wahrgenommenen Dauer und der auf Grund des erkannten Normal‐ oder Durchschnittstempos erwarteten Dauer einer metrischen Zeit. Auf der Ebene des musikalisch-physikalischen Verhältnisses Länge/Dauer ist Dehnung und Stauchung die Abweichung von der Durchschnitts‐ oder der Normaldauer einer metrischen Zeit, ausgedrückt in Millisekunden oder in Promillen der Dauer eines musikalischen Formabschnitts oder in Prozenten der Durchschnitts‐ oder der Normaldauer einer Zählzeit. Diese Abweichungen können in dem von der schwedischen Rhythmusforschung eingeführten Ausführungsprofil graphisch dargestellt werden. Von der theoretischen Warte gesehen ist es nicht uninteressant, daß hier ein Verhältnis (mathematischer Bruch bzw. Division) zwischen einer musikalisch-konzeptuellen und einer physikalisch-akustischen Größe gebildet wird. Diese Vermengung der Ebenen schafft nicht nur das bekannte Problem des physikalischen Tonbeginns, (die paradoxe Formulierung wurde absichtlich gewählt, – auf der physikalischen Ebene gibt es keine Töne, nur Schälle), sie verlangt auch eine mathematisierbare Beschreibung der metrorhythmischen Struktur, – ein schwieriges Unterfangen bei oral tradierten Musikstücken mit exzessivem Rubato wegen des Deutungsproblems. Doch muß die Musikwissenschaft genauso wie die Linguistik mit solchen Problemen leben.
Die Bezeichnungen Verlängerung und Verkürzung bzw. Kürzung möchte ich reservieren für den Unterschied in der Anzahl der Zählzeiten zwischen Varianten eines Musikstücks, aber auch für den Prozeß der Variantenbildung selbst, in dem metrische Zeiten zu einer musikalischen Gestalt hinzutreten oder aus ihr verschwinden. Es kann sich hierbei um ganze Formabschnitte handeln oder um Wiederholungen, aber auch nur um einen eingeschobenen oder verschwundenen Takt oder eine Zählzeit. Die bei der Transkription von Liedern und Jodeln im Rubatostil häufig sich stellende Frage, ob gedehnte oder gezählte Zeit vorliegt, kann mithilfe dieser Terminologie auch als die Frage formuliert werden, ob gedehnte oder verlängerte Zeit vorliegt. Der Variantenbildungsprozeß, in dem gestauchte als gezählte Zeit (miß)verstanden wird, kann beschrieben werden als Umwandlung einer Stauchung in eine Kürzung. Der Vorteil dieser Terminologie liegt darin, daß nun Verlängerung und Verkürzung direkt die Länge selbst betreffen, Dehnung und Stauchung jedoch die Dauer der Länge.
Rubato ist als Stauchung oder/und Dehnung metrischer Zeiten beschreibbar. Wie ich es schon in der Kritik der Auffassungen Max Peter Baumanns vorweggenommen habe, möchte ich zwei Arten des Rubato unterscheiden: das gebundene und das freie Rubato. Beim gebundenen Rubato gleichen Dehnungen und Stauchungen aufeinanderfolgender Zeiten einander aus, sodaß die Takte oder die Doppeltakte gleich lang dauern. Beim freien Rubato ist das nicht der Fall.
Den der musikalischen Aufführungspraxis des Französischen Barock entlehnten Begriff der Inégalité möchte ich bei den kleineren Unterteilungen der Zählzeit anwenden. Transkriptionsschriftlich kann sie wie ein gebundenes Rubato behandelt, d.h. als Abweichung von der notierten rationalen Proportion angemerkt werden. Diese Schreibweise ist freilich ein reiner Notbehelf in denjenigen Fällen, in denen im Durchschnitt oder als erwartbare Norm gar keine rationale Proportion, von der dann abgewichen würde, vorliegt, sondern eine irrationale Proportion intendiert ist, die sich selbst mit unübersichtlich komplizierter Notenschreibung nur annäherungsweise darstellen ließe.
133Die Regelmäßigkeitsbehauptung
Ich möchte nun eine Behauptung formulieren und daraufhin diskutieren, wie weit die mathematische Analyse sonagraphischer Meßdaten dazu angetan sein kann, die Behauptung zu stützen. Sie lautet:
Die Muotataler Jodelinterpretation ist eine Nonrubatointerpretation.
Ich will diese Behauptung in zwei Teilbehauptungen aufspalten; in eine Gleichmäßigkeitsbehauptung (a) und eine Metrizitätsbehauptung (b):
- (a) Die Abfolge der Tonbeginne geschieht mit ungestörter und nahezu
metronomartiger
(W. Sichardt) Regelmäßigkeit. - (b) Diese Regelmäßigkeit ist eine durchwegs metrisch verstandene. D.h. es kommt nicht vor, daß durch Dehnung bzw. Stauchung um einen quasirationalen Faktor (z. B. auf die doppelte, anderthalbfache oder halbe Dauer) der Eindruck von
dehnungsfreier Rhythmik
(Sichardt 1939: 38) nur äußerlich entsteht.
Es liegt auf der Hand, daß mit sonagraphischen Mitteln nur die Gleichmäßigkeitsbehauptung (a), nicht jedoch die Metrizitätsbehauptung (b) überprüft werden kann. Denn die Metrizitätsbehauptung sagt über das Verstehen etwas aus u. zwar darüber, wie die hörbare (und naturwissenschaftlich nachweisbare) Gleichmäßigkeit von den Muotataler Juuzern aufgefaßt wird. Die Metrizitätsbehauptung kann letztlich nur ethnomethodisch geprüft werden und metrische Hypothesen können nur auf der Basis einer musikalischen Analyse erstellt werden.
Da zwischen der physikalisch-akustischen Ebene und der Wahrnehmungsebene keine 1:1-Abbildung, sondern eine psychoakustische Funktion besteht, muß die Regelmäßigkeitsbehauptung präzisiert werden, was in mehrerlei Form geschehen kann:
- (a1) Die von mir gehörte Regelmäßigkeit ist naturwissenschaftlich nachweisbar im Schall selbst vorhanden. (Sie ist kein durch
Zurechthören
erzeugtes Artefakt.) - (a2) Die in der Schallfolge nachweislich vorhandene Regelmäßigkeit wird von Hörern wahrgenommen, die zu einem ganz bestimmten musikalischen Verständnis des Jüüzli gelangt sind.
- (a3) Die in der Schallfolge nachweislich vorhandene Regelmäßigkeit wird von jedem Hörer wahrgenommen.
Ich werde beweisen, daß Behauptung (a1) richtig ist. Behauptung (a3) ist möglicherweise falsch. Zumindest kann ich an einem Fallbeispiel zeigen, daß ein Hörer, der eine von der meinen sehr verschiedene Auffassung über die metrorhythmische Struktur des Muotataler Jodels vertritt, bei einer bestimmten Jodelinterpretation zu einem Rubatoverständnis gelangte und zu einer Notation, die die in der Schallfolge vorhandene Regelmäßigkeit nur teilweise wiedergibt. (Ich werde dann natürlich argumentieren, daß eine Auffassung, die mehr musikalischen Sinn zu erkennen vermag, ohne objektiv vorhandene Regelmäßigkeiten als rubatomäßige Unregelmäßigkeiten deuten zu müssen, höchstwahrscheinlich die richtigere Auffassung ist. Das Mehr an musikalischem Sinn wird im noch unveröffentlichten 2. Teil erwiesen). Ob Behauptung (a2) außer auf mich auch auf andere Hörer zutrifft, habe ich nicht überprüft. Soviel dürfte aus den folgenden Untersuchungsergebnissen jedoch hervorgehen, daß ein Hörer, dessen metrorhythmische Deutung mit der objektiven Regelmäßigkeit der Tonbeginn-Abfolge konform geht, wohl auch imstande sein wird, diese Regelmäßigkeit bewußt wahrzunehmen, (egal wie sehr sich seine Deutung von der meinigen in anderen Dingen wie Betonungsverhältnissen, Tonalität und Harmonik auch unterscheiden mag).
Es mag manchem Leser vielleicht übertrieben erscheinen, die Regelmäßigkeit der Tonabfolge mit einer aufwendigen sonagraphischen Analyse zu beweisen.
Diese Regelmäßigkeit, so könnte argumentiert werden, sei ja mit unbewaffnetem Ohr hörbar, die Verweisung auf die von Hugo Zemp herausgegebenen, jedermann zugänglichen Schallplatten (Zemp 1979 und 1990) müsse genügen, um Heinrich J. Leutholds Rubatoauffassung als unzutreffend abzutun. Diese Argumentation machte es sich m. E. zu leicht. Denn Leuthold hat seine Rubatothese zwei Jahre nach dem Erscheinen von Zemps erster Jüüzli-Schallplatte publiziert. (Ob er die Platte kannte, geht aus seinem Buch zwar nicht hervor). Weiters war sein Gewährsmann, der Muotataler Toni Büeler, jahrelang Vorjodler in dem von Leuthold geleiteten Chor. Leuthold hat Büeler also gut gekannt und sich von ihm möglicherweise auch über den Muotataler Juuz eingehend informieren lassen. Und drittens ist Max Peter Baumanns Vorwurf der fragwürdigen, rhythmisch starren Fixierung
(Baumann 1976: 85) unwidersprochen geblieben. Zudem ist das Thema Jodelrhythmus ideologisch belastet. Es erschien mir daher notwendig, meine Darstellung des Muotataler Jodels auf das harte Fundament naturwissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse aufzubauen, die mehr beanspruchen können als den Rang einer subjektiven Deutung oder einer bloßen Meinung.
Es gilt nun, genau zu erklären, was ich mit Regelmäßigkeit
meine und zudem eine Methode vorzuschlagen, wie das objektive Vorhandensein dieser Regelmäßigkeit überprüft werden kann. Mit Regelmäßigkeit meine ich, daß die Tonbeginne auf einem durchlaufenden, gleichabständigen Puls liegen, (wobei zwar nicht jeder Puls einen Tonbeginn aufweisen muß, wohl aber umgekehrt jeder
135
Tonbeginn mit einem Puls zusammenfällt). Es läßt sich etwas gleichmäßig gleichmäßig durchzählen, (was dann konzeptuell als Zählzeit gedeutet werden könnte). Auf der physikalischen Ebene entspricht dem Puls eine Folge von gleichabständigen Rasterpunkten auf der Zeitachse. Den Tonbeginnen entspricht eine Folge von Meßpunkten auf der Zeitachse. Regelmäßigkeit läßt sich nun wie folgt definieren: Eine Folge von Meßpunkten ist genau dann regelmäßig, wenn sich eine Folge gleichabständiger Rasterpunkte konstruieren läßt derart daß jeder Meßpunkt hinreichend nahe an einem Rasterpunkt liegt. Hinreichend nahe
kann für die Zwecke dieser Untersuchung z. B. mit 15% des Rasterabstandes festgelegt werden.
Ferner hat es wenig Sinn, die Rasterabstände beliebig klein werden zu lassen, weil sehr kleine Zeitdifferenzen für die metrische Deutung nicht mehr relevant sind. Als Minimum kann z. B. der kleinste Zwischen zwei Meßpunkten auftretende Abstand festgelegt werden.
Ein geeignetes Computerprogramm könnte alle Raster durchrechnen und das passende auffinden. Eine andere Möglichkeit wäre die visuelle Mustererkennung, eine weitere die auditive. Ich wähle die letztere Möglichkeit und entwerfe Raster in Form von Transkriptionen. Mit dieser Methode kann nicht nur die Regelmäßigkeit von Meßpunkten aufgezeigt werden, es können gleichzeitig Transkriptionen daraufhin überprüft werden, ob sie diese Regelmäßigkeit adäquat abbilden. Weiters können nicht nur meine eigenen, sondern auch Notationen anderer Autoren zu diesen Untersuchungen herangezogen werden.
Es sind nun die möglichen Fälle partieller Regelmäßigkeit zu betrachten. Eine Menge von Meßpunkten möchte ich partiell regelmäßig nennen, wenn ein Meßpunkt oder mehrere Meßpunkte nicht hinreichend nahe bei Rasterpunkten liegen, aber wenigstens drei Punkte die Regelmäßigkeitsbedingung erfüllen. Der Grad an Regelmäßigkeit ist durch den Anteil der die Regelmäßigkeitsbedingung erfüllenden Meßpunkte definiert. Es ist klar, daß dieser Grad abhängig ist vom unterlegten Raster. Das optimale Raster ist jenes, das den höchsten Regelmäßigkeitsgrad zuläßt, (bei fixem Prozentsatz vom variablen Rasterabstand als Maximalabweichung des Meßpunkte vom Rasterpunkt). Es kann nun z. B. diejenige Transkription gesucht werden, die das optimale Raster liefert.
Partielle Regelmäßigkeit kann verschiedene Formen aufweisen, von denen einige als Verdachtsmomente für metrorhythmische Gegebenheiten angesehen werden können, vorausgesetzt, es ist bereits ein optimales Raster unterlegt. Liegen bis zu einem bestimmten Glied der Folge alle Meßpunkte am Raster und danach gar keiner mehr, so könnte an der Bruchstelle eine Dehnung oder Stauchung vorliegen oder ein Tempowechsel. Die Meßpunktfolge kann in diesen Fällen in zwei oder mehrere durch Bruchstellen getrennte Teilfolgen zerfallen, die jede allein in sich regelmäßig sind: Ein neuer Rasterabstand weist auf einen Tempowechsel hin, 136 bleibt der Rasterabstand nach der Bruchstelle derselbe und ist das neue bloß gegen das vorherige verschoben, so dürfte eine Dehnung oder Stauchung vorliegen. Ein anderer Fall ist der, daß die regelmäßige Teilfolge von Anfang bis Ende der Meßpunktfolge durchläuft. Hier könnte Inégalité oder gebundenes Rubato vorliegen – oder das unterlegte Raster ist nicht optimal konstruiert.
In der Praxis werde ich nicht nur Abweichungen von Rasterpunkten betrachten, sondern auch das von der schwedischen Rhythmusforschung eingeführte Ausführungsprofil verwenden und Abweichungen der Tondauern von Normdauern analysieren. In seiner klassischen Anwendungsweise geht das Ausführungsprofil von einer als gültig angenommenen Notation aus, leitet von ihr eine Folge von Normdauern ab und stellt die Konfiguration der Abweichungen der realen Dauern von den Normdauern dar. Nun gibt es aber von Muotataler Jüüzli keine unbestritten gültigen Transkriptionen, die als Notation einer solchen Untersuchung zugrundegelegt werden könnten. Ich werde daher die Methode adaptieren und statt der Abweichung der Ausführung von der Notation umgekehrt die Abweichung der Transkription von der Ausführung betachten. Das Ausführungsprofil ermöglicht es, Transkriptionen daraufhin zu untersuchen, wie genau sie mit den Meßdaten einer realen Interpretation übereinstimmen. Mathematisch kann die Beschreibungsgenauigkeit der Transkription als Standardabweichung der Transkription ausgedrückt werden.
Die Standardabweichung hat die günstige Eigenschaft, daß große Abweichungen mehr ins Gewicht fallen als kleine. Das Transkriptionsproblem kann formuliert werden als die Suche nach der Transkription mit der kleinsten Standardabweichung.
Natürlich zielt diese Methode auf phonetische
, nicht auf phonemische
Transkription ab. Die Standardabweichung der Transkription wird berechnet aus denselben Abweichungen, die im Ausführungsprofil graphisch dargestellt werden können, sie ist die Wurzel aus der durch die Anzahl der Abweichungen dividierten Summe der Abweichungsquadrate. Ein anderes Maß für die Beschreibungsgenauigkeit der Transkription ist die Maximalabweichung, das ist die größte zwischen einer notierten und einer realen Dauer auftretende Differenz. Sie kann durch Verwendung kleiner und kleinster Notenwerte immer kleiner gemacht werden bis hin zu einer durch die Meßgenauigkeit gegebenen unteren Schranke. Doch ist das im Interesse der Lesbarkeit nicht sinnvoll. In der Praxis genügt es meist, den kleinsten Notenwert ungefähr der kleinsten zu beschreibenden realen Dauer entsprechend zu wählen. Für eine gute phonetische
Transkription kann die Forderung aufgestellt werden, daß die Maximalabweichung die Hälfte der Normdauer des kleinsten Notenwerts nicht überschreiten sollte. Der kleinste Notenwert könnte dann die Auflösung der Transkription genannt werden, seine Hälfte die Mindestgenauigkeit.
Die andere Möglichkeit, Maximal‐ und Standardabweichung zu verkleinern, besteht in der Wahl einer geeigneteren Klassierung der Dauern. Der Vergleich zwischen den beiden Transkriptionen des 3. Jodelsegments in Abb. 23 zeigt, daß die Wahl einer etwas kleineren Normsechzehntel zu einer besser passenden Transkription führt: Transkription 1 (F. Födermayr 1994: 264) hat sowohl eine geringere Maximalabweichung als auch eine geringere Standardabweichung von den gemessenen Dauern als die von mir erstellte Transkription 2. (Warum bei den anderen Jodelsegmenten in Abb. 22﹣24 zumeist das Umgekehrte der Fall ist, hat spezielle Gründe, die weiter unten erklärt werden). Nun ist aber Transkription 2 gar keine phonetische
, sondern eine phonemische
Transkription, da sie meine metrorhythmische Deutung ausdrückt, ihre Grundlage ist ein durchlaufender Achtelpuls. Der erscheint in Transkription 1 an einer Stelle unterbrochen: Die angehängte Sechzehntel, die den Puls zu unterbrechen scheint, ist vom Standpunkt der in Transkription 2 notierten metrorhythmischen Deutung eine kleine Dehnung der Viertel. Ob es sich nicht vielleicht in Wirklichkeit um die Stauchung einer punktierten Viertel handelt, wird weiter unten diskutiert.
Von Interesse sind momentan aber nicht diese Deutungsfragen, sondern der Grad an Regelmäßigkeit. Daß Transkription 2, in der fast alle Noten auf einem Raster durchlaufender Achteln liegen, eine so gute Passung aufweist, ist ein Indiz für die Regelmäßigkeit dieser Jodelinterpretation (und auf der Ebene der metrorhythmischen Deutung ein Verdachtsmoment für Nonrubato).
Indiz
ist hier im Sinne von notwendiger Bedingung
gemeint, nicht im Sinne von hinreichender Bedingung
bzw. Beweis
. Bewiesen werden kann die Regelmäßigkeit der Meßpunktfolge nicht durch das Betrachten der Dauern zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Punkten, wie sie in der phonetischen
Transkription oder im Ausführungsprofil geschieht, sondern durch den Vergleich des Rasters mit den Meßpunkten selbst. Das Raster könnte mittels Fehlerquadratsummenminimierung an die Meßpunktfolge angelegt werden. Ich werde eine weniger rechenaufwendige Methode der Rasterapplikation verwenden und das bei der Erstellung des Ausführungsprofils als Nebenprodukt anfallende Raster so verschieben, daß die Maximalabweichung ein Minimum wird. Erfüllt die minimierte Maximalabweichung die Regelmäßigkeitsbedingung, dann ist die Meßpunktfolge regelmäßig. (Siehe z. B. Abb. 33).
Eine ganz andere Möglichkeit, Regelmäßigkeit nachzuweisen, böte die Fourieranalyse der Meßpunktfolge, die zu diesem Zweck als Folge von Klicks dargestellt wird. Da in der Muotataler Jodelinterpretation zwischen den Tönen deutliche Lautstärkeminima auftreten (Nonlegato, vgl. Abb. 15﹣21), wäre es sogar möglich, direkt vom Signal auszugehen und die logarithmierte RMS-Funktion der Fourier-Analyse zu unterziehen. Emil H. Lubej und ich haben in diese Richtung experimentiert, die Sache aber dann nicht weiter verfolgt.
138Abschließend sei auf den Zusammenhang zwischen Regelmäßigkeit und Nonrubato eingegangen. Eine Nonrubato-Interpretation ist regelmäßig. Aber nicht jede regelmäßige Interpretation ist eine Nonrubato-Interpretation, denn es gibt, wie schon erwähnt, Dehnungen um einen quasirationalen Faktor. Da ich die Raster von Transkriptionen ableite, kann ich zur Überprüfung der Regelmäßigkeit nur solche Transkriptionen gebrauchen, die ein durchgehendes Raster enthalten (wie z. B. in Abb. 23 die Transkription 2, nicht jedoch die Transkription 1).
Je nachdem, ob die Transkription phonetisch
oder phonemisch
ist, sind zwei Fälle zu unterscheiden: Mittels der Passung einer phonetischen
Transkription kann nur die bloße Regelmäßigkeit bewiesen werden. Ist jedoch die Folge der metrorhytmisch relevanten Zeitpunkte einer Interpretation regelmäßig in Bezug auf eine phonemische
Transkription, dann ist mit der Regelmäßigkeit auch das Nonrubato, die dehnungsfreie Rhythmik, gezeigt. Aus diesem Grunde werde ich in der folgenden Untersuchung häufig Transkriptionen verwenden, die eine metrische Deutung enthalten. Diese ist mit der Behauptung verknüpft, die metrorhytmische Auffassung des Ausführenden wiederzugeben. Es handelt sich hierbei um Behauptungen, die im noch unveröffentlichten 2. Teil erhärtet werden.
Einige dieser Erkenntnisse kommen im jetztigen Kapitel schon zur Sprache. Diese Vorwegnahme widerspricht zwar der angestrebten linearen Darstellungsform, doch erschien es mir vorteilhaft, metrische Deutungsprobleme, soweit sie mit der Erkennung von Tondauerverhältnissen zusammenhängen, schon im jetztigen Kapitel zu besprechen.
Ein Juuz von Emmi Suter﹘Gwerder
Für die Untersuchung wurde jener Juuz ausgewählt, von dem es die meisten veröffentlichten Transkriptionen gibt:
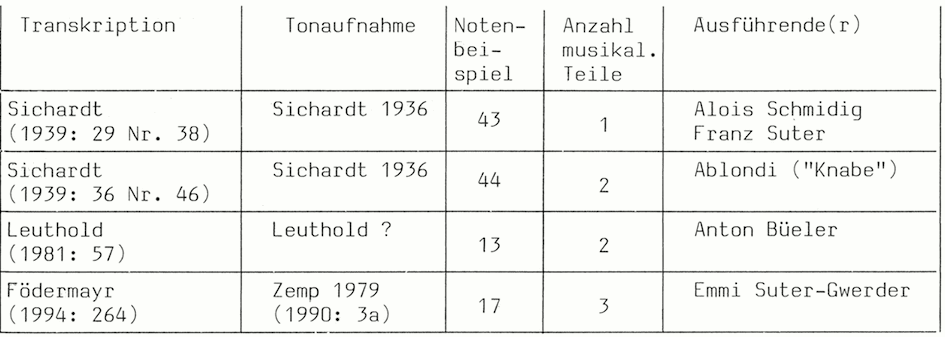
Die von Hugo Zemp herausgegebene CD enthält insgesamt 3 Varianten dieses Juuz (Zemp 1990: 2c, 3a und 10a). Sichardts Aufnahmen standen mir leider nicht zur Verfügung. Dafür besitzt das Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien eine Video-Aufnahme, die im Zuge der Schweiz-Exkursion 1993 in der Wohnung Toni Büelers in Muotathal gemacht wurde und in der Büeler diesen Juuz präsentiert. Alle 4 Aufnahmen machen den Eindruck großer Regelmäßigkeit in der Tonfolge.
Der Juuz kommt unter verschiedenen Namen vor. Die Ähnlichkeit der Varianten besteht primär im 1. musikalischen Teil, ferner im Inzipit des 2. Teils. (In meiner Deutung besteht sie weiters in der gemeinsamen metrisch-formalen Struktur und in der latenten Harmoniefolge, die in der dreistimmigen Fassung der Gebrüder Schmidig (Notenbeispiel 43a; Zemp 1979/90: 10a) sich manifest zeigt.
Die Regelmäßigkeit der Tonabfolge zu zeigen, wäre mit jedem anderen Muotataler Jodel genauso möglich. Es wurde der meisttranskribierte Juuz gewählt, um die Frage zu klären, wie genau die bereits publizierten Transkriptionen ihn in zeitlicher Hinsicht beschreiben, mit dem Nebenzweck, eine Rechtfertigung dafür zu geben, weshalb ich in den folgenden Kapiteln teilweise andere Notationen verwende als die bereits vorgeschlagenen. Zudem hat H. Leuthold an genau diesem Jodel seine Rubatobehauptung aufgestellt. In die Endauswahl kamen daher zwei Interpretationen: die von Emmi Suter﹘Gwerder (Zemp 1979/1990: 3a. Transkription Födermayr 1994: 264) und die von Toni Büeler (Video-Aufzeichnung des Inst. f. Musikwissenschaft der Universität Wien 1993. Aufzeichnung Leuthold 1981: 57). Die Aufzeichnung Leutholds Leutholds ist zwar die einer früheren Interpretation Büelers, doch zeigen die Notationen in Abb. 39﹣40 eine große Ähnlichkeit zumindest in der Tonhöhenabfolge, daher erschien mir der Vergleich der Tonaufnahme 1993 mit der Auf
140
zeichnung Leutholds gerechtfertigt.
Um das für die Untersuchung relevante Datenmaterial zu gewinnen, wurde zunächst der Juuz Vo dr Aigeflue
, ausgeführt von Emmi Suter﹘Gwerder (Zemp 1990: 3a), im Zeitverlauf vermessen. Dies geschah mit der Arbeitsstation EMAP, die mir Herr E. H. Lubej freundlicherweise zur Verfügung stellte. Die für die Ortung der Tonbeginne relevanten Übergänge zwischen den Tönen beschreibt Franz Födermayr (Födermayr 1994: 258) wie folgt:
Was [...] die Tonübergänge betrifft [...], so ist hinsichtlich der Verbindung der Brusttöne die Ausbildung kurzer Ausgleichsvorgänge festzustellen, die zum Eindruck einer harten Tonverbindung (in manchen Fällen Knackeindruck) führen. Ebenso erfolgt der Übergang zwischen den Falsettönen ruckartig jedoch ohne Ausbildung eines Geräuscheindruckes. Von besonderem Interesse sind [...] die Registerwechsel. Der Wechsel von der Bruststimme ins Falsett erfolgt ruckartig. Es entsteht der Eindruck einer harten Verbindung, aber meist ohne Ausbildung eines Geräuscheindruckes, wiewohl im Spektrogramm Geräuschanteile im Bereich zwischen 0,5 und 1,3 k Hz sowie zum Teil um 5 k Hz aufscheinen. Das hervorstechendste, im Registerwechsel liegende Merkmal, auf das ebenfalls schon Zemp hingewiesen hat [...], erscheint im Übergang vom Falsett zur Bruststimme, welcher in unserem Beispiel durch Ausbildung eines kurzen scharfen Friktionsgeräusches, meist in Verbindung mit einer palatalen Enge erfolgt (in der Transkription mit einer senkrechten Wellenlinie angezeigt). Die Spektrogramme [...] zeigen eine kräftige durchgehende Geräuschsäule zwischen dem 1. und dem 5. Teilton
Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, ist der Juuz im non legato ausgeführt, es macht keine Schwierigkeit, die den Tonbeginnen entsprechenden Zeitpunkte mit hinreichender Geanauigkeit aufzufinden und zu messen. Hierzu wurde die Arbeitsstation auf einen Cursorschritt von 7,4 msec eingestellt, d.h. auf eine Meßgenauigkeit von 7,4 Millisekunden. Die Messung erfolgte mit visueller und akustischer Kontrolle, es wurde sowohl das Spektrogramm und die Energiekurve (log RMS) betrachtet als auch je 93 msec des Signals vor und nach dem Meßpunkt abgehört, wobei der Meßpunkt so eingestellt wurde, daß vor ihm nur der Tonübergang, nach ihm nur der Ton zu hören war. Wenn für die Placierung des Meßpunktes ein gewisser Spielraum blieb, wurde der Punkt des steilsten Anstiegs der Energiekurve gewählt. Es zeigte sich nämlich, daß fast jeder Tonbeginn von einem Energieanstieg (von bis zu 20 dB) begleitet war, die Übergangszonen zwischen den Tönen sind, von seltenen Ausnahmen abgesehen, erheblich energieärmer. Beim stimmhaften Konsonanten |j| mit darauffolgendem Vokal (zumeist |ɔ|) wurde der Vokalbeginn als Tonbeginn gewertet, obschon
141
das |j| in der Regel dieselbe Grundtonhöhe hat wie der darauffolgende Vokal. Es erschien mir intuitiv plausibel, daß die Betonung auf dem Vokal liegt, zudem steigt die Energie beim Vokaleinsatz kräftig an. Auch hier wurde der Punkt des steilsten Energieanstiegs als Meßpunkt gewählt. Die Zeitdifferenz zwischen Beginn der quasistationären Grundtonhöhe und dem Anstieg der Energie ist den Sonagrammen Abb. 15﹣21 deutlich zu sehen, besonders in der Vergrößerung Abb. 21. In der Transkription wurde daher der Notenkopf sinngemäß über den Vokal gesetzt und das |j| als vor der Zeit
stehend geschrieben (Abb. 22﹣25, Transkription 2).
Die Interpretation hat sechs je in einem Atemzug gejuuzte Segmente, wobei je zwei partiell identisch sind (Vorder‐ und Nachsatz einer Periode). Zwischen den Segmenten liegen Pausen von etwa 2 Sekunden Dauer. In Abb. 22﹣2% finden sich in der ersten Zeile die Meßdaten der metrorhythmisch vermutlich relevanten Ereignisse und in der zweiten Zeile die dazwischenliegenden Zeitdauern. Die übrigen Zeilen enthalten Auswertungen der Daten in Zusammenhang mit den daruntergeschrieben Transkriptionen. Transkription 1 ist die von F. Födermayr (Födermayr 1990: 264) erstellte und in Notenbeispiel 17 wiedergegebene. Von ihr unterscheidet sich Transkription 2 in mehrerlei Hinsicht: Erstens ist sie ohne Zuhilfenahme der sonagraphischen Meßdaten allein auf Grund meines Höreindrucks erstellt worden. Zweitens enthält sie auch Informationen auf der phonemischen
Ebene: Sie gibt mein musikalisches (tonales und metrorhythmisches) Verständnis des Stückes wieder. Da sie weder ausgeschriebene noch diakritisch angemerkte Dehnungen und Stauchungen enthält, beinhaltet sie ferner die Behauptung, daß eine Nonrubato-Interpretation vorliegt. Weder diese Behauptung noch die Plausibilität oder Richtigkeit meiner musikalischen Deutung können an Hand der Meßdaten im strengen Sinn bewiesen werden, die sonagraphische Methode kann lediglich zeigen, wie weit die Transkription auf der phonetischen
Ebene eine adäquate Beschreibung darstellt. Besonders von Interesse ist, ob sie neben der in den Dauerverhältnissen komplizierteren Transkription 1 bestehen kann. Die umrandeten Zahlenspalten in Abb. 22﹣24 beziehen sich auf jene Stellen, in denen sich Transkription 1 und 2 voneinander unterscheiden. Dieser Unterschied drückt sich in den Zeilen, in denen die Differenz zwischen realer Dauer und Normdauer lt. Transkription angegeben ist, als unterschiedliche Fassung bzw. Beschreibungsgenauigkeit in Zahlen aus, (die als Ausführungsprofil graphisch dargestellt werden könnten). Da der kleinste Notenwert in beiden Transkriptionen die Sechzehntel ist, wurde die Dauer einer Normzweiunddreißigstel lt. Transkription berechnet, sie stellt ein Maß für die Beschreibungsgenauigkeit dar: Überschreitet die Differenz zwischen realer und notierter Dauer den Wert der Zweiunddreißigstel, dann wäre eine Veränderung der Transkription zu überlegen
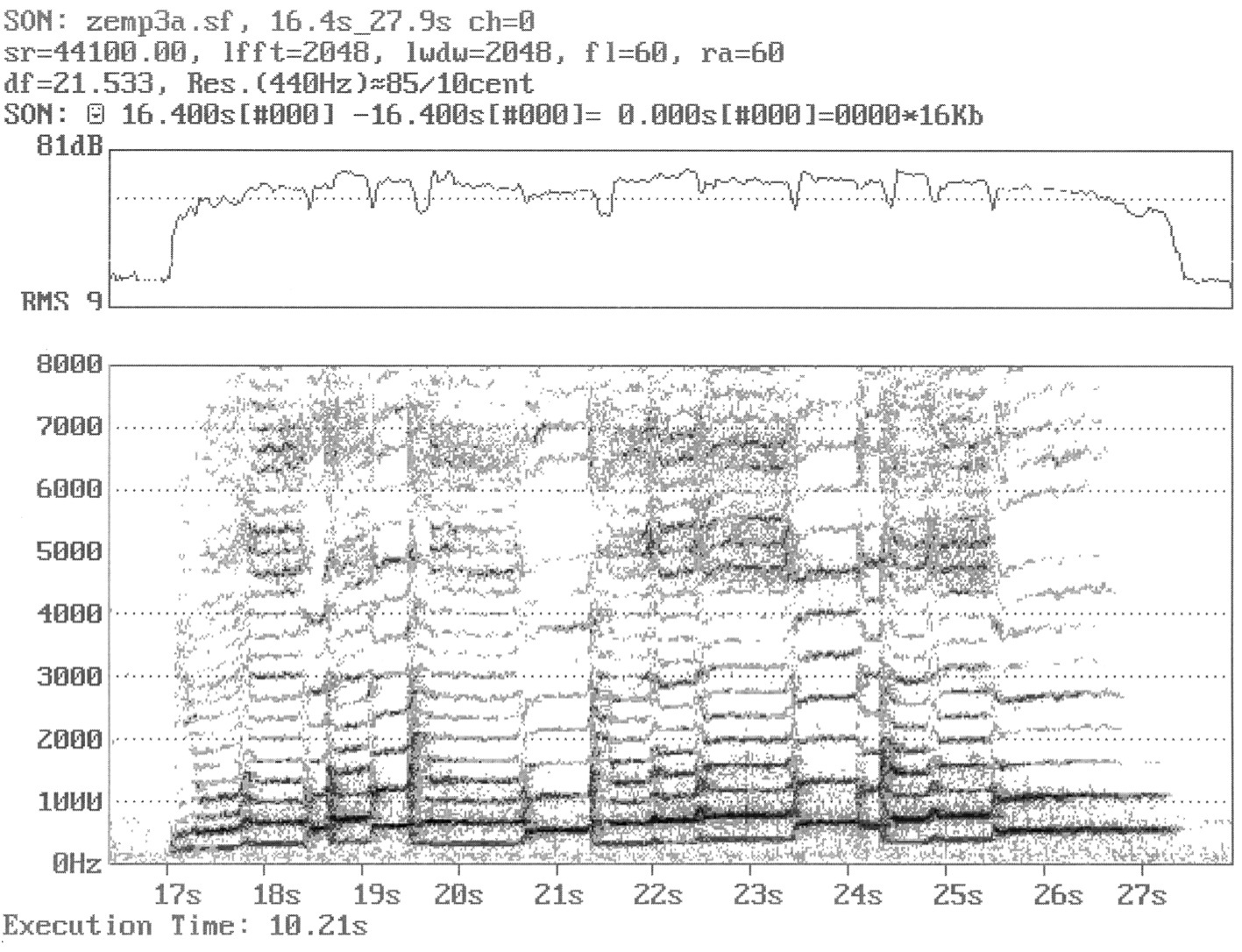
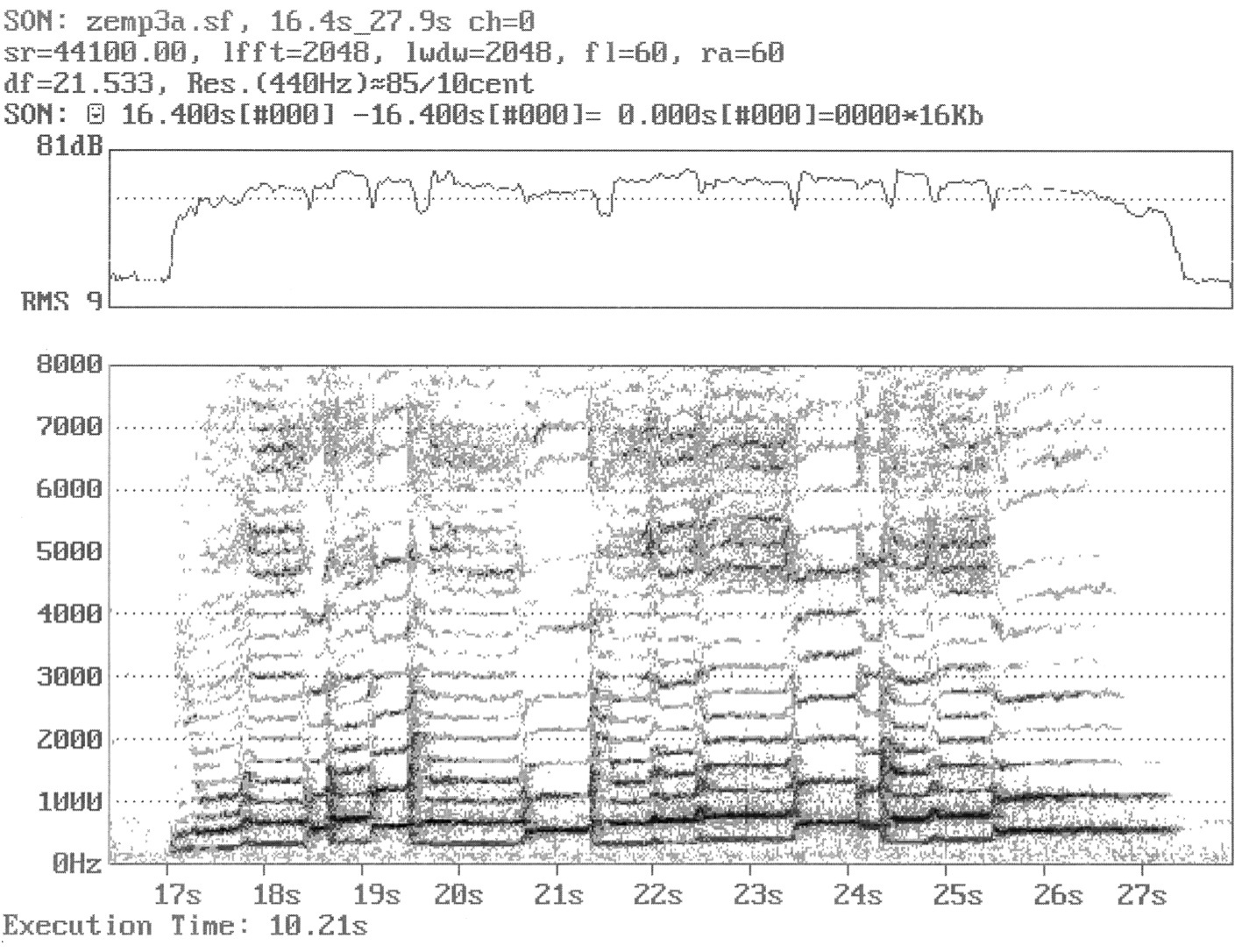
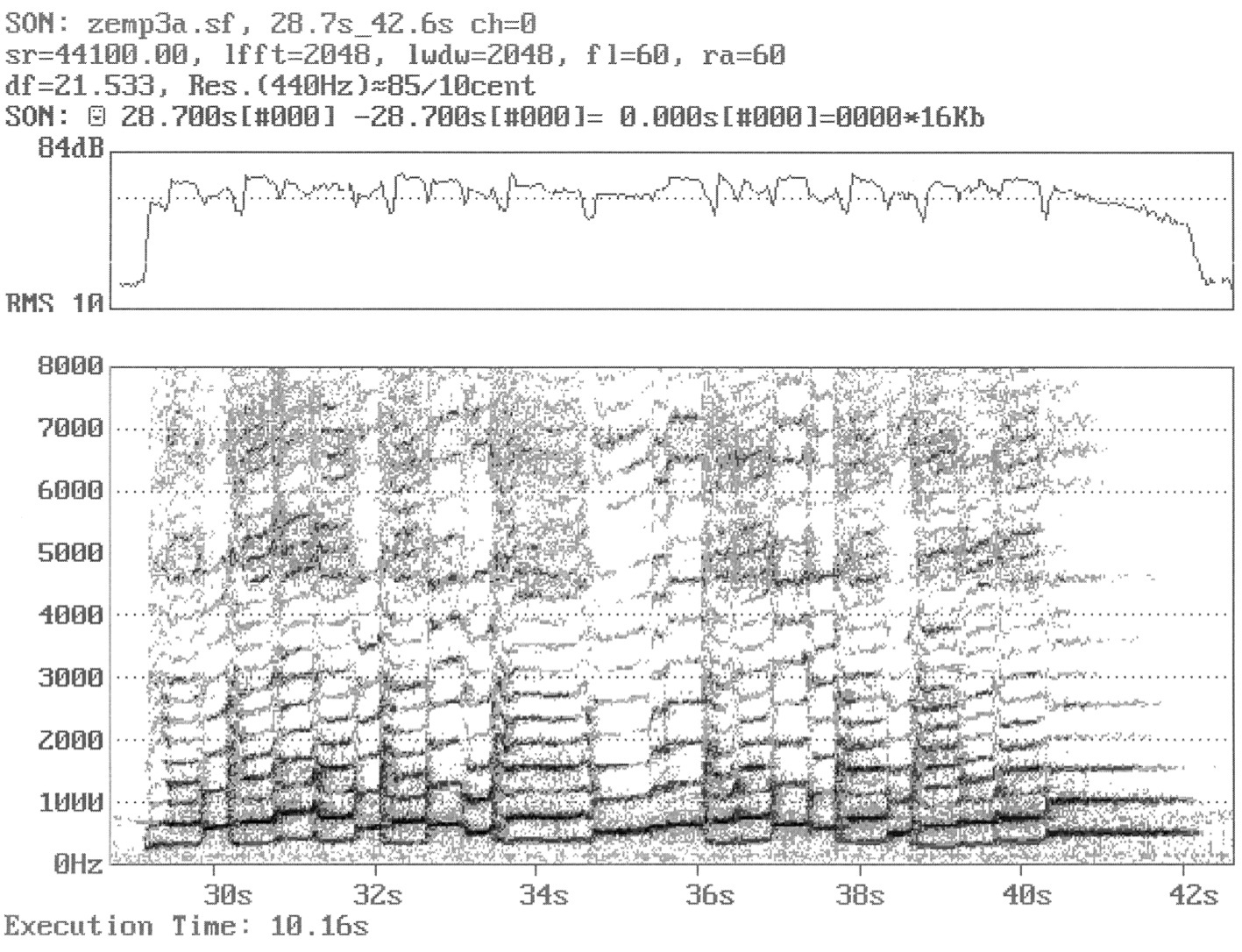
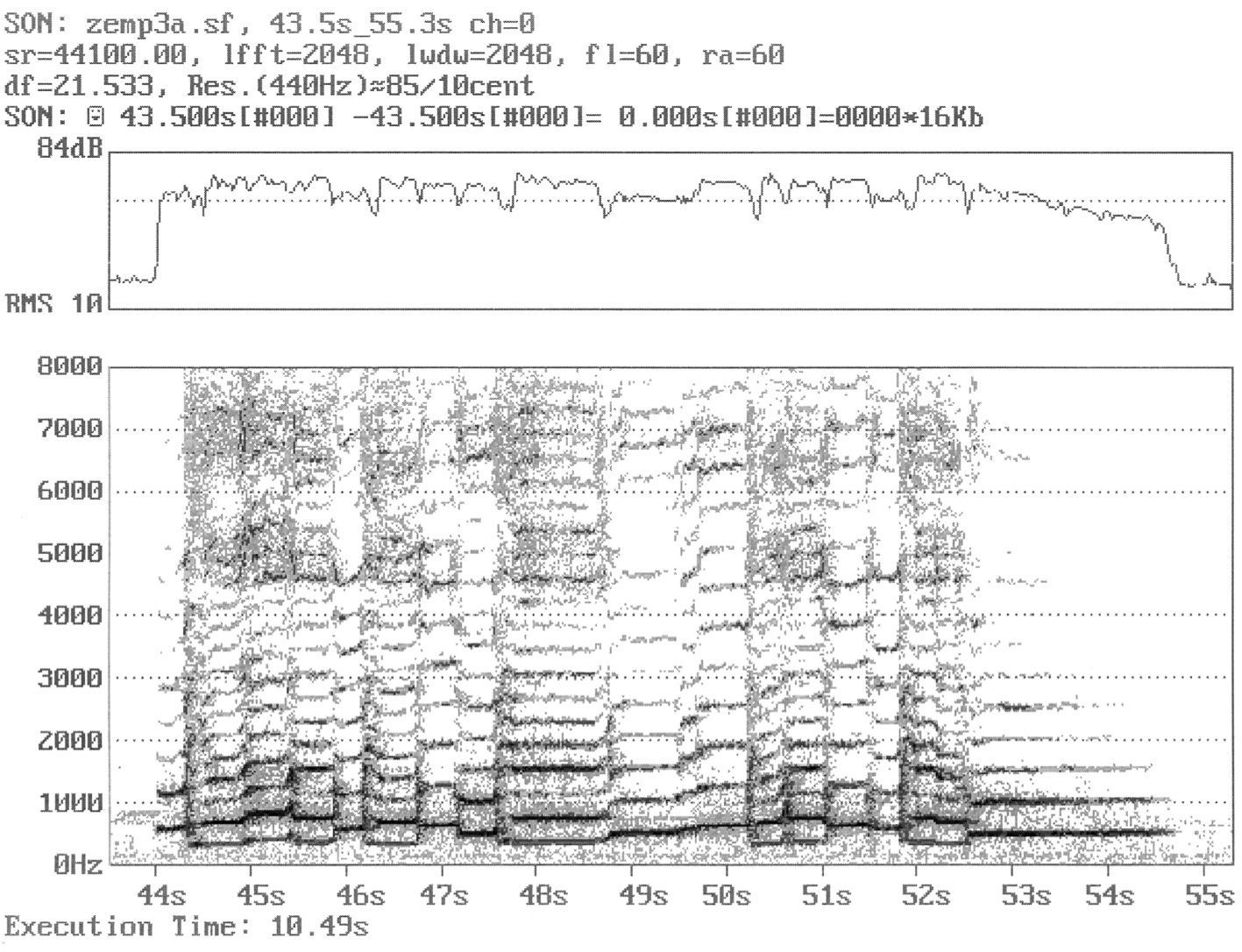
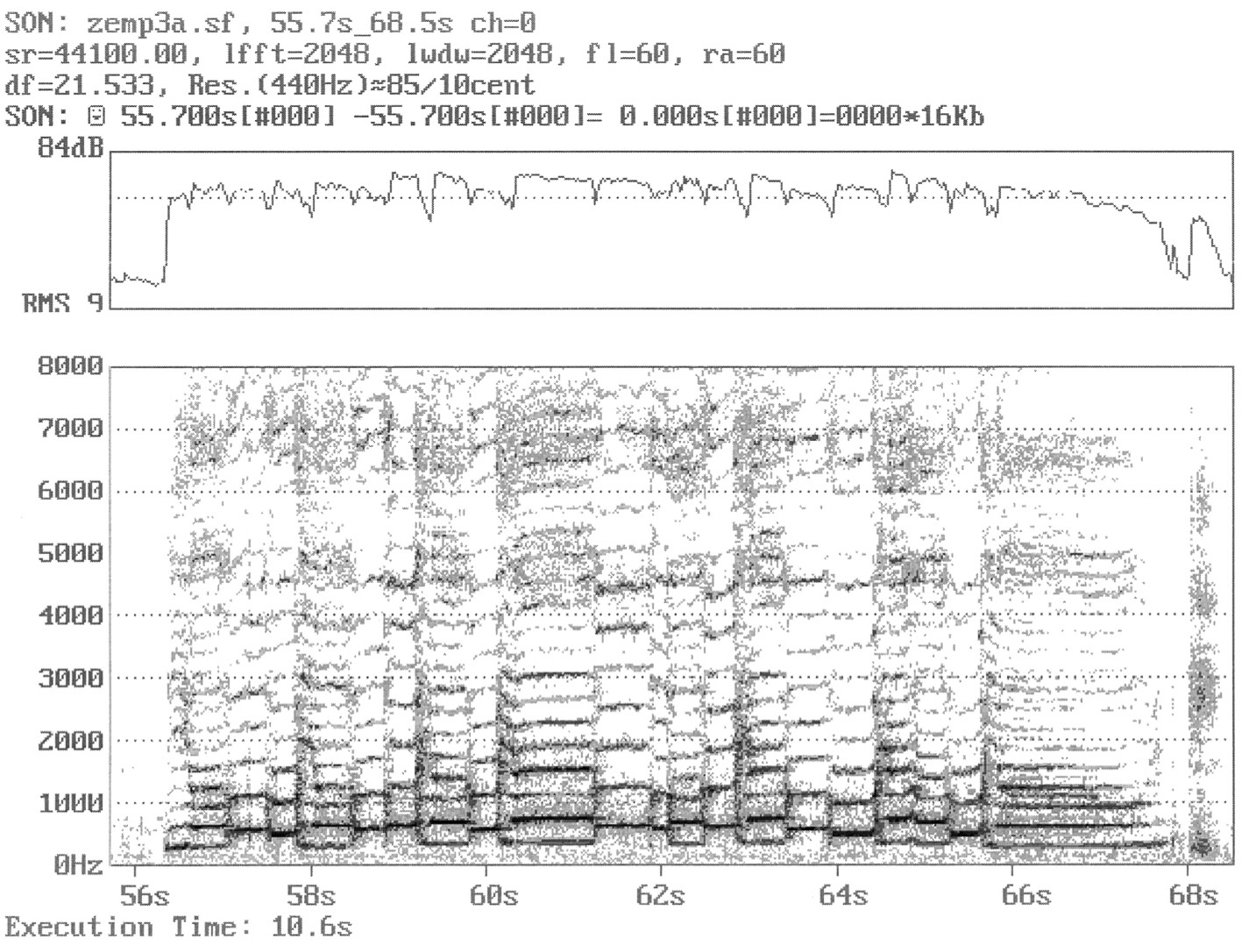
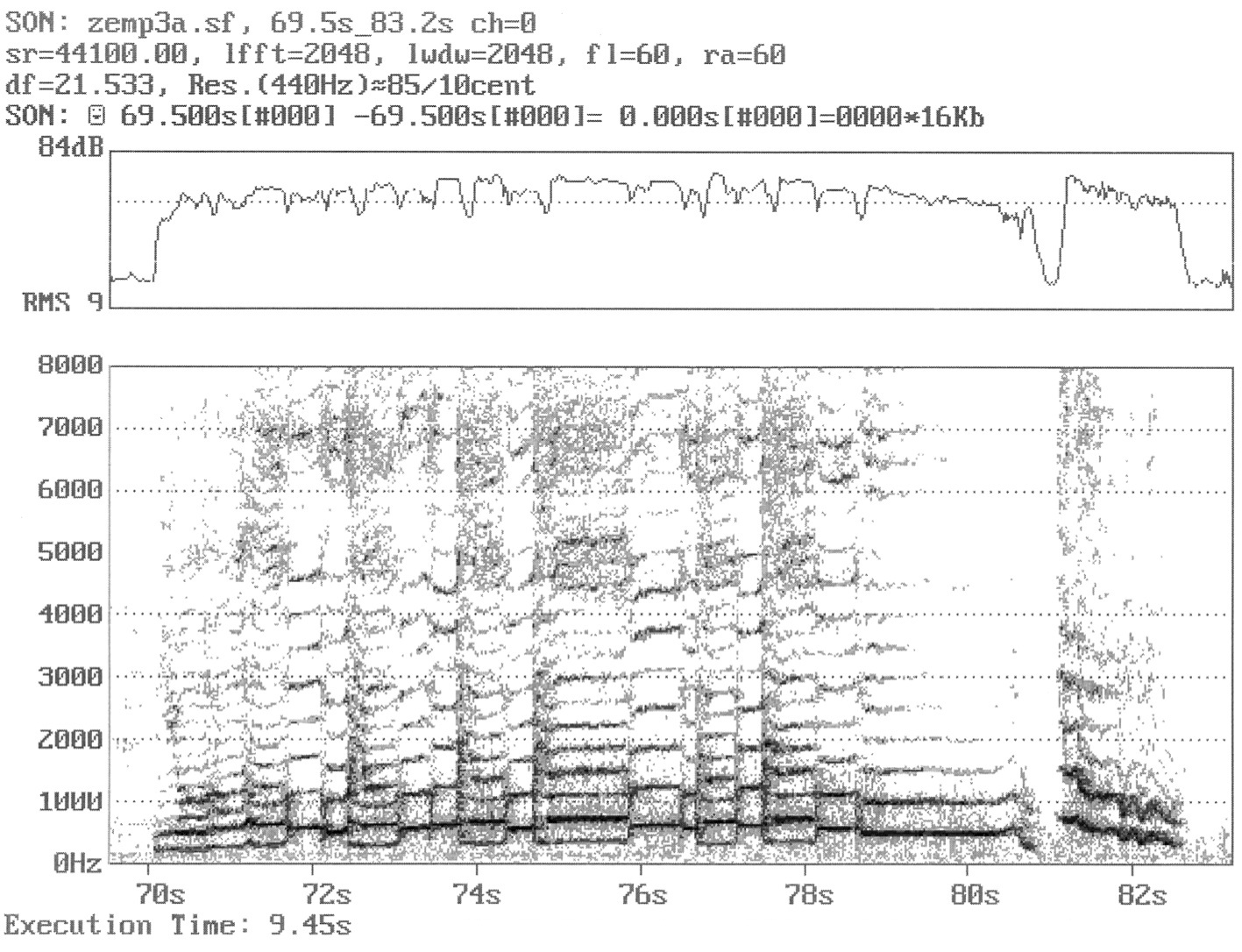
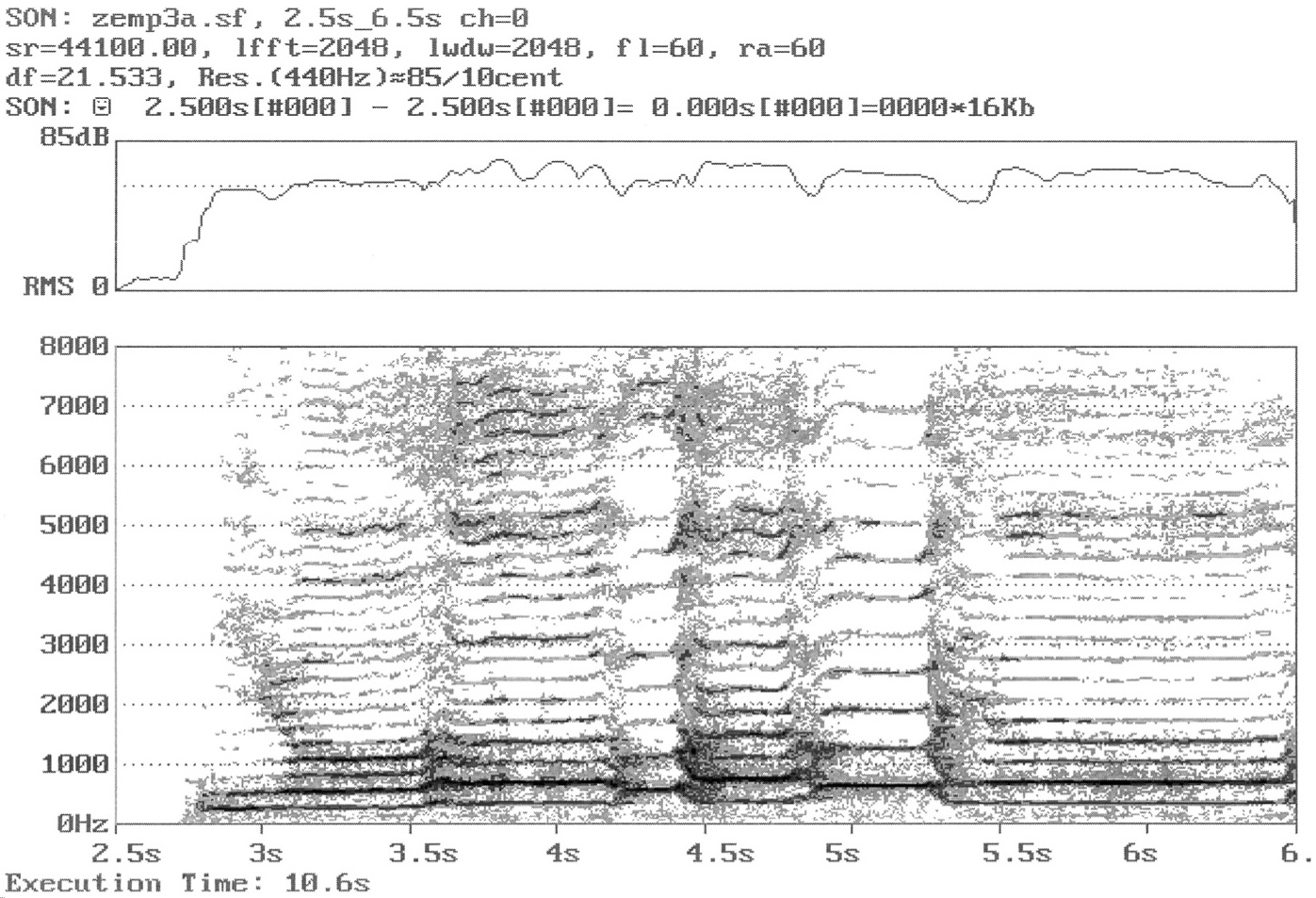
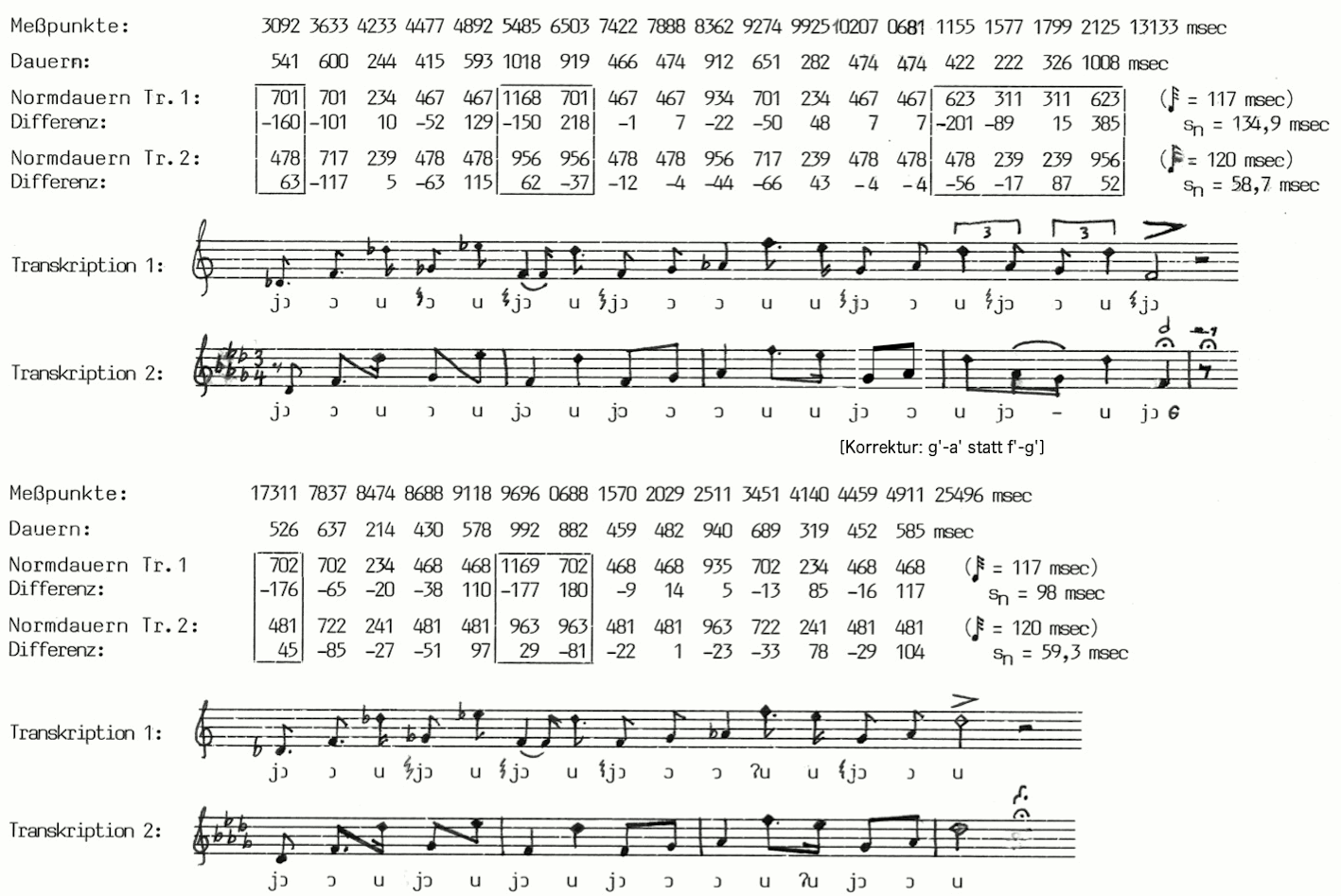


Transkription 1: F. Födermayr (Födermayr 1994: 246)
Transkription 2: H. Fritz
| 0326 | 1185 | 1748 | 2015 | 2437 | 2859 | 4015 | 4756 | 5400 | 5881 | 6830 | 7437 | 7652 | 8200 | 8659 | 8993 | 9319 | 9644 | 10481 | msec |
| 859 | 563 | 267 | 422 | 422 | 1156 | 741 | 644 | 481 | 949 | 607 | 215 | 548 | 459 | 334 | 326 | 325 | 837 | msec Dauer | |
| 708 | 708 | 236 | 472 | 472 | 1181 | 708 | 472 | 472 | 944 | 708 | 236 | 472 | 472 | 630 | 315 | 315 | 630 | Normdauer | |
| 151 | −145 | 31 | −50 | −50 | −25 | 33 | 172 | 9 | 5 | −101 | −21 | 76 | −13 | −296 | 11 | 10 | 207 | Differenz |
Standardabweichung der Differenzen sn = 112,6 msec (1. Segment des Jodels)
Die Standardabweichung, die ein Maß für die durchschnittliche Beschreibungsgenauigkeit der Transkription darstellt, ist deutlich geringer als im
1. Segment von Abb. 22, nur fünf Differenzen sind größer als die Normzweiunddreißigstel und in den umrandeten Feldern, die denen in Abb. 22 entsprechen, ist die Passung besser. Die Messung wurde diesmal mit einer anderen Methode durchgeführt: Es wurde das Signal bis zum Meßpunkt abgehört und der Meßpunkt dann so eingeregelt, daß der Beginn des quasistationären Grundtones gerade hörbar wurde. Aus der verschiedenen Meßmethode erklären sich die verschiedenen Dauerwerte auch bei Jodelsilben die kein |j| enthalten. Doch ist die unterschiedliche Fassung der Transkription keineswegs durch die unterschiedliche Meßmethode erzeugtes Artefakt. Um die Methodenabhängigkeit der Meßwerte zu überprüfen, wurden mit der zweiten Methode auch die Vokalbeginne nach den |j| gemessen und die Meßergebnisse mit den beiden Transkriptionen verglichen. Als Beispiel wurde wiederum das erste Segment des Jodels gewählt:
0622 1185 1748 2015 2437 3007 4015 4941 5400 5881 6830 7437 7726 8200 8659 9089 9319 9644 10644 msec 563 563 267 422 570 1008 926 459 481 949 607 289 474 459 430 230 325 1000 msec Dauer
699 233 466 466 1165 699 466 466 932 699 233 466 466 622 311 311 622 Normauer −136 35 −44 104 −157 227 −7 15 17 −92 56 8 −7 −192 −81 14 378 Differenz
477 716 239 477 477 954 954 477 477 954 716 239 477 477 477 239 239 954 Normdauer 86 −153 28 55 93 54 28 −18 4 −5 −109 50 −3 −18 −47 −9 86 46
Die Standardabweichungen unterscheiden sich kaum von denen in Abb. 22 und die extremen Abweichungen treten an den selben Stellen auf, das Ergebnis erweist sich als von der Meßmethode weitgehend unabhängig.
153Damit kann auch als erwiesen gelten, daß die durchschnittliche Abweichung der Transkription 1 (zumindest im 1. und 2. Jodelsegment) bedeutend geringer ist, wenn als Tonbeginn prinzipiell das Erreichen der quasistationären Grundtonhöhe angesehen wird, auch auf stimmhaftem Konsonanten. Der Schluß, daß hier nicht die rhythmisch relevanten Ereignisse, sondern die Bewegung der Grundtonhöhe zu beschreiben beabsichtigt ist, liegt umso näher, als diese Transkription im Rahmen einer auf eine Typologie des Jodelns
abzielenden Untersuchung der gesanglichen Stimmgebung erstellt wurde, wobei die Charakteristik der Melodie [...] als typologisches Merkmal nur insoweit in Betracht [kommt], als sie durch den Registerwechsel bestimmt ist
und unter anderem das Häufigkeitsverhältnis von Brust‐ und Falsettregister
eine Rolle spielt (Födermayr 1994: 256). Die beiden Transkriptionen sind demnach, was die Zeitverhältnisse angeht, gar nicht miteinander vergleichbar, weil sie sich auf qualitativ verschiedene Daten beziehen. Der Vergleich kann mit dieser Bemerkung abgeschlossen werden.
Übrigens treten auch in Abb. 23 und 24 Unterschiede zwischen den Transkriptionen ausschließlich an Stellen auf, an denen eine verschiedene Zeitmessung beim |j| als Ursache in Frage kommt.
Transkription 2 beschreibt die Meßdaten mit der geforderten Genauigkeit, die Abweichung überschreitet nie den Wert einer Zweiunddreißigstelnote, die Standardabweichung liegt bei maximal einer Vierundsechzigstel. Die Penultima erscheint in allen sechs Segmenten gegenüber der Notation gedehnt, beim Schluß des Nachsatzes im allgemeinen mehr als beim Schluß des Vordersatzes. Diese Dehnung fällt jedoch meinem Gehör kaum auf. Ebensowenig die Dehnung der Viertelnote in Takt 3 und Takt 6 in Abb. 23. Sie könnte als Ausdruck des Endes einer motivischen Phrase gedeutet werden. Die Abweichungen in Takt 1 in Abb. 22 sind als geringfügige Tempoverlangsamung am Niederstreich von Takt 2 hörbar. Überhaupt scheinen die Abweichungen am Papier größer zu sein als die wahrgenommenen. Der interessanten Frage, wie weit ich die realen Dauerverhältnisse auf Grund meiner musikalischen Deutung zurechthöre, will ich nicht weiter nachgehen.
Es gilt nun noch einige Details zu besprechen. Achteltriolenschreibung hätte die Beschreibungsgenauigkeit der Transkription noch verbessern können. Der Verzicht ist damit begründbar, daß es keinerlei Verdachtsmomente dafür gibt, daß ein Unterschied zwischen Triolenachtel und Sechzehntel phonemische
Bedeutung hätte. Die Statistik der Dauern (Abb. 25) zeigt zwar zwei Gipfel, einen bei der Normsechzehntel von 0,23 sec und einen bei der Normachteltriole von 0,31 sec. Doch stammen zwei dieser Triolen
aus den Zweisechzehntelgruppen Abb. 22 Takt 4 und Abb. 23 Takt 4. Betrachtet man nur die Werte nach einer
154
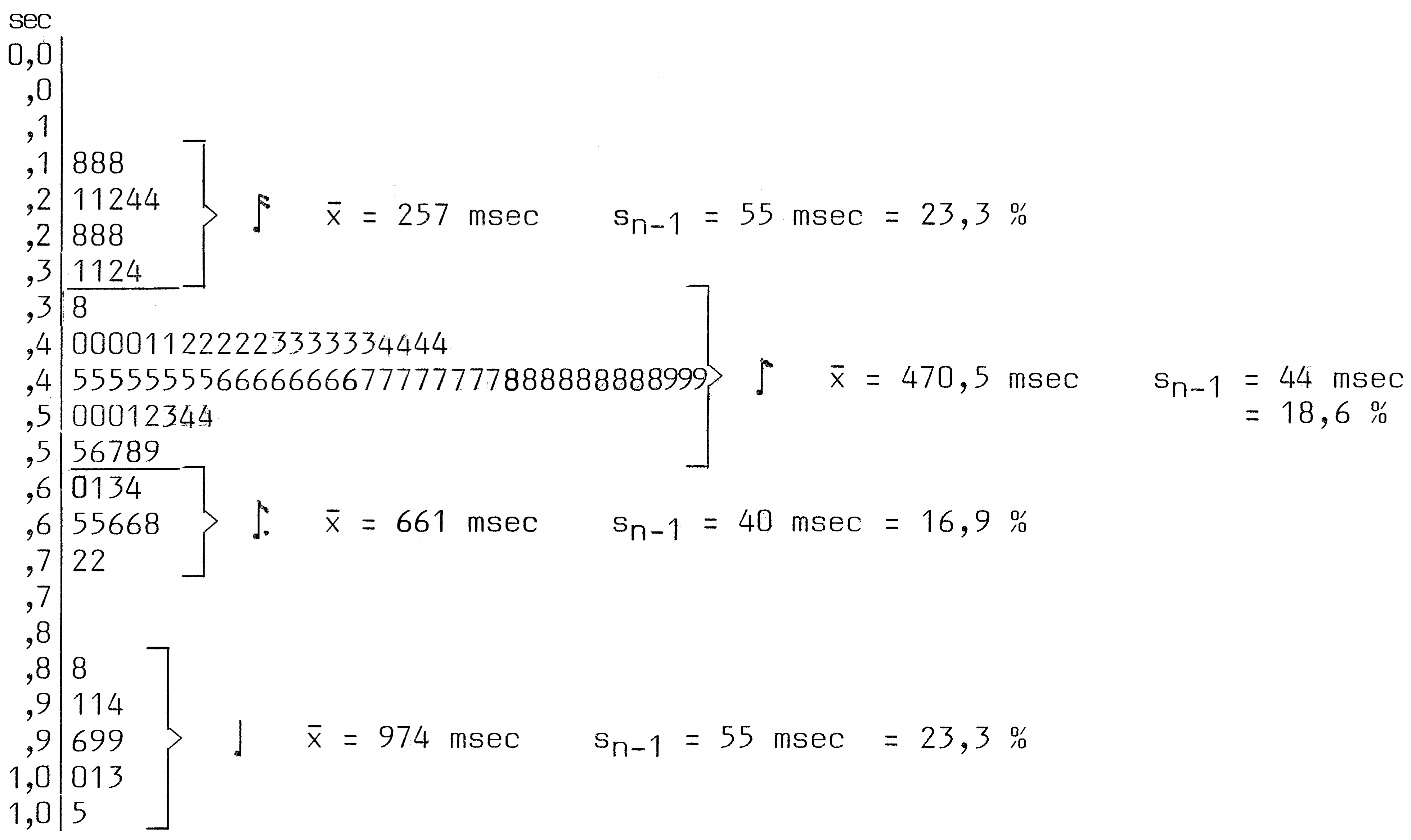
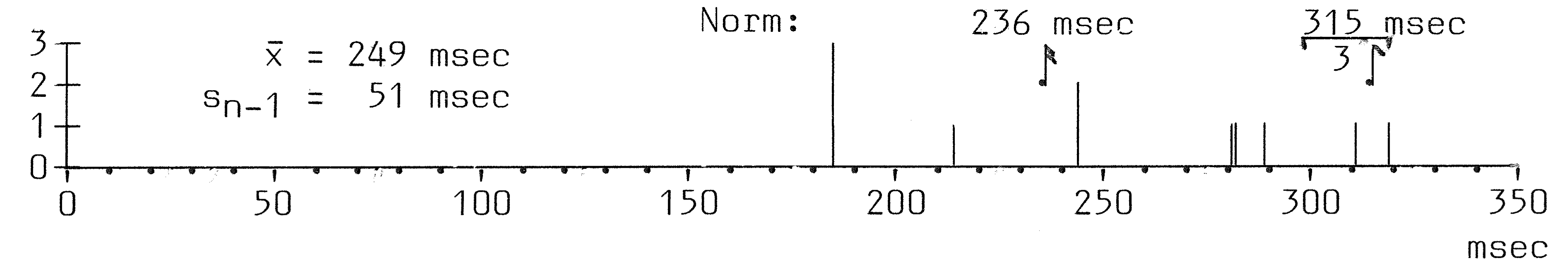
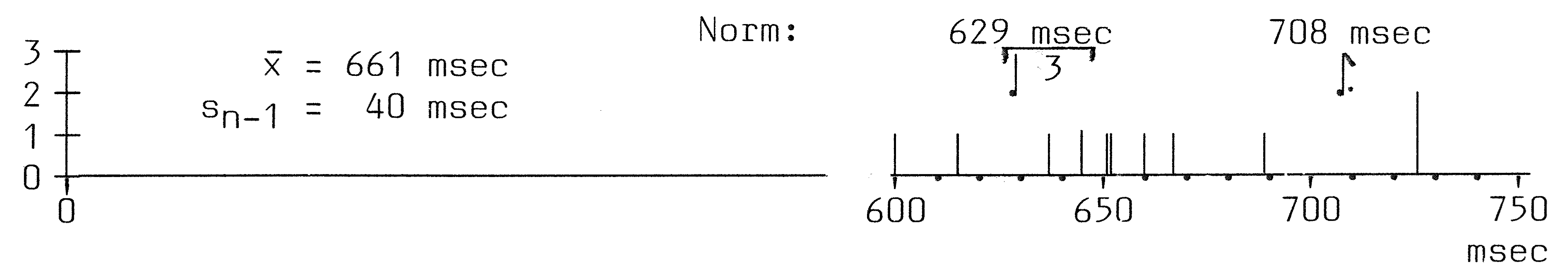
Ebensowenig kann die Verteilung der Dauern der punktierten Achteln (Abb. 27) die Hypothese stützen, daß ein konzeptueller Unterschied zwischen punktierter Achtel und Triolenviertel bestünde. Fragt man nun, welche Proportion hier eigentlich intendiert ist oder wie man das Verhältnis zwischen langem und kurzem Ton am besten schreiben sollte, so geben die Zahlen keinen eindeutigen Hinweis. Die Durchschnittsdauer der kurzen Werte liegt näher bei der Normsechzehntel, die der langen etwa in der Mitte zwischen punktierter Achtel und Vierteltriole.
155Die Durchschnittsdauer der langen Töne ist 2,65 mal so groß wie die der kurzen.
2,56 liegt etwas näher bei 3 als bei 2, das stützt die von mir intuitiv gewählte Schreibung als punktierte Achtel mit darauffolgender Sechzehntel. Die Variationsbreite dieser Proportion reicht freilich von überpunktiert
4:1 bis triolisch
2:1 und es kann nicht davon ausgegangen werden, daß hier ein rationales Verhältnis intendiert wird.
Eine leichte Inharmonizität weist das Verhältnis zwischen Durchschnittsviertel und Durchschnittsachtel auf: Statt 2:1 beträgt es 2,07:1 (vgl. Abb. 25). Das hat hat zwei Ursachen: Einige Viertel sind als musikalische Phrasenenden gedehnt, sieben der elf Viertel stehen im etwas langsameren ersten Teil.
In Abb. 25 Fällt ferner auf, daß die Verteilung der Dauern zwischen der Viertel und der punktierten Achtel einen leeren Zwischenraum aufweist, jedoch nicht zwischen punktierter Achtel und Achtel, ebensowenig zwischen Achtel und Sechzehntel. Die Antwort auf die Frage, wie der Hörer denn trotzdem Sechzehntel und punktierte Achtel von der Achtel unterscheiden könne, liegt natürlich im Metrum, das der Hörer als Bezugskonfiguration
entwickelt und dessen Puls in durchlaufenden Achteln besteht. Diese sind wohl irgendwie in Schlägen
und Takten
organisiert und es darf die Frage gestellt werden, ob in den Meßdaten von Abb. 22﹣24 irgendwelche Anhaltspunkte für die Struktur eines von der Sängerin intendierten Metrums liegen? Läßt sich die in Transkription 2 ausgesprocheene Behauptung, daß die Achteln binär organisiert sind, stützen oder kontraindizieren? Die im Ausführungsprofil graphisch dargestellten Abweichungen können zwar nicht für die Betonungsverhältnisse, wohl aber für die Organisation (binär oder ternär) ein Indiz sein. Die Konfiguration der Abweichungen ist dort deutlicher sichtbar als in der bloßen Zahlenreihe.
Beim ersten Teil des Jodels wurde auf ein Aufführungsprofil verzichtet, weil er zuwenig Achteln aufweist, auf die diese Untersuchung abzielt. Ferner hat schon Wolfgang Sichardt bei diesem Teil einen binären Puls angenommen (Notenbeispiel 43 und 44), sodaß hier wenigstens die metrische Basisstruktur nicht kontroversiell ist. Auch Franz Födermayr mag an eine binäre Organisation gedacht haben, jedenfalls bezieht sich seine Metronomangabe auf die Viertel (und nicht auf die Achtel oder die punktierte Viertel, siehe Notenbeispiel 17). Diese Metronomangabe bezieht sich auf alle drei Teile des Jodels. Sichardt nimmt nun einen Metrumwechsel an und notiert im zweiten Teil einen ternär strukturierten Puls (Notenbeispiel 44. Der Metrumwechsel wird durch die Notation verschleiert, vgl. die Metronomangaben im 1. und im 2. Teil!). Das Ausführungsprofil Abb. 28 gibt diesbezüglich wenig Anhaltspunkte, es deutet im Wesentlichen an, daß sowohl der Vorder‐ als auch der Nachsatz aus je zwei Phrasen bestehen (Dehnung der Viertel).
156
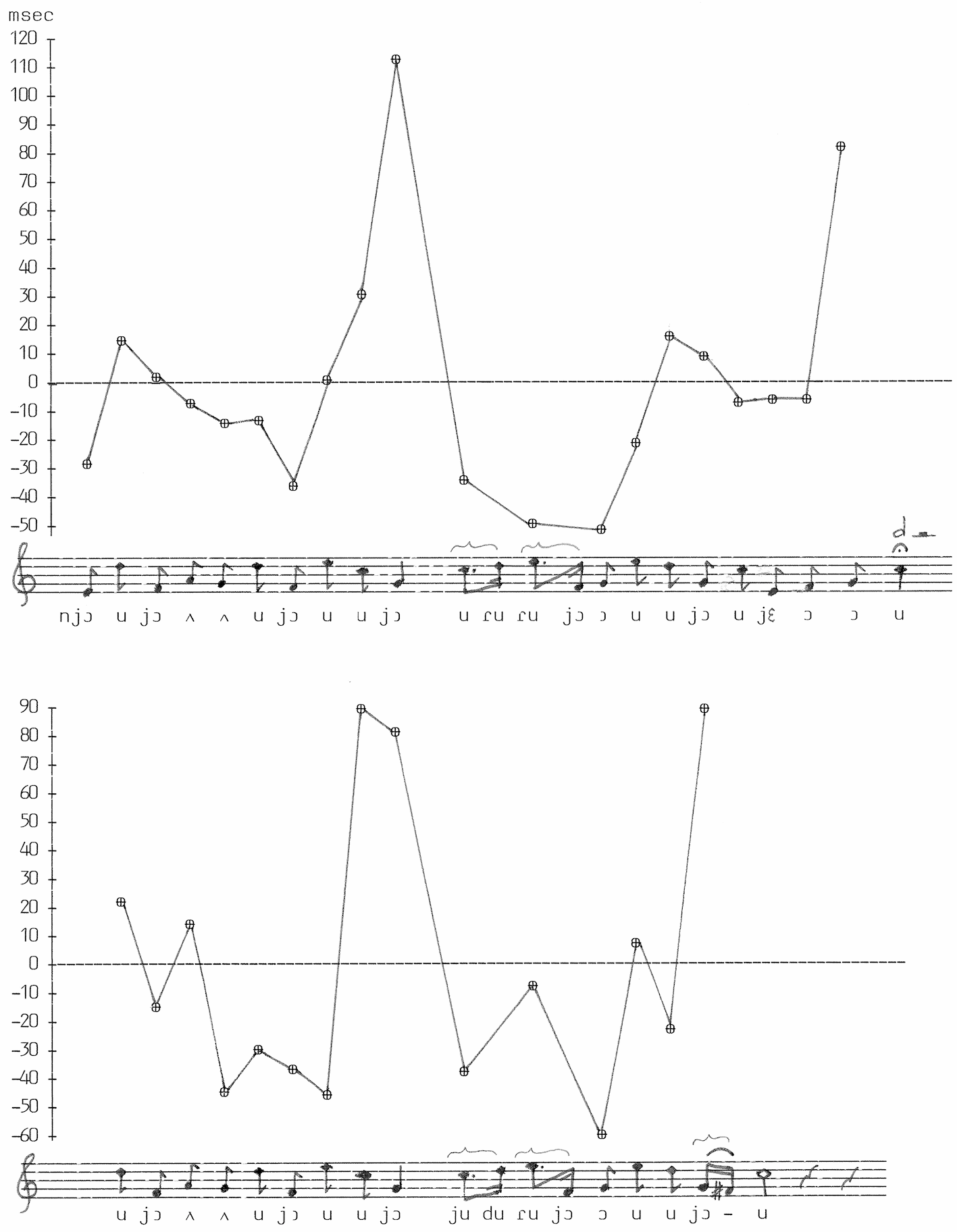
3. und 4. Segments eines Jodels von Emmi Suter﹘Gwerder (Zemp 1990: 3a)
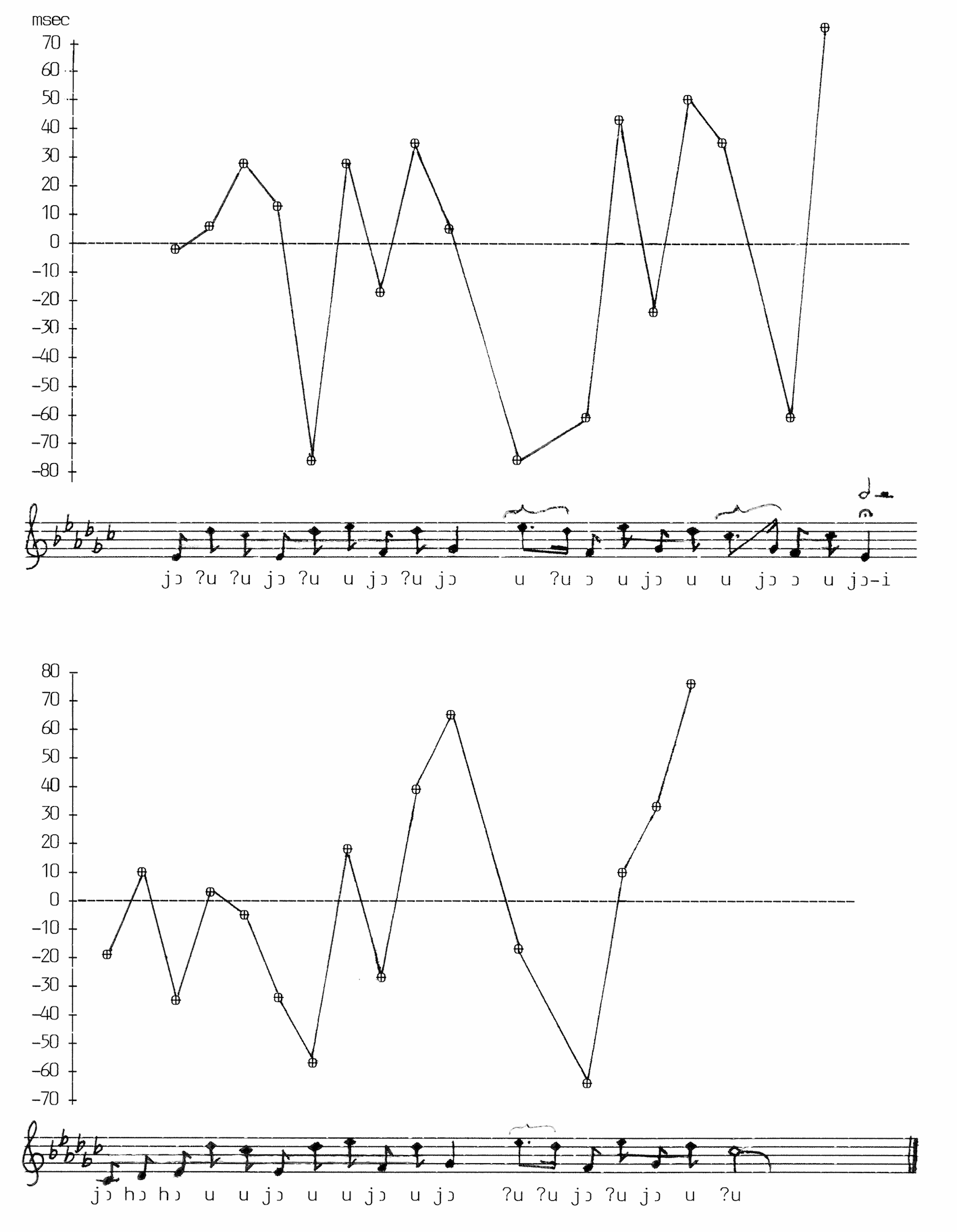
Vielleicht ist es kein Zufall, daß sich dieser Wechsel in der zweiten Hälfte des Vordersatzes fortsetzt. Auch hier dauern die geradzahligen Achteln länger als die ungeradzahligen. (Im Nachsatz erfolgt statt dieses Wechsels ein Schlußritardando).
Übrigens weist auch der Nachsatz des zweiten Teils am Beginn (erste bis sechste Achtel) dieses Zick-Zackmuster im Ausführungsprofil (Abb. 28) auf. Doch kehrt sich die Bewegungsrichtung bei der siebten und achten Achtel (vielleicht wegen des Phrasenendes) um und ist auch in der zweiten Phrase gegenläufig. Ferner fehlen diese Muster im Vordersatz. Die Indizien für eine binäre Organisation sind schwach, – Anhaltspunkte für eine ternäre sind nicht vorhanden.
Insgesamt stützen diese Daten eher die Hypothese einer binären Ordnung der Achteln. Damit ist freilich nichts über die Betonungsverhältnisse ausgesagt.
Nach dem im theoretischen Kapitel explizierten Gesetz der möglichst wenig hinzugedachten Schwerzeiten
liegt von den zwei möglichen Lösungen jedoch nur eine nahe und zwar die, die in Transkription 2 (Abb. 22﹣24) durch die Balken ausgedrückt ist. Die weiterführende Frage ist nun, ob die Meßdaten auch Anhaltspunkte für die Organisation dieser Viertelschläge enthalten. Meine Transkription behauptet einen Dreivierteltakt. Doch wurde schon im Theoriekapitel darauf hingewiesen, daß im dritten Teil des Jodels auch ein Zweivierteltakt intuitive Plausibilität beanspruchen kann. Dieser wäre auch im ersten und zweiten Teil denkbar. Wolfgang Sichardt nimmt im ersten Teil Taktwechsel (2/4 und 3/4) an.
Die Ausführungsprofile Abb. 30﹣32 geben leider keinen Anhaltspunkt für die metrische Organisation der Vierteln. Sie zeigen lediglich die Phrasierung an: Ein Segment besteht aus zwei Phrasen. Die erste schließt mit der ersten auftretenden Viertelnote. Diese ist gedehnt, ebenso die Viertel davor, genaugenommen die Achtel davor, wie Abb. 22﹣24 zeigt. Die zweite Phrase schließt
159
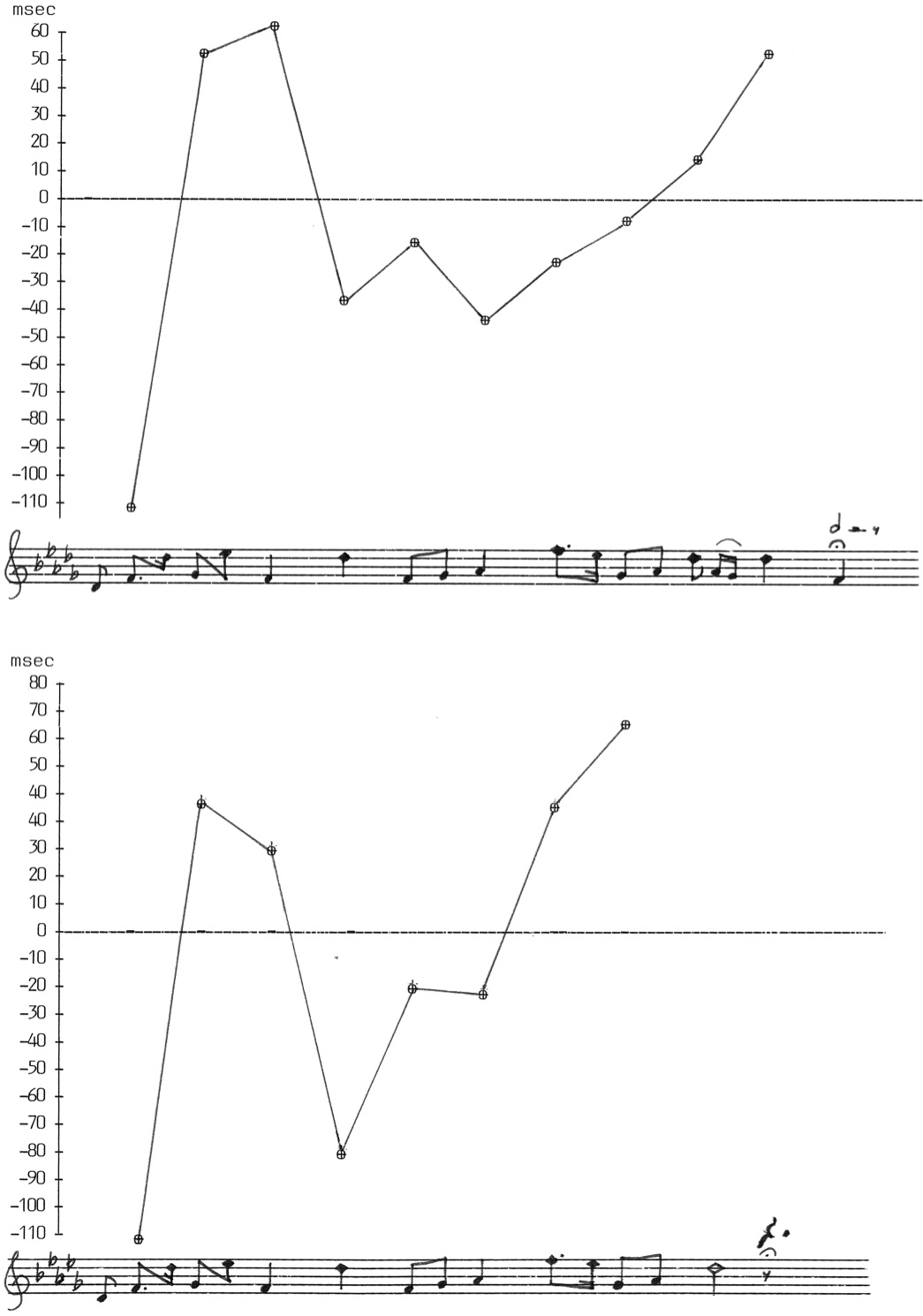
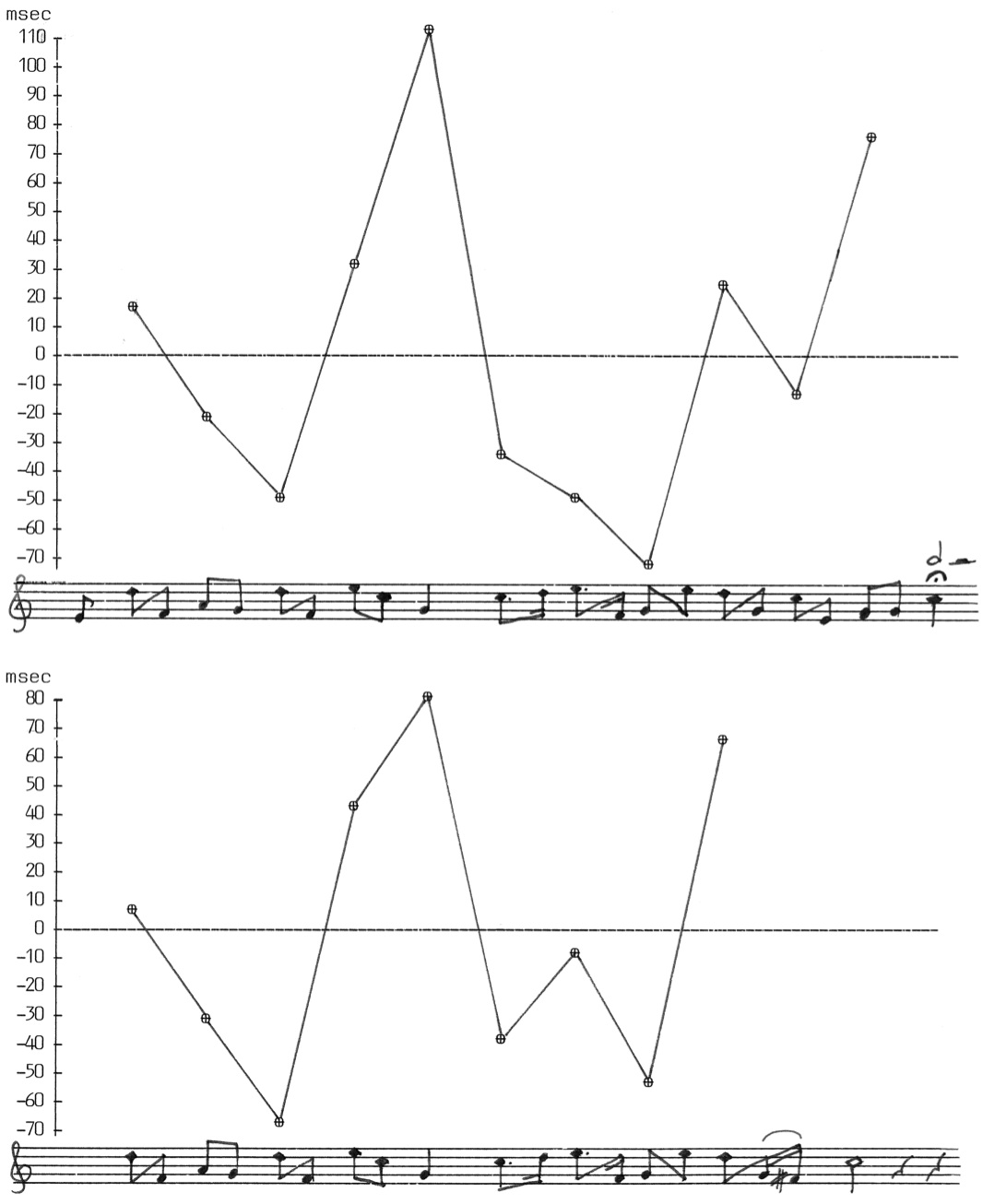
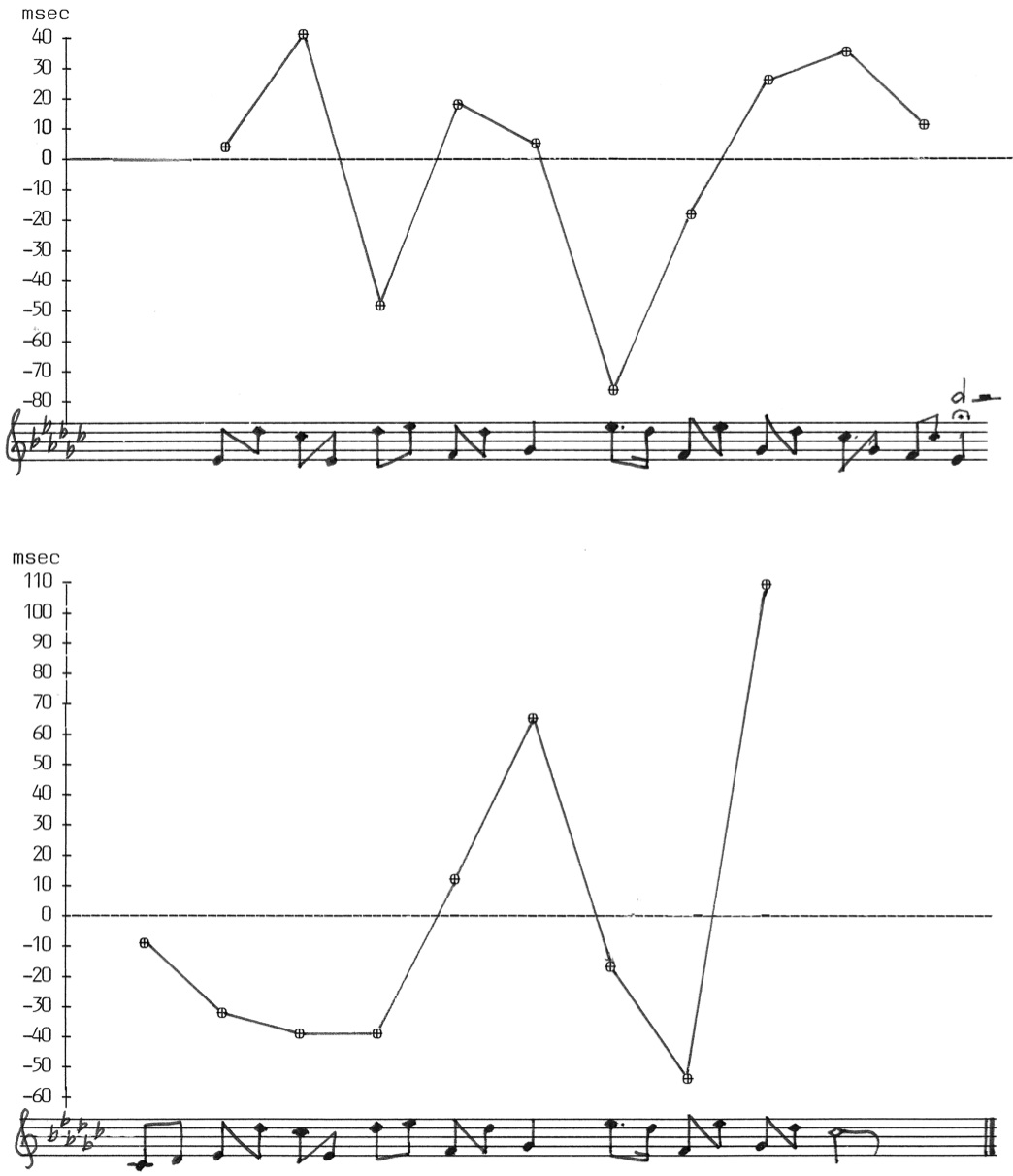
Um die 3/4-Takt-Hypothese aufzustellen, bedarf es jedoch bei diesem Juuz gar keiner sonagraphischen Meßdaten als Anhaltspunkte, weil in der dreistimmigen Fassung der Gebrüder Schmidig (Notenbeispiel 43c) die Baß‐ und Harmoniewechsel den Takt eindeutig angeben. Die Frage, ob alle Juuzer das Stück metrisch gleich auffassen, ist grundsätzlich zu stellen. Doch Emmi Suter﹘Gwerder ist tot, wir können sie nicht mehr fragen.
Nun bleibt nur noch die Regelmäßigkeit zu zeigen. Hierzu wird durch Aufsummierung der Abweichungen für jeden metrisch relevanten Meßpunkt die kumulative Abweichung berechnet. Es werden in Abb. 33 lediglich die Vierteln betrachtet. Die Frage, die in Abb. 33 beantwortet wird, könnte auch lauten, ob die Abfolge der Vierteln mit dem Metronom hinlänglich genau Schritt hält. Die Maximalabweichung vom metronomisch exakten Schlag wird berechnet als die Hälfte der Differenz zwischen der weitesten positiven und der weitesten negativen kumulativen Abweichung. Bei einem zum richtigen Zeitpunkt gestarteten Metromom hat dann sowohl die positive als auch die negative Maximalabweichung genau den errechneten Betrag.
Die Folge der kumulativen Abweichungen müßte eigentlich mit Null enden. Daß sie das nicht tut, liegt an der Summierung der Rundungsfehler, die bei der Berechnung der Normdauern gemacht wurden. Der sich auf die Berechnung der Maximalabweichung fortpflanzende Fehler ist jedoch kleiner als die Meßgenauigkeit von 7,4 msec. Die Maximalabweichung muß mit einem Toleranzbereich von ±7,4 msec bzw. ±0,8 % gelesen werden.
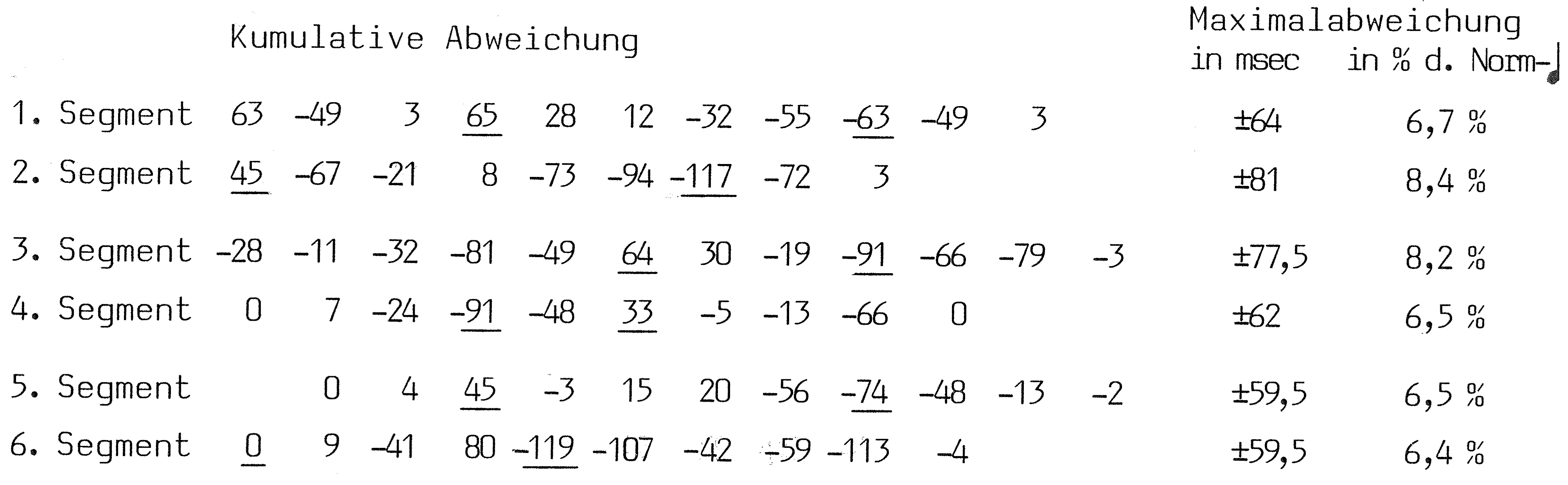
Die Maximalabweichung ist also gering, sie ist ungefähr von der Größe einer Triolenzweiunddreißigstel. Das entspricht meiner Erfahrung, daß ein auf die richtige Geschwindigkeit eingestelltes Metronom problemlos mit dem von mir empfundenen Schlag (Vierteln) oder Puls (Achteln) mitläuft.
Letztlich ließe sich von der Folge der kumulativen Abweichungen auch noch die Standardabweichung berechnen. Von eher theoretischem Interesse wäre dann der Zusammenhang zwischen den vier Größen: Maximalabweichung und Standardabweichung der Transkription von den gemessenen Dauern sowie Maximal‐ und Standardabweichung der Transkription von der Meßpunktfolge (bzw. einer Teilfolge, z. B. einer regelmäßigen Teilfolge). Doch möchte ich auf dieses interessante Thema nicht eingehen, sondern vielmehr nochmals darauf hinweisen daß das Vorliegen von Regelmäßigkeit auf der physikalischen und psychoakustischen Ebene nicht per se schon Nonrubatointerpretation bedeuten muß. Denn es wären Dehnungen und Stauchungen um einen rationalen Faktor denkbar, die der Interpretation nur äußerlich den Anschein von Nonrubato geben: Daß trotz Regelmäßigkeit ein Rubato vorliegt, würde erst entdeckt werden können, sobald der musikalische Sinn verstanden ist.
164Ein Jodel von Anton Büeler
Im Rahmen der Schweiz-Exkursion des Instituts für Musikwissenschaft im Jahre 1993 fand eine Befragung von Toni Büeler in seiner Wohnung in Muotathal statt, bei der Büeler auch einige Jüüzli vortrug, teils solo, teils zweistimmig mit seiner Tochter Cornelia Büeler[Eine kurze Textpassage wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen]. Von dieser Befragung existiert eine Video-Hi8‐ und eine DAT-Aufnahme. Die Jodelinterpretation, die ich im folgenden analysieren werde, befindet sich nur auf der Video-Aufnahme, und hier fehlt vom 1. Teil das erste Segment (Vordersatz). Die Kamera wurde erst während des Ausklingens des letzten Tones des Vordersatzes eingeschaltet. Doch ist diese Unvollständigkeit für den Zweck meiner Analyse unerheblich.
Während meiner Muotatal-Feldforschung, als Peter Betschart und ich Toni Büeler am 10. 4. 1996 besuchten, berichtete er, [Eine kurze Textpassage wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen] als Älpler
(Sommer 1958 und 59), als Holzer
(Winter 1958 und 59), als Knecht
(Knecht 1959) sowie in einer Schreinerei gearbeitet hat. 1959 ging er von Muotathal nach Nidwalden, wo er 1960﹣63 eine Lehre machte und bis 1971 als Bäcker und Konditor arbeitete. 1971 kehrte er nach Muotathal zurück, wo er 23 Jahre lang Gemeindekassier (1971﹣94) war und jetzt als Wildhüter (ab 1994) tätig ist. Anton Büelers Vater war Bauer und Bauarbeiter, die Mutter Bäuerin.
Toni Büeler hat als Schulbub noch den legendären Jodler Wichel Wisi auf einer Kilbi (= Kirtag) erlebt. So söt ma könne juuze
, habe er bei sich gedacht, erzählte uns Toni Büeler. 21 Jahre lang (Jänner 1963 bis 1984) hat er im Chor von Leuthold gesungen (Stanser Jodlerbuebe
), Seit 1973 singt er im Chor Muotathal. Seit 1963 ist er im Jodlerverband. 1964 trat er das erste Mal bei einem Jodlerfest mit einem Solojodel auf und zwar mit einem Muotataler Juuz. Er kam damit bei den Juroren nicht an, auch nicht 1965 und 1966. Daraufhin versuchte er es 1967 und 86 mit einem Nidwaldener Jodel und hatte damit Erfolg. Erst als er damit sein Können bewiesen hatte, gelang es ihm dann, auch mit Muotataler Jodeln Anerkennung zu finden. Daß der Jodlerverband die Muotataler Eigenart schließlich akzeptiert habe, sei vor allem Leuthold zu verdanken.
Büeler schildert diesen Hergang als Lernprozeß des Jodlerverbandes. Sich selbst sieht er als den Vorkämpfer, dem es gelungen war, dem Muotataler Juuz im Zentralschweizer und im Eidgenössischen Jodlerverband die Anerkennung zu verschaffen. Peter Betschart sagte mir später, daß diese Geschichte auch eine andere Lesart zulasse, nämlich daß sich Büeler einige im Jodlerverband übliche und von der traditionellen Muotataler Manier verschiedene Vokaltechniken angeeignet habe und daß darauf sein Erfolg im Jodlerverband gründe.
165Betschart regte an, der Frage genauer nachzugehen. So sehr mich die Frage interessiert, ich kann sie im Rahmen dieser Arbeit nur rudimentär und nebenbei behandeln. V. S., [Eine kurze Textpassage wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen] Muotathal, sagte mir, Toni Büeler habe die schönste Männerstimme und es stünden ihr die Haare am Arm, wenn er juuze. Aber er juuze nicht auf die typische Muotataler Art, sondern sei vom Jodlerverband beeinflußt (Befragung am 11. 4. 1996). Nicht uninteressant sind in diesem Zusammenhang die Kommentare der Kampfrichter in den Festberichten der Jodlerfeste, an denen Büeler teilnahm. Anton Büeler hat sie mir dankenswerterweise zum Fotokopieren geliehen, ich gebe das seine Darbietungen Betreffende im Anhang wieder. Auch rezeptionsgeschichtlich sind diese Kommentare bemerkenswert: Von der Kirchentonart (Phrygisch)
ist 1964 die Rede und 1972 dauert [es] fast bis zum Schluß, bis sich eine eindeutige Tonart (C-Dur) herausschält
, d.h. bis der Kampfrichter, der den Bericht schreibt, eine eindeutige Tonart erkannte. 1975 ist man an altphrygische Melodik
erinnert. Mit linear melodischen Motiven
wird
1981 das Fremde
des Dargebotenen erklärt und 1984 schließlich zugegeben, daß
dieses eigenartige Gebilde mit seinen wilden Tonsprüngen [...] für jeden Kampfrichter, der nicht aus der Gegend stammt, gewisse Probleme [stellt]
.
Die 1981 verwendete Erklärungsformel linear melodisch
dürfte auf Heinrich J. Leuthold (und damit letztlich auf Sichardt) zurückgehen. Leutholds Buch kam ja 1981 heraus. Möglicherweise saß Leuthold selbst in der Jury und verfaßte den Kommentar zu Anton Büelers Darbietung. Waren es für Sichardt lediglich die großen Sprungintervalle, namentlich Sexten und Septimen
, die hier
, d.h. im Altstil des Muotatals
, keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion
(Sichardt 1939: 30), so ist es bei Leuthold " [haben]die Melodieführung
schlechthin, die immer nur linear melodisch, nie harmonisch empfunden [ist]
(Leuthold 1981: 100).
Linearität wird also in erhöhtem Maße als Erklärung beansprucht und zwar, wie ich annehme, für die harmonische Desorientierung, die im Hörer bei einstimmigen Interpretationen Muotataler Jüüzli entsteht. Da beim Jodel sonst an den Harmoniewechseln der Takt deutlich wird, führt die harmonische Desorientiertheit zu einer metrischen Desorientiertheit, die sich dann in der Rede von freien Rhythmus
niederschlägt wie im Kommentar des Kampfgerichts zu Büelers Darbietung am zentralschweizerischen Jodlerfest in Sursee 1985.
Damit war vielleicht gar nicht Rubato
gemeint, sondern regelmäßige Tonfolge, aber ohne erkennbaren metrischen Zusammenhang
. Denn in allen mir bekannten Aufnahmen (Schallplatten, Exkursion 1993) interpretiert Büeler die Jodel mit großer Regelmäßigkeit.
Diese Regelmäßigkeit zeigt sich auch in der sonagraphierten Jodelinterpretation von der Exkursieon 1993 (Abb. 45 u. 46), sie ist etwa genauso groß wie in der
166
Interpretation von Emmi Suter﹘Gwerder. Umso erstaunlicher klingt daher Heinrich J. Leutholds Anmerkung zu einer früheren Interpretation Büelers (Notenbeispiel 13): Eine Viertelnote ist hier nicht einfach eine Viertelnote. Sie wird, je nach Lust und Laune des Sängers, bald etwas länger gehalten, bald verkürzt
(Leuthold 1981: 58). Diese Beschreibung kann nur als Beschreibung einer Rubatointerpretation verstanden werden. Da aber Büelers Interpretationen regelmäßig sind, müßte es sich bei den Rubati, die nach Leutholds Verständnis vorhanden sind, um Dehnungen oder Stauchungen um einen rationalen Faktor handeln. Um herauszufinden, welche Viertelnote Leuthold vielleicht gemeint haben könnte, habe ich seine Aufzeichnung der früheren Interpretation mit den Meßwerten der Interpretation von 1993 in Beziehung gesetzt und mit meinen Transkriptionen verglichen (Abb. 39﹣41). Der Übersichtlichkeit halber wurden die Notenwerte im ersten Teil seiner Transkription halbiert. (Warum Leuthold den 1. Teil mit Vierteln, den 2. mit Achteln schrieb, ist nicht auszumachen, zumal in keiner der mir bekannten Varianten von Toni Büeler, Emmi Suter﹘Gwerder, Erasmus Betschart und den Gebrüdern Schmidig ein Tempowechsel vorgenommen wird, ja zweite Teile in schnellerem Tempo im traditionellen Muotataler Juuz überhaupt nicht vorkommen, von dem einzigen Beleg bei Gaßmann (Gaßmann 1961: 181 f. Nr. 8) abgesehen. Auch Peter Betschart hält den von Leuthold notierten Tempowechsel für unzutreffend. Hat Büeler Leuthold diesen Teil langsamer vorgesungen, um ihm das Aufzeichnen zu erleichtern?).
Büelers Interpretation von 1993 unterscheidet sich von seiner früheren in drei Punkten: Erstens ist ein dritter Teil angehängt, der sich auch in der Interpretation Emmi Suter﹘Gwerders, nicht aber in den Varianten Erasmus Betscharts und der Gebrüder Schmidig findet. Zweitens sind einige zusätzliche kurze Töne eingeflochten und zwar hauptsächlich die von Leuthold Fa-Nachschläge
genannten Verzierungen. Drittens ist im ersten und im 2. Teil je ein Melodieton verändert und zwar ist die 6. melodische Stufe einmal durch die 4., einmal durch die 9. ersetzt, womit eine der Variante Emmi Suter﹘Gwerders ähnlichere Gestalt entsteht. (Vgl. Abb. 39﹣40 mit Abb. 22﹣23). Peter Betschart teilte mir mit, daß Toni Büeler den dritten Teil von Josef Ulrich (geb. 1943) bereits vor 1975 übernommen hat.
Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen der Interpretation Büelers 1993 und allen anderen Interpretationen dieses Jodels einschließlich der von Sichardt transkribierten ist der, daß Büeler inmitten der Melodie Atem holt, was laut Peter Betschart und Hugo Zemp ganz untypisch ist für die Muotataler Interpretationsweise. Man wird darin einen Einfluß der im Jodlerverband üblichen Praxis erblicken dürfen, die Büeler sich in Nidwalden als Vorjodler bei den Stanser Jodlerbuebe
aneignete. Ich vermute, daß Büeler in der von Leuthold
167
aufgezeichneten Interpretation noch nicht dazwischenatmete, denn Leuthold vermerkt 1981 weder eine Pause noch eine Zäsur, während er diese Zeichen in anderen Aufzeichnungen durchaus verwendet. Ein weiteres Indiz ist in Abb. 40 die große Diskrepanz zwischen Leutholds Aufzeichnung und den Meßdaten genau an der Stelle, an der Büeler 1993 dazwischenatmet. Leutholds Aufzeichnung ist hier um eine ganze Viertel kürzer. Diese Stelle wird sich in der Analyse auch aus metrorhythmischen Gründen als bemerkenswert herausstellen.
Abb. 39 zeigt den Nachsatz des 1. Teiles. Die für die metrische Deutung relevante Längendifferenz zwischen beiden Notationen ist umrandet. Leutholds Notation weicht an dieser Stelle nicht nur von Büelers Interpretation von 1993 ab, sondern auch von allen anderen Interpretationen und Transkriptionen dieses Jodels. &ndash Ich halte es für unwahrscheinlich, daß Anton Büeler diese Stelle jemals so interpretiert hat, zumal auch die musikalische Deutung zu einem für den Muotataler Stil ganz untypischen Ergebnis käme, gleich ob man die Aufzeichnung nun als phonetisch
oder als phonemisch
annähme. Wenn also angenommen werden muß, daß Leuthold an der umrandeten Stelle eine halb so kleine Note schrieb, als es der Realität entsprach, dann liegt es nicht ferne, dasselbe auch bei der ersten Note anzunehmen. Denn ein so kurzer Anfangston tritt in keiner Variante und auch sonst in keinem Muotataler Juuz auf. In Büelers 1993er Interpretation ist dieser Anfangston mit einem Fa-Nachschlag
verziert. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Auflösung einer Sechzehntelnote treten zwischen Leutholds Notation und Büelers Interpretation von 1993 sonst keine Diskrepanzen auf, auch nicht bei der Atempause, die, laut meiner in Notation 1 wiedergegebenen metrischen Deutung, den Gleichlauf des Metrums nicht unterbricht. Die Vorschlagsnote in Leutholds Aufzeichnung läßt sich problemlos als Sechzehntel interpretieren.
Auch im 2. Teil (Abb. 40) tritt eine Diskrepanz zwischen Leutholds Notation von 1981 und Büelers Interpretation von 1993 auf. Sie ist schwerer zu deuten, weil auch meine phonemische
Notation 1a hier nicht ohne Rubatoannahme paßt (umrandete Stelle). Sollte am Ende Notation 1b die richtige metrische Deutung sein? Die Annahme eines strengen Nonrubato ließe bei binären Achteln keine andere Lösung zu. Leutholds Balkenschreibung gäbe dann die Betonungsverhältnisse richtig wieder. Die Atempause wäre als Verlängerung um eine Viertel zu deuten. Daß Büeler die Betonungsverhältnisse gerade umgekehrt auffaßt wie etwa die Gebrüder Schmidig (Notenbeispiel 43c). deren mehrstimmige Ausführung das Metrum zweifelsfrei erkennen läßt, ist jedoch ganz unwahrscheinlich, zumal anzunehmen ist, daß Büeler mehrstimmige Ausführungen kennt. Zudem ergäbe die verkehrte Betonung keinen musikalischen Sinn. Es liegt nahe, daß Büeler diesen Teil genauso auffaßt wie die anderen Juuzer und daß die Atempause
168
eine Verlängerung oder eine rationale Dehnung um eine Achtel ist. Ich erblicke darin eine Freiheit des über die Muotataler Interpretationsweise hinausgewachsenen Solisten. Diese Auffassung ist in Abb. 40 im Nachsatz dargestellt. Leutholds Aufzeichnung dürfte dann sowohl die Betonungsverhältnisse als auch die Längen‐ und Dauerverhältnisse unzutreffend wiedergeben. Über das Zustandekommen von Leutholds Auffassung möchte ich folgende Hypothese bilden:
Anton Büeler hat den 2. Teil des Jodels damals noch ohne diese Verlängerung oder Dehnung gejuuzt, und zwar in dieser Form (vgl. mit Notenbeispiel 13):
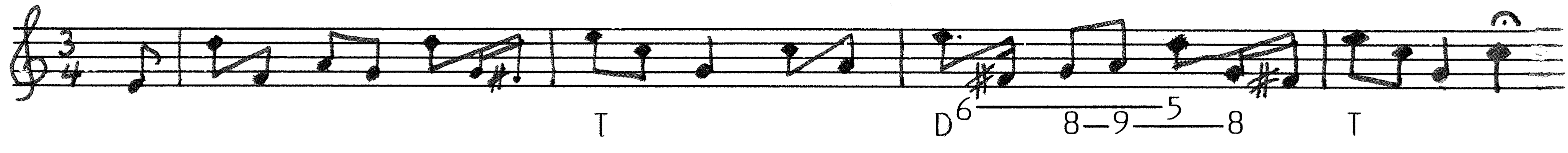
linear melodischen
Deutungsmusters, das er für den Muotataler Juuz vorschlug (Leuthold 1981: 100). Zu Beginn der Melodie folgen nämlich die ungeradzahligen Achteln im Sekundabstand aufeinander, die geradzahligen jedoch nicht:
Melodik des echten Muotathalers
gelangen: Die Melodieführung weist kaum Parallelen zu andern Jodelschöpfungen auf. Sie ist immer nur linear melodisch, nie harmonisch empfunden, obwohl sie dem Dur-Charakter verhaftet bleibt.
(Leuthold 1981: 100).
Da Leuthold nun weiters annahm, daß die Finalis auf schwerer Zeit steht, konnte er die Vierteln nicht wie begonnen bis zum Ende komplikationslos durchzählen.
Er war daher gezwungen, an einer Stelle eine Unregelmäßigkeit anzunehmen. Seine Wahl fiel auf das e vor der als Vorschlag geschriebenen Sechzehntel, er faßte dieses e als gedehnten Wert auf. Warum er die Dehnung nicht notierte wie in seinen anderen Aufzeichnungen (vgl. Notenbeispiel 11 und 14), könnte an dem ad-libitum-Charakter liegen, den er den Tondauern in Büelers Interpretation (en) zuschrieb: Eine Viertelnote ist hier nicht einfach eine Viertelnote. Sie wird, je nach Lust und Laune des Sängers, bald etwas länger gehalten, bald verkürzt
(Leuthold 1981: 58). Da die zwischen Büelers Interpretation und Leutholds Notation auftretenden
169
Diskrepanzen sowohl im ersten als auch im zweiten Teil des Jodels ausschließlich Töne betreffen, die Leuthold als Achtel notierte (vgl. Notenbeispiel 13), muß die genannte Viertelnote
entweder verallgemeinernd oder als Zählzeit gemeint sein. Wie Leuthold zu der Auffassung von ad-libitum-Tondauern kam, ist mir unerfindlich, Zumal sowohl mein Gehör wie auch die Meßergebnisse bei allen Tonaufnahmen dieses Juuz eine große Regelmäßigkeit anzeigen und die musikalische Analyse obendrein einen Nonrubatostil konstatiert, (von dem die Atempause in Büelers Interpretation von 1993 übrigens die einzige Ausnahme ist, die ich in den tönenden Quellen finden konnte). So muß wohl der Schluß gezogen werden, daß Leuthold die Regelmäßigkeit der Tonfolge nicht erkannte, weil er den melodischen Sinn falsch verstand und die rhythmischen und metrischen Fehldeutungen ihm die Sicht verstellten. (Eine Gegenhypothese wäre, daß Büeler in seiner Stanser Zeit mit dem Rubatostil experimentierte. Ich halte sie für wenig wahrscheinlich).
Wolfgang Sichardts und Max Peter Baumanns Thesen lieferten Leuthold das theoretische Rüstzeug, mit dem er zu einer Erklärung des echten Muotathalers
schreiten konnte. Mithilfe der Erklärungsformeln linear melodisch
und freier Rhythmus
setzte er sich im Jodlerverband für die Darbietungen Anton Büelers ein.
Das Unverständnis der Kampfrichter und der übrigen Zuhörer wurde mit dieser Theorie in eine Art Verstehen
umgewandelt, die Theorie hatte hier eine ähnliche Funktion wie manche Ausführungen in Programmheften zu avantgardistischen Musikaufführungen. Den Vergleich mit moderner Musik bringt Leuthold selbst: Die oft ans Skurrile grenzende Melodie kann dem Nichtkenner ein ungläubiges Kopfschütteln entlocken. Und doch wirken diese beiden Typen, der Urmuotathaler und das Büchelgsätzli, in ihrer melodischen und rhythmischen Eigenwilligkeit unerhört modern, wenn sie von wirklichen Könnern dargeboten werden.
(Leuthold 1981: 103).
Leuthold ahnte nicht, wie nahe er mit dem Hinweis auf Vorhalte
(Notenbeispiel 10) der Wahrheit schon gekommen war, daß das linear melodische
Deutungsmuster, wenn es sich nur auf die beim alpenländischen Jodel allerüblichste harmonische Basis stellte, den Schlüssel zum Verständnis des Muotataler Juuz bot und daß dann die gewöhnlichen Taktschemata der musica alpina zutagetreten und ein Nonrubatostil klar erkennbar wird.
Mit dieser Hypothese, zu deren Abstützung es außer dem Aufweis der Regelmäßigkeit auch der noch zu leistenden Stilanalyse des Muotataler Juuz bedarf, ist freilich die Beschreibungsgenauigkeit all jener Aufzeichnungen Leutholds in Frage gestellt, bei denen er mit der harmonisch-melodischen Deutung nicht zurande kam. Und das ist außer Notenbeispiel 13 und 14 auch die Aufzeichnung des aus seiner Nidwaldener Heimat stammenden Jodels Notenbeispiel 11: Was spricht dagegen, in beiden Teilen des Ämätter
den viertletzten Ton als auf Taktbeginn stehende Viertel bzw. punktierte Achtel aufzufassen, der ein
170
weiblicher Schluß folgt wie im Vordersatz in Abb. 41 und 40? Die seltsame Vorausnahme e wäre dann eliminiert, ebenso die musikalisch unbegründet erscheinende Dehnung des viertletzten Tones c im ersten Teil. Die Betonungs‐ und wohl auch die Längenverhältnisse müßten dann freilich erheblich anders gedeutet werden. Im Unterschied zu der begründeten Hypothese, die ich über die Aufzeichnung der Interpretation Toni Büelers aufgestellt habe, möchte ich diese Anmerkung zu Notenbeispiel 11 jedoch lediglich als vage Vermutung verstanden wissen, als Beispiel für die Konsequenzen meines Zweifels an Leutholds Aufzeichnungen und als Nachtrag zur Frage der Mehrdeutigkeit einstimmiger Jodel-Tonfolgen.
Nun ist noch der dritte Teil von Büelers Jodelinterpretation (Abb. 41) zu besprechen. Das ausführliche Ritardando, das die letzte Achtel fast doppelt so lang dauern läßt, macht eine zweite Notation (1b) des Nachsatzes erforderlich, da die erste (1a), die das bloße Konzept der Längenverhältnisse wiedergibt, am Schluß schlecht paßt. So breite Schlußritardandi kennt der traditionelle Muotataler Interpretationsstil nicht. (Vgl. Abb. 24 sowie alle Jüüz' auf der von H. Zemp 1990 herausgegebenen CD). Ich habe Büeler leider nicht gefragt, ob er den Juuz immer schon dreiteilig ausführte. Leuthold zeichnet ihn 1981 mit zwei Teilen auf. Sichardts Informanten interpretierten ihn ein‐ oder zweiteilig, Erasmus Betschart und die Gebrüder Schmidig zweiteilig, lediglich bei Emmi Suter﹘Gwerder weist er einen 3. Teil auf (Zemp 1990: 2c, 10a und 3a).
Möglicherweise handelt es sich um einen jener verdrehten
Jüüz', von denen Zemp 1990 berichtet. Ich habe im Theoriekapitel auf die vielleicht mögliche Mehrdeutigkeit dieser Melodie hingewiesen. Es gibt nun ein Indiz dafür, daß Emmi Suter﹘Gwerder sie tatsächlich im 3/4-Takt auffaßte: die zwei Achteln, die im Nachsatz dazukommen und den Viertakter voll machen. Merkwürdig ist, daß diese zwei Achtel in Büelers Ausführung nicht aufscheinen und statt dessen Anzeichen für eine 2/4-Takt-Auffassung im Rhythmischen und im Melodischen auftauchen: die rhythmische Motivwiederholung, der 10. Ton c sowie der
12. Ton g. Diese beiden Töne sprechen dafür, daß hier die pure Tonika herrscht und nicht wie bei Emmi Suter﹘Gwerder die Dominante mit Sextvorhalt D6﹣5. (Vergleiche Abb. 41 mit Abb. 24). Leider habe ich diese metrische Hypothese erst aufgestellt, nachdem ich Anton Büeler besucht hatte, ich konnte sie daher nicht überprüfen. Diese Hypothese fügt sich mit anderen zu einem ganzen Hypothesenkomplex zusammen: daß dieser Teil ursprünglich eine achttaktige I﹣V﹣V﹣I﹣I﹣V﹣V﹣I-Form im 3/4-Takt war, daß Büeler ihn nur einstimmig kennengelernt hatte und jene 2/4-Deutung vornahm, die ich im Theoriekapitel besprochen habe, daß die Eigenheit der Muotataler Juuzer, aus Atemgründen Inzipittöne wegzulassen, diese Umdeutung begünstigt hätte.
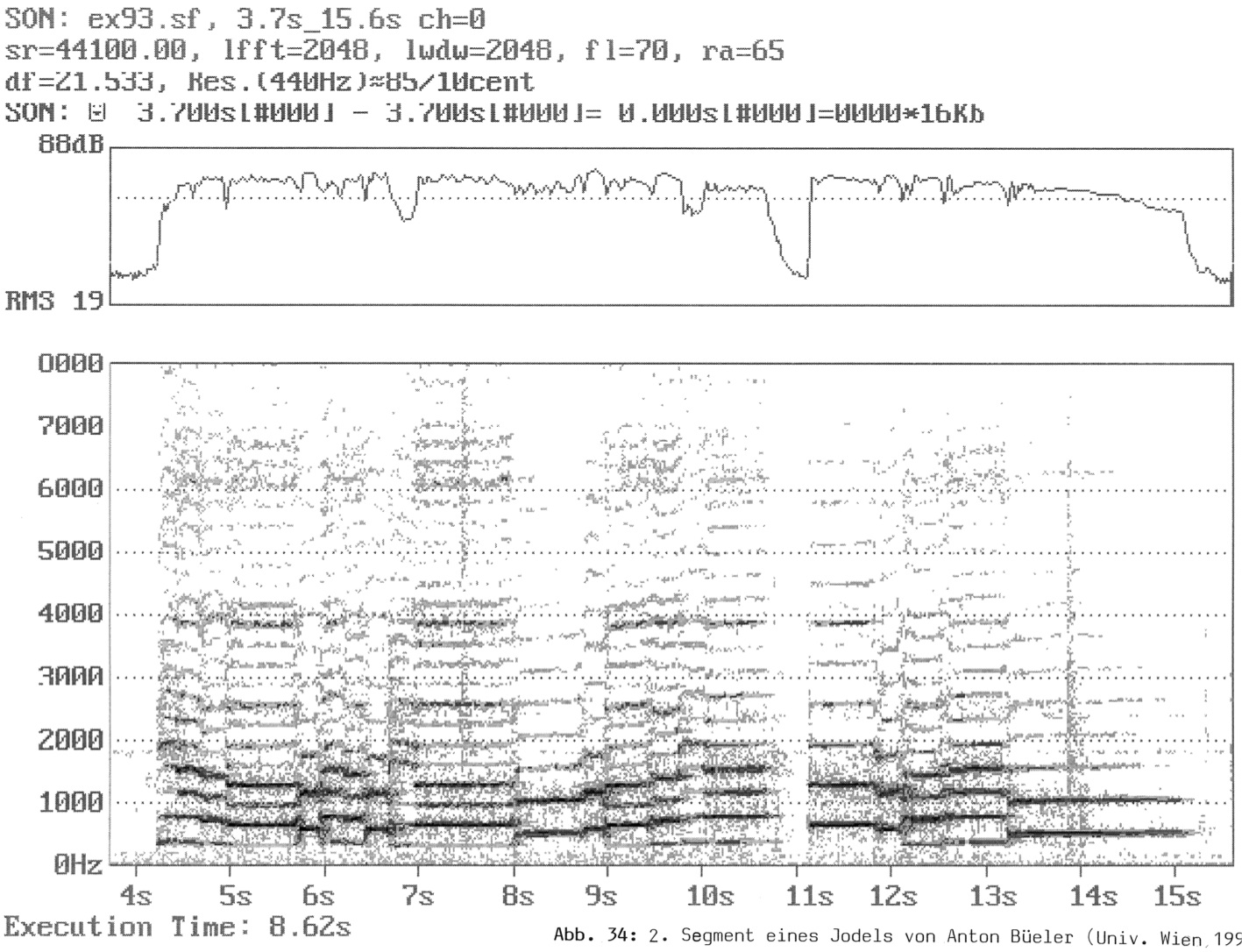

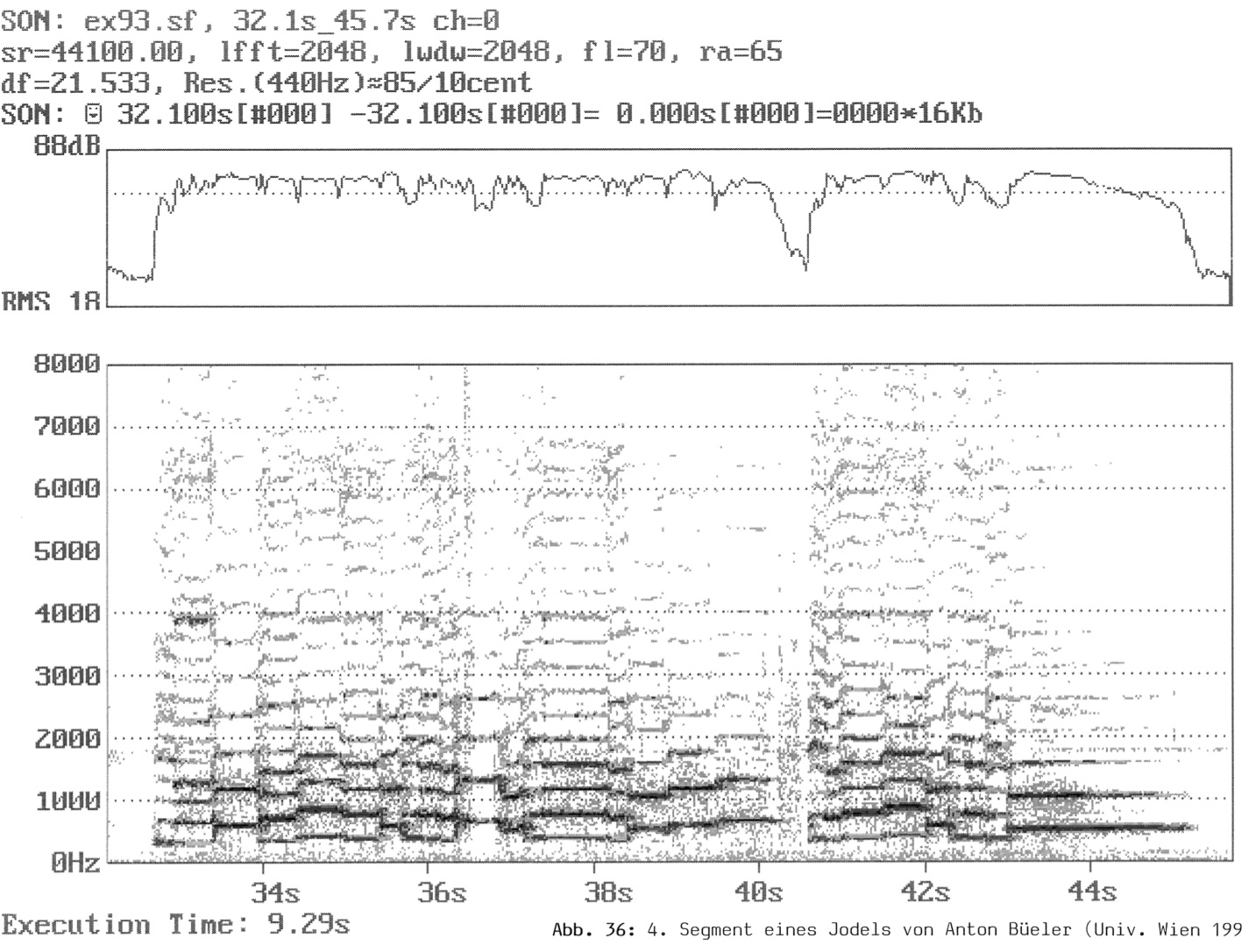
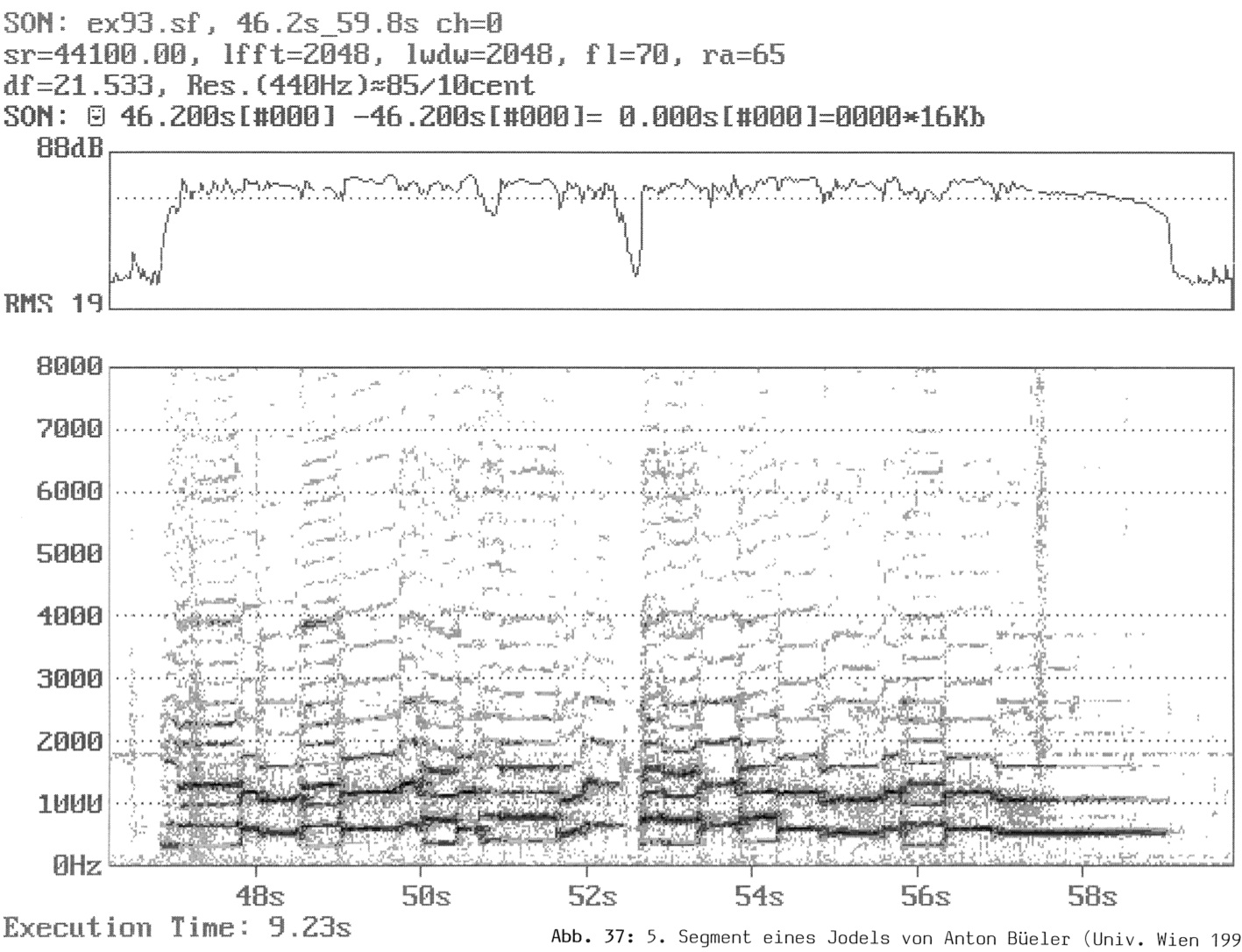
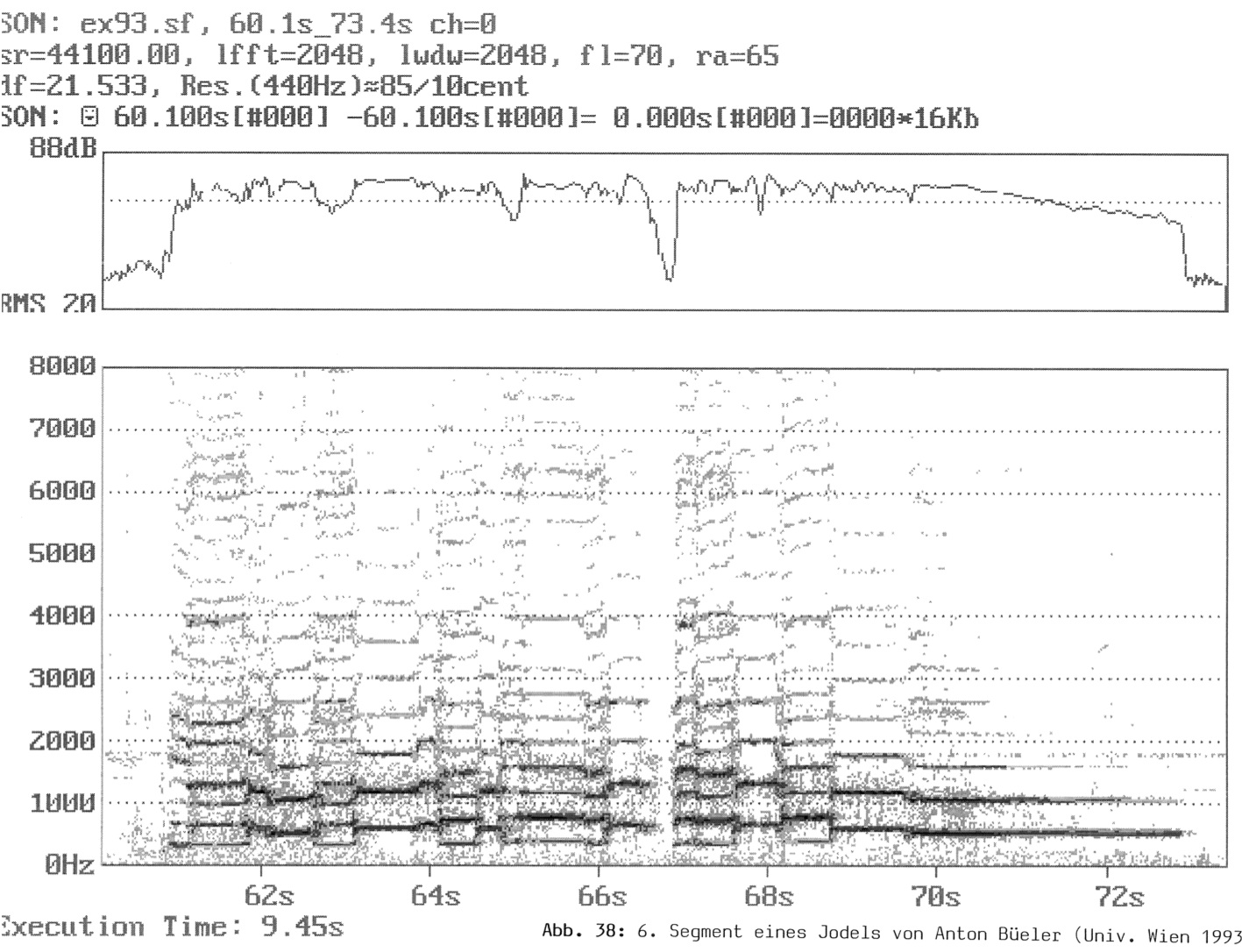

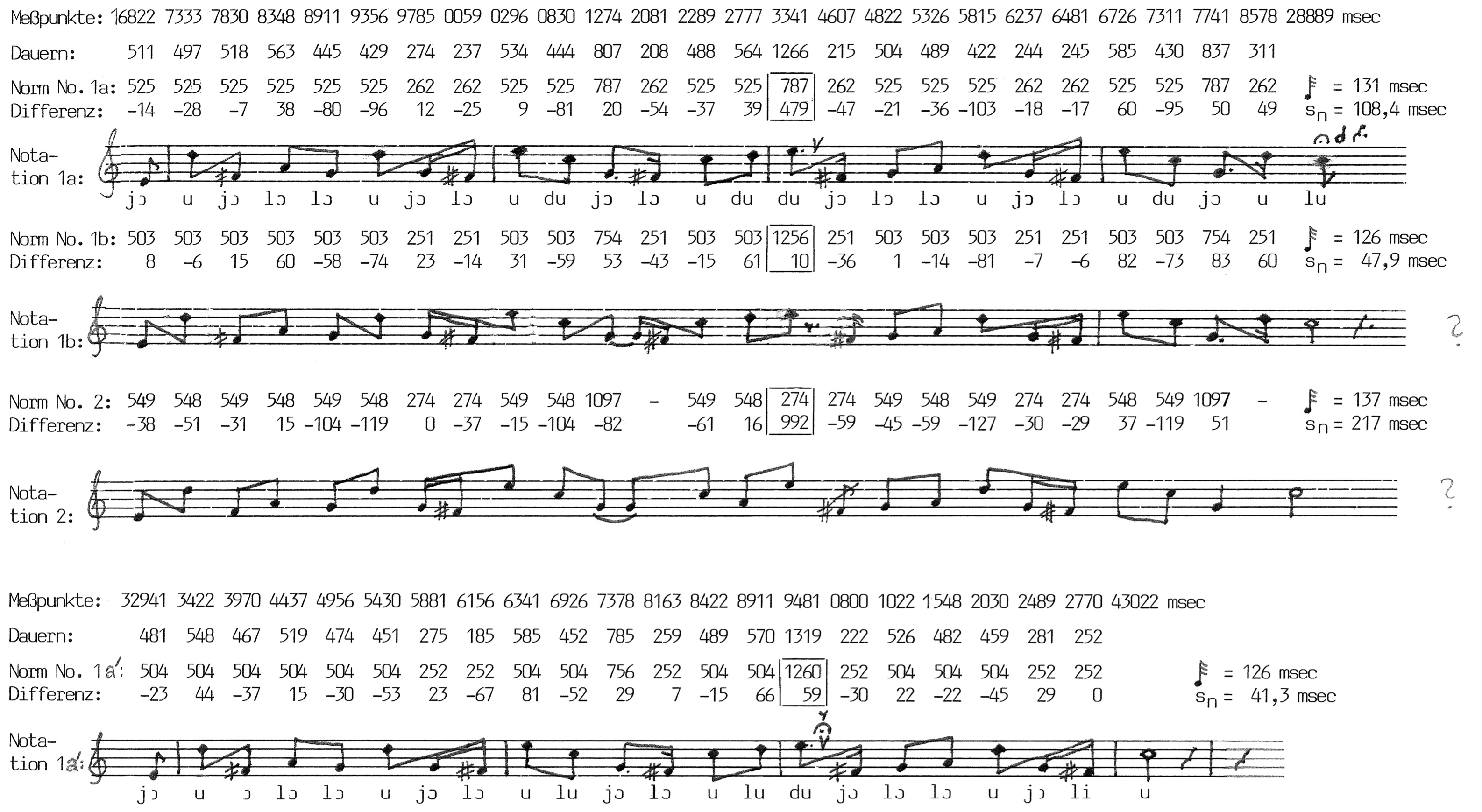
Vordersatz: Notation 1a: meiner metrischen Deutung. Notation 1g: Gegenhypothese; Notation 2: H. Leutholds Aufzeichnung einer früheren Interpretation Büelers (Leuthold 1981: 57). Nachsatz: meine metrischen Deutung mit Annahme einer Dehnung durch die Atempause (Notation 1)

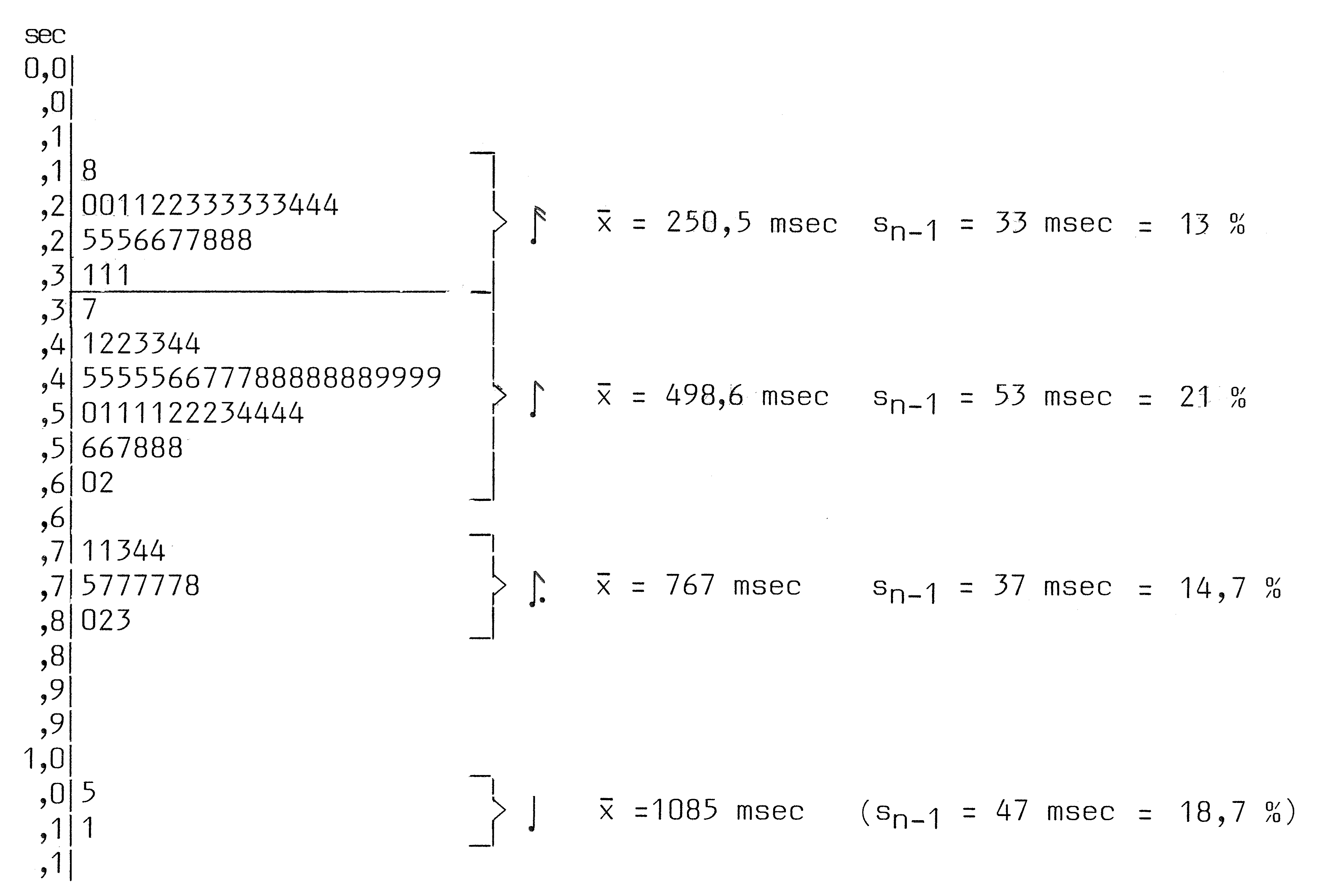
Da die Meßmethode dieselbe ist wie bei der Interpretation von Emmi Suter﹘Gwerder, sind die Daten miteinander vergleichbar. Büelers Tempo ist etwas langsamer. Der langsamste Teil ist bei beiden Interpreten der erste Teil.
Der Tempounterschied ist jedoch auch bei Büeler gering genug, daß es sinnvoll ist, die Dauern aller drei Teile in einem Diagramm zusammenfassend darzustellen (Abb. 42). Die Verteilungen der Dauern der Achteln und der punktierten Achteln gehen nicht wie bei Suter﹘Gwerder ineinander über, sondern sind deutlich getrennt. Genau umgekehrt wie bei Suter﹘Gwerder streuen bei Büeler die Sechzehnteldauern weniger als die Achteldauern, zudem liegt ihr Durchschnitt ganz nahe bei der durchschnittlichen Normsechzehntel. Die Vermutung, daß das Verhältnis zwischen der punktierten Achtel und der darauffolgenden Sechzehntel als exaktes 3:1 konzipiert ist, könnte dadurch bestärkt werden, daß diese
15 Sechzehntel eine mittlere Dauer von 254,3 msec haben (sn−1 = 38 msec) und das ist sehr genau ein Drittel der mittleren Dauer der punktierten Achtel.
In Wirklichkeit aber streuen die einzelnen Verhältnisse kaum weniger weit als bei Suter﹘Gwerder, nämlich zwischen 4:1 und 2,2:1, sodaß lediglich die Aussage zulässig ist, daß Büeler im Schnitt etwas schärfer punktiert als Suter﹘Gwerder (Abb. 43). Da das vielleicht lediglich durch das langsamere
180
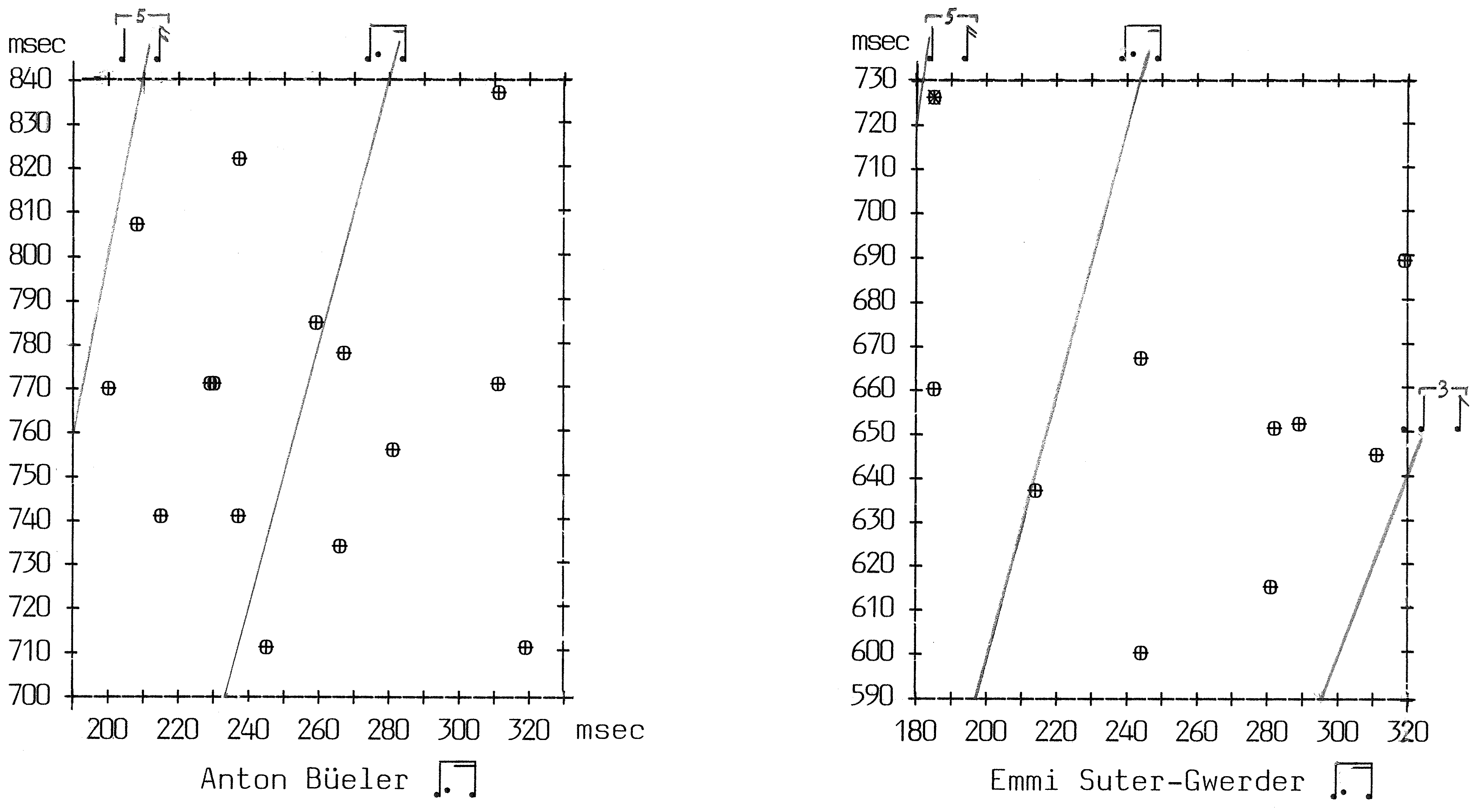
Tempo von Büelers Interpretation bedingt sein könnte, können daraus keine personalstilistischen Schlüsse gezogen werden und daher auch nicht daraus, daß die Mittelwerte der Verteilung Abb. 42 insgesamt eine größere Harmonizität aufweisen als die von Abb. 25. Lediglich die Viertel dauert zu lang. Das ist z.T. dadurch bedingt, daß die beiden Vierteln im langsameren ersten Teil stehen, z.T. dadurch, daß die erste Viertel etwas gedehnt ist, – was übrigens auch in der Interpretation von Emmi Suter﹘Gwerder der Fall ist. (Vgl. Abb. 22 mit Abb. 39).
Nun soll mithilfe des Ausführungsprofils ein Verdachtsmoment für die metrische Organisation der Achteln gewonnen werden. Zu dieser Untersuchung eignet sich lediglich der zweite Teil des Jodels, da allein er eine genügend lange Kette aufeinanderfolgender Achteln aufweist (Abb. 44). Die ersten neun Achteln im Nachsatz zeigen einen nur an einer Stelle unterbrochenen binären Wechsel der Dauern. Das Ausführungsprofil ist hier dem von Emmi Suter﹘Gwerder ähnlich (Abb. 28). In Vordersatz ist eine Vierachtel-Periodizität zu erkennen. Ternäre Wechsel treten nicht auf. Das stützt die Hypothese einer binären Organisation der Achteln, die sowohl von Leuthold als auch von mir aufgestellt ist – freilich in entgegengesetzter Form, was die Betonungsverhältnisse betrifft. Damit liegt nun ein Grund mehr vor, Sichardts Auffassung einer ternären Organisation in Zweifel zu ziehen.
181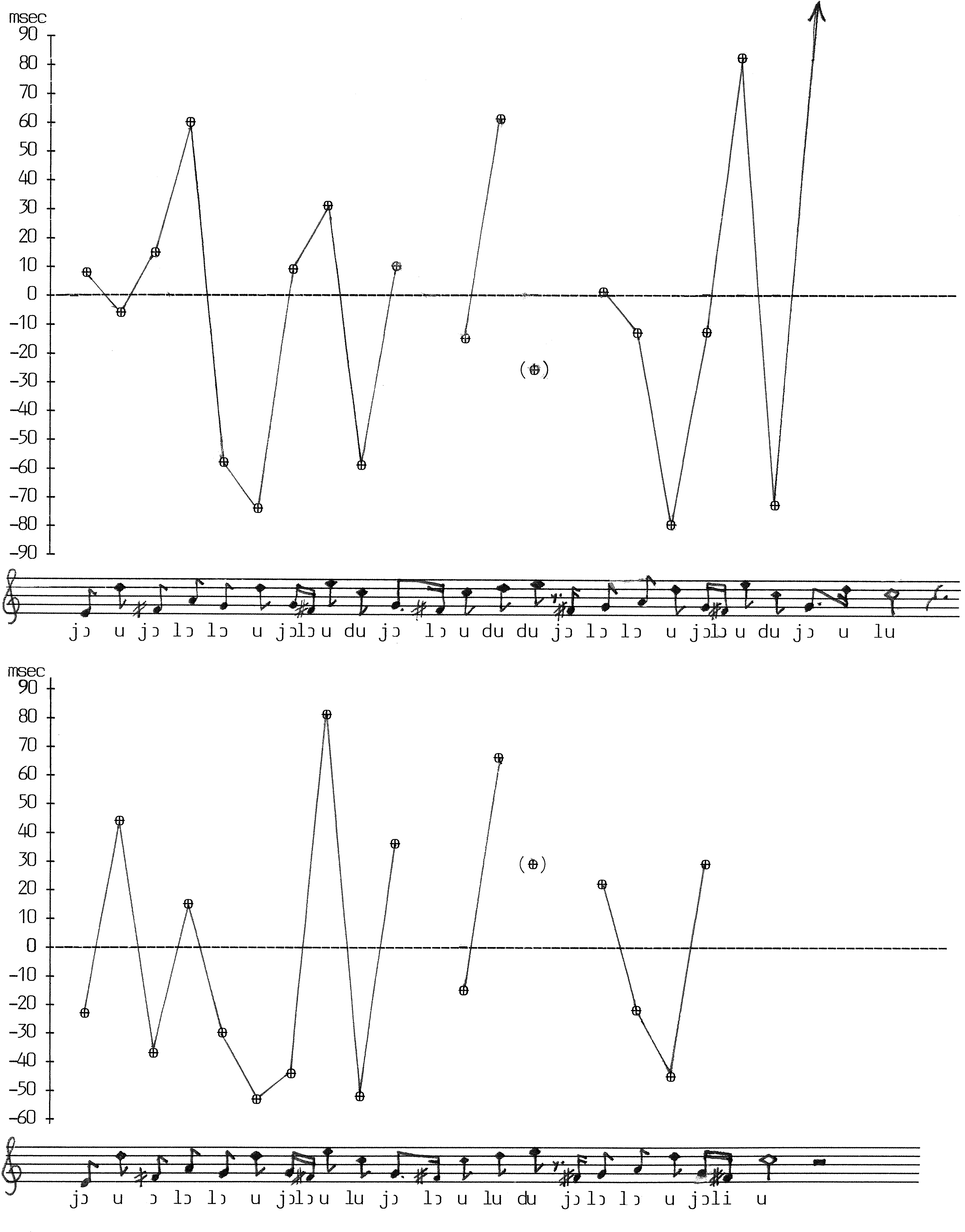
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Interpretation Büelers und der Suter﹘Gwerders liegt in der Placierung der größten Dehnung inmitten eines Segmente. Bei Büeler erfolgt sie an einer späteren Stelle als bei der Sängerin, und zwar dort, wo er dazwischen atmet. Dieser Unterschied ist deutlich im zweiten, dritten, vierten und sechsten Segment zu bemerken. (Vgl. Abb. 22﹣24 mit Abb. 39﹣41, siehe ferner Abb. 30﹣32; das fünfte Segment weist bei beiden Interpreten einen atypischen Verlauf auf). Büelers Atempausen sind so angeordnet, daß sie die Vordersätze ziemlich genau in zwei gleich lange Hälften teilen, während die gedehnten Werte bei Suter﹘Gwerder ein bis drei Viertel früher sind. Die Annahme, daß diese Gliederung bei Suter﹘Gwerder musikalisch (Phrasierung), bei Büeler primär atemtechnisch bedingt ist, liegt nahe. Die Gegenhypothese lautet, daß Büeler das Jüüzli musikalisch anders auffaßt und daß er die Atempausen sehr wohl dort einlegt, wo er das Ende einer musikalischen Phrase empfindet. Was den dritten Teil (5.u. 6. Segment) betrifft, so halte ich die Gegenhypothese für zutreffend: Daß Büeler genau dort atmet, wo er atmet, werte ich als ein weiteres Indiz dafür, daß er den 3. Teil im geraden Takt auffaßt. Die Überprüfung dieser Hypothesen muß einer Tonsatz-Analyse und letztlich der Befragung des Interpreten selbst vorbehalten bleiben.
Nun bleibt nur noch die Regelmäßigkeit zu zeigen. Es wird wie in Abb. 33 untersucht, wie genau die Abfolge der Vierteln mit dem Metronom Schritt hält:
Kumulative Abweichung in msec Maximalabweichung 2. Segment: 28 −11 −50 −37 −120 −121 −42 1 0 ±74,5 7 % 5. Segment: 0 49 −13 29 −64 −51 −69 −131 −119 −107 2 ±90 9,1 % 6. Segment: 0 −49 −24 −51 −107 −67 −13 −17 ±53,5 5,3 %
Beim 3. und 4. Segment (Abb. 40) wird Notationsart 1b gewählt und das Metronom auf die Achtel eingestellt:
Kumulative Abweichung in msec Maximalabweichung 3. Segment: 0 8 2 17 77 19 −55 −46 −15 −74 - −64 −79 −18 - - −44 −43 −57 −138 −151 −69 −142 - 1 ±114 11,3 % 4. Segment: 0 −23 21 −16 −1 −31 −84 −128 47 −99 - −63 −78 −12 - - 17 39 17 −28 1 ±83,5 8,3 %
Die Abweichung von einem im richtigen Zeitpunkt gestarteten Metronom beträgt in jedem Segment weniger als eine Zweiunddreißigstel. Eine Zweiunddreißigstel ist die Mindestgenauigkeit, die auch für die phonetische Transkription der einzelnen Tondauern gefordert worden war.
Die musikalische Analyse wird herausstellen, daß trotz der auf der akustischen Ebene gegebenen Regelmäßigkeit bei Büeler keine Nonrubato-Interpretation im strengen Sinne des Wortes vorliegt. Die Atempausen im zweiten Teil und das Schlußritardando am Ende des dritten Teils stören den Gleichlauf des Metrums. In der Ausführung Emmi Suter﹘Gwerders ist die Regelmäßigkeit hingegen eine durchwegs metrisch verstandene. Das wird in dem noch unveröffentlichten zweiten Teil gezeigt werden mithilfe von stilistischen Untersuchungen (Muotataler Jodeltonsatz
und harmonisch-metrische Schemata).
Aus dem zweiten Teil seien vorgreifend meine Hypothesen über das wahre Metrum der zwei von Sichardt transkribierten Fassungen des meisttranskribierten Muotataler Juuz dargelegt (Notenbeispiel 43 und 44). Die Plausibilität dieser Hypothesen beruht, kurz gesagt, auf dem aus der Tanzmusik bekannten Harmonie‐ und Taktschema, auf dem in dreistimmigen Muotataler Jodelinterpretationen typischen Dissonanzbehandlungen (Vorhalte etc.) und auf dem Vergleich mit der dreistimmigen Fassung Notenbeispiel 43c.
Die Hypothese, daß Büeler den dritten Teil dieses Juuz geradtaktig auffaßt (Abb.41), wird übrigens erhärtet durch eine Schallplattenaufnahme mit dem Pragelchörli Muotatal (Ländlertrio Echo vom Rossbärg. Gast: Pragelchörli Muotathal. Oergelihuus P+C 1984), und zwar durch die mehrstimmige Begleitung. Daß Emmi Suter﹘Gwerder diesen Teil als Achttakter im 3/4-Takt aufgefaßt hat (mit dem Harmonieschema T﹣D﹣D﹣T), ist jedoch sehr wahrscheinlich nicht nur wegen der im Theoriekapitel angegebenen Gründe, sondern auch wegen der in Abb. 32 im Nachsatz sichtbar werdenden Phrasierung. Weiters sprechen dafür auch stilistische Gründe, die im zweiten, noch unveröffentlichten Teil dargelegt werden, vor allem die für den Muotataler Juuz typischen D6﹣5-Vorhalte.
Zu diesem dritten Teil lassen sich zwei Entstehungshypothesen aufstellen. Die erste besagt, daß dieser Teil ursprünglich als Achttakter im 3/4-Takt verstanden wurde und dann in jüngerer Zeit harmonisch-metrisch in den geraden Takt umgedeutet wurde. Diese Umdeutung sei durch die vorher schon aus atemtechnischen Gründen geschehene Verkürzung des Inzipits (um zwei Achteln) erleichtert worden. Ermöglicht wurde sie letztlich durch eine baßlose, wahrscheinlich einstimmige und insofern unvollständige Überlieferung dieser Melodie. Die Gegenhypothese besagt, daß diese Melodie immer schon geradtaktig war (und auch Emmi Suter﹘Gwerder sie geradtaktig verstand).
184Beide Hypothesen haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Umdeutungs-Hypothese vermochte keine mehrstimmige Interpretation aufzufinden, die den angenommenen ursprünglichen 3/4-Takt bestätigt hätte. Die Kontinuitäts-Hypothese wiederum kann nicht erklären, wie dieser ungewöhnliche Elftakter (5 + 6 Takte) entstanden sein könnte, es sei denn durch puren Zufall. Die Umdeutungs-Hypothese hingegen kann auf die große Häufigkeit und lange Tradition des Achttaktigen Formschemas verweisen. Sie kann darüberhinaus eine stilistisch passende Baßfortschreitung (I﹣V﹣V﹣I) unterstellen. Um ihre Plausibilität zu erhöhen, müßte man solche Jüüzli Finden, die tatsächlich metrisch-harmonisch auf verschiedene Arten begleitet werden und zudem müßte sie nachweisen können, daß die schemakonforme Fassung die ältere ist. Diese Suche bleibt dem zweiten Teil überlassen.
185
|
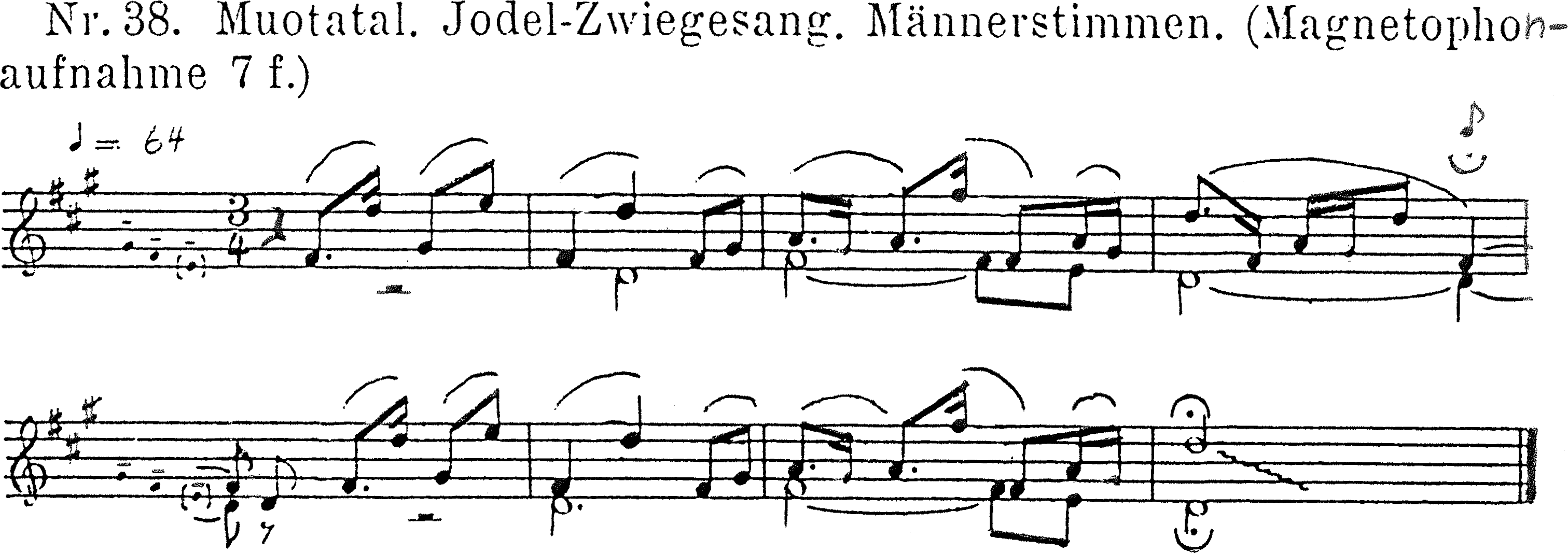
|

Dr jung Sagelientschli(Zemp 1990: 10a, Transkription Hermann Fritz): Vorjutzer: Alois Schmidig, 2. Stimme Paul Schmidig, Baß: Joseph﹘Maria Schelbert. | |
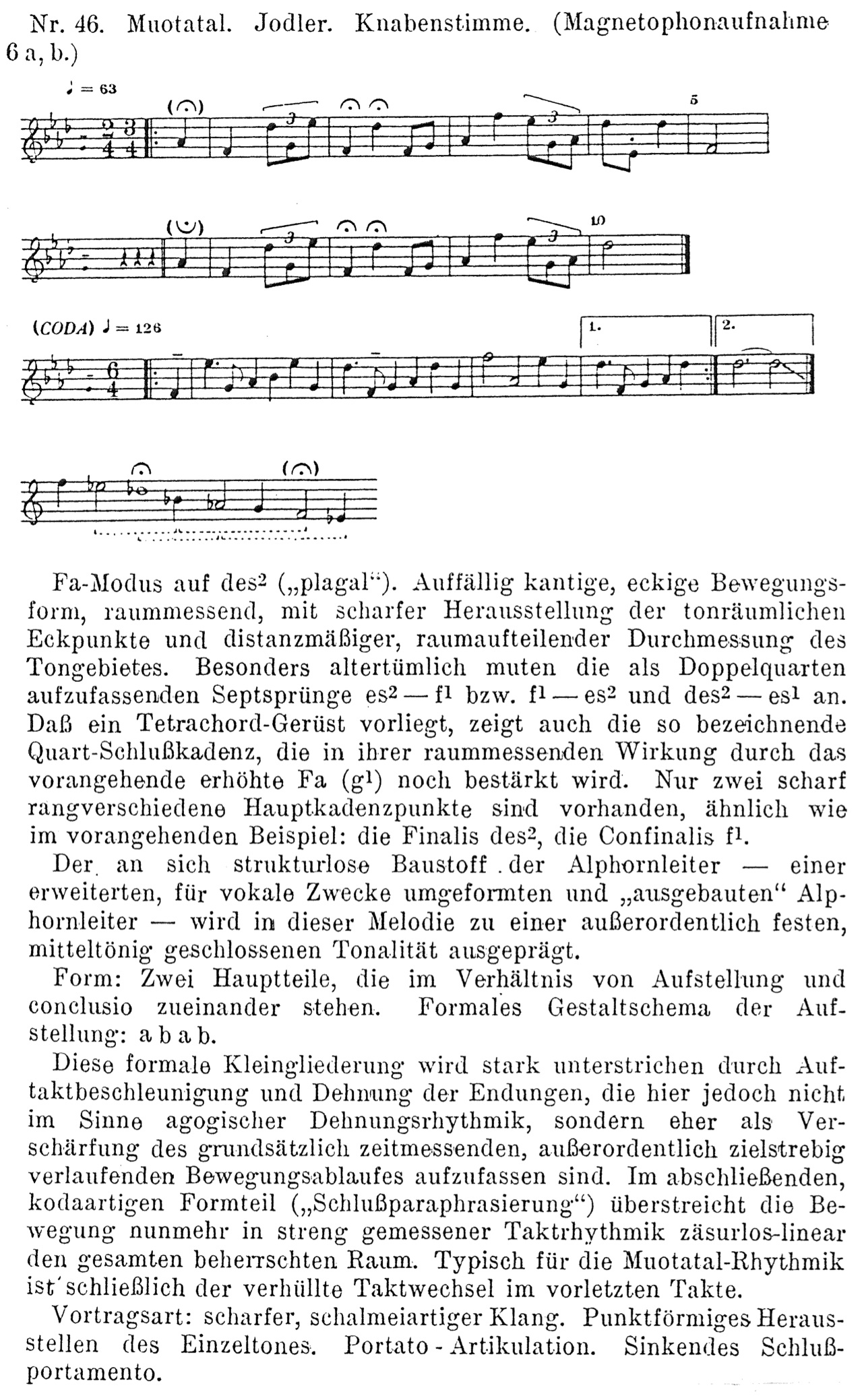
plagal). Auffällig kantige, eckige Bewegungs form, raummessend, mit scharfer Herausstellung der tonräumlichen Eckpunkte und distanzmäßiger, raumaufteilender Durchmessung des Tongebietes. Besonders altertümlich muten die als Doppelquarten aufzufassenden Septsprünge es2﹣f1 bzw. f1﹣es2 und des2﹣es2 an. Daß ein Tetrachord-Gerüst vorliegt, zeigt auch die so bezeichnende Quart-Schlußkadenz, die in ihrer raummessenden Wirkung durch das vorangehende erhöhte Fa. (g1) noch bestärkt wird. Nur zwei scharf rangverschiedene Hauptkadenzpunkte sind vorhanden, ähnlich wie im vorangelienden Beispiel: die Finalis des2, die Confinalis f1. Der an sich strukturlose Baustoff der Alphornleiter – einer
erweiterten, für vokale Zwecke umgeformten und Form: Zwei Hauptteile, die im Verhältnis von Aufstellung und conclusio zueinander stehen. Formales Gestaltschema der Aufstellung: a b a b. Diese formale Kleingliederung wird stark unterstrichen durch Auftaktbeschleunigung und Dehnung der Endungen, die hier jedoch nicht
im Sinne agogischer Dehnungsrhythmik, sondern eher als Verschärfung; des grundsätzlich zeitmessenden, außerordentlich zielstrebig
verlaufenden Bewegungsablaufes Aufzufassen sind. Im abschließenden,
kodaartigen Formteil ( Vortragsart: scharfer, schalmeiartiger Klang. Punktförmiges Herausstellen des Einzeltones. Portato-Artikulation. Sinkendes Schlußportamento. |

|
Ein walzerhafter Jodel
Außer den Jodeln, die sich als Achttakter im 3/4-Takt verstehen lassen, gibt es im Muotataler Repertoire auch Sechzehntakter im 3/4-Takt. Man könnte sie genausogut als Achttakter im Sechsachteltakt schreiben, doch soll die 3/4-Schreibweise die Ähnlichkeit mit dem Walzer zum Ausdruck bringen, die in mehrerlei Hinsicht besteht. Abb. 47 setzt die Meßdaten eines Ausschnitts aus einem solchen Jodel in Beziehung mit der Transkription 1, die mein metrorhythmisches Verständnis wiedergibt. Es zeigen sich systematische Abweichungen: Die 3. Viertel der Takte dauern länger, die Halbe davor kürzer. Das Verhältnis der Summe der Halbedauern zur Summe der Vierteldauern beträgt im Vordersatz 6592 msec : 4053 msec = 1,63:1 und im Nachsatz 5421:3394 : 1,6:1 (statt 2:1, wie das Notenbild suggeriert) Daher die relativ gute Passung der Transkription 2 (5/8-Takt) hinsichtlich der Standardabweichung, nicht jedoch hinsichtlich der Maximalabweichung. Das 2. Viertel ist nur im ersten Takt des Vorder‐ und Nachsatzes mit einem Tonbeginn besetzt. In diesem ersten Takt zeigt sich nicht nur eine bessere Passung der 3/4-Transkription, sondern auch die mit dem Wiener Walzer gemeinsame Eigenschaft, daß das erste Viertel am kürzesten dauert (Alf Gabrielsson 1986: 142 f.). Das 3. Viertel dauert am längsten. Vergleiche dieselbe aufsteigende Sekundschrittfolge in Abb. 24 und 29: dort dauert der 3. Ton am kürzesten. Doch läßt die Betrachtung nur zweier Takte keine generalisierenden Aussagen zu. Anders steht es mit dem Verhältnis der Halben zum 3. Viertel. Die Konstellation kurze HalbephonetischenTranskription beschrieben sein, denn diese sollte nicht ungenauer sein als die
phonemische. Ich möchte auf das Problem der Klassierung der Dauern nicht weiter eingegeben und mich der wichtigeren Frage der Regelmäßigkeit zuwenden. Wegen des nichtrationalen Verhältnisses zwischen Halbe und Viertel ist es zweckmäßig, die Regelmäßigkeit der als Taktbeginn und der als 3. Viertel gedeuteten Meßpunkte getrennt zu zeigen. 188

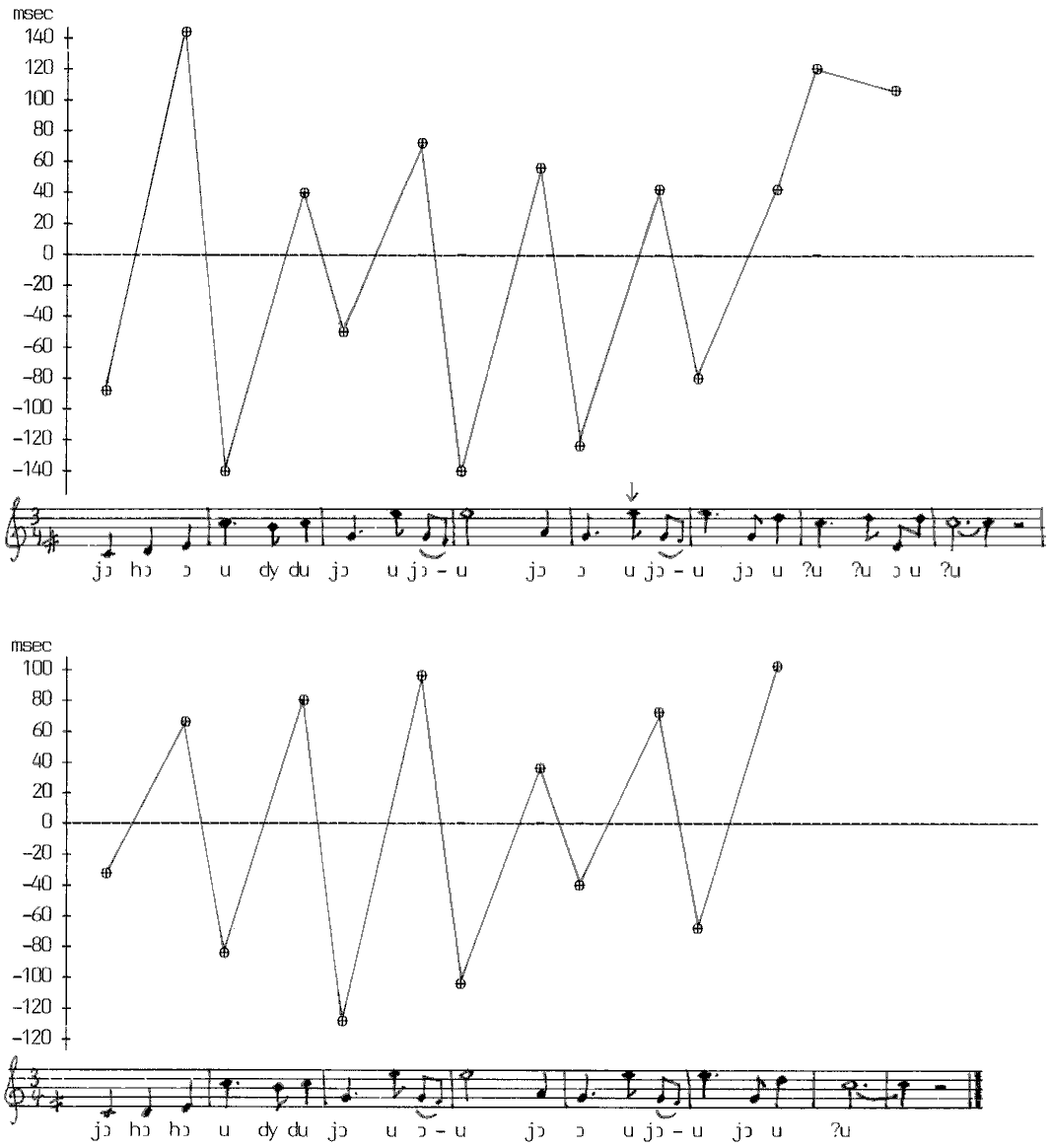
| 0,11 | 88 |
| ,2 | 12245 |
| ,2 | 555566889 |
| ,3 | 1 |
| ,3 | 59 |
| ,4 | 23 |
| ,4 | 8 |
| ,5 | 224 |
| ,5 | 56785 |
| ,6 | 3 |
| ,6 | 5678889 |
| ,7 | 1 |
| ,7 | |
| ,8 | |
| ,8 | 677 |
Daher ist es gleichgültig, ob als Berechnungsgrundlage die Abweichungen der
3/4‐ oder der 5/8-Takttranskription verwendet werden.
Abb. 50 zeigt, daß im Nachsatz die ausgewählten Meßpunkte regelmäßig sind, im Vordersatz jedoch nicht:
Kumulative Abweichung Maximalabweichung Vordersatz: 0 57 −41 −19 −103 −185 −223 6 (Taktbeginn) 140 msec = 28% der Normviertel −88 −82 −91 −159 −227 −265 −103 (3. Viertel) 91,5 msec 18% Nachsatz: 0 34 30 −2 −71 −38 −4 (Taktbeginn) 52,5 msec = 11% −32 −50 −98 −107 −111 −107 (3.Viertel) 39,5 msec = 8%
Die Unregelmaßigkeit liegt an der größeren Dauer des letzten Taktes des Vordersatzes. Bis zu diesem Takt ist die Meßpunktfolge regelmäßig, wie Abb. 51 zeigt:
| Meßpunkte: | 51659 | 3237 | 4659 | 62[D | 7637 | 9074 | 60556 | (Taktbeginn) | |
| Normpunkte | 51655 | 3142 | 4625 | 5107 | 7590 | 9073 | 60550 | Maximalabweichung | |
| Differenz: | 0 | 95 | 34 | 93 | 47 | 1 | 0 | 47,5 | msec = 10% der Normviertel |
| Meßpunkte: | 52505 | 4111 | 5622 | 7074 | 0520 | 60107 | (3. Viertel) | ||
| Normpunkte | 52505 | 4065 | 5554 | 7030 | 0522 | 60007 | |||
| Differenz: | D | 42 | 68 | 36 | 4 | 0 | 34 msec 7% |
Dieser Regelmäßigkeit entspricht eine Nonrubato-Auffassung desjenigen Hörers, der die Klangfolge mit dem in Transkription 1 oder 2 ausgedrückten metrorhythmischen Verständnis wahrnimmt. In Takt 7 des Vordersatzes wird diesem Hörer der erste Ton c gedehnt erscheinen, er wird hier ein Abweichen von der Regelmäßig
191
keit erkennen. Tatsächlich dauert das c in Takt 7 etwa genau so lang wie das e in Takt 4. Ein Hörer, der diese musikalische Deutung nicht besitzt, könnte die Regelmäßigkeit auch bis zum Ende des Vordersatzes durchgehend empfinden, und zwar auf folgende Weise:
Meßpunkte: 51659 2505 3237 4111 4659 5622 6200 7074 7637 0526 9074 0007 0556 1422 61911 msec Normpunkte: 51659 3124 4508 6053 7517 8902 0446 61911 Maximalabweichung: 73,5 = 15% Differenz: 0 113 71 147 120 92 110 0 Normpunkte: 2505 4050 5531 7003 0476 9949 1422 Differenz: 0 53 91 71 50 50 0 45,5 = 9%
Hat der Hörer zudem die in der Notenzeile von Abb. 52 wiedergegebene metrorhythmische Auffassung, dann empfindet er die wahrgenommene Regelmäßigkeit als dehnungsfreie Rhythmik. Ich muß gestehen, daß es mir nicht gelingt, das Stück so aufzufassen und daß ich die in Abb.52 aufgezeigte Regelmäßigkeit nur mithilfe des Metronoms oder des sturen Zählens empfinden kann. Ohne Hilfsmittel kann ich nur Zeiten miteinander vergleichen, die mir mein musikalisches Verstehen als vergleichbar nahelegt. Es hängt hier von der musikalischen Deutung ab, ob das Ende des des Vordersatzes als regelmäßig oder als unregelmäßig, als dehnungsfreie Rhythmik
oder als Dehnung empfunden wird. Dieser musikpsychologisch interessante Sachverhalt wirft ein Licht auf den Auffassungsunterschied zwischen Sichardt und Leuthold. Sichardt wurde durch seine musikalische Deutung die Wahrnehmung und Erkenntnis der Regelmäßigkeit gestattet, Leuthold jedoch nicht. Diese Hypothese wird durch den Variantenvergleich des Jodels Notenbeispiel 13 gestützt. Ich glaube, auch in Leutholds Transkriptionen Notenbeispiel 14 Anhaltspunkte entdeckt zu haben, die diese Hypothese zu erhärten vermögen. Die Entdeckung der musikalischen Deutungsabhängigkeit der Regelmäßigkeitswahrnehmung legt es außerdem nahe, die Kinderinterpretationen, bei denen Sichardt Dehnungen und Schrumpfungen notierte, kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Der Vollständigkeit halber seinen noch die Spektrogramme der beiden analysierten Segmente dieses Jodels dargestellt (Abb. 53 und 54).
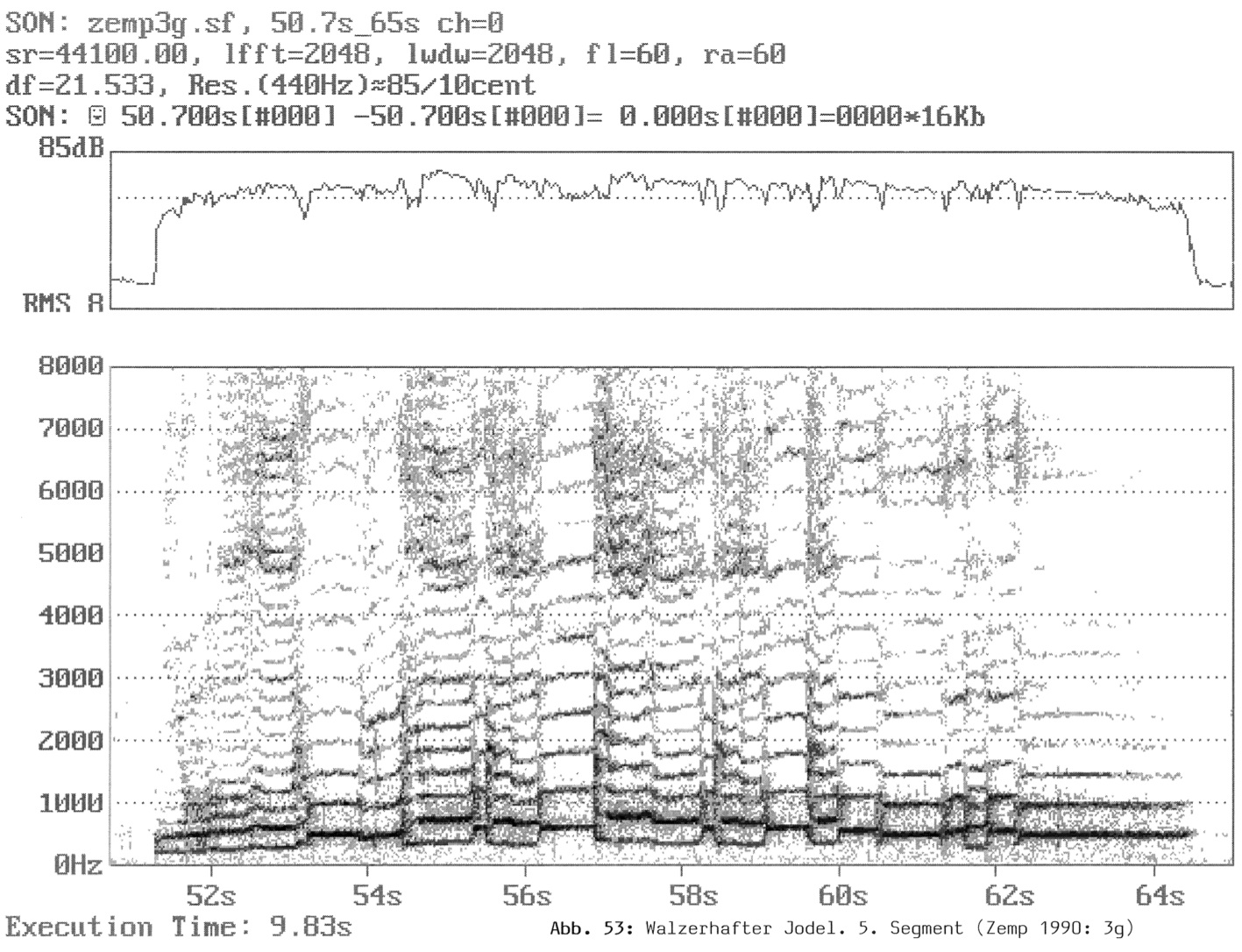
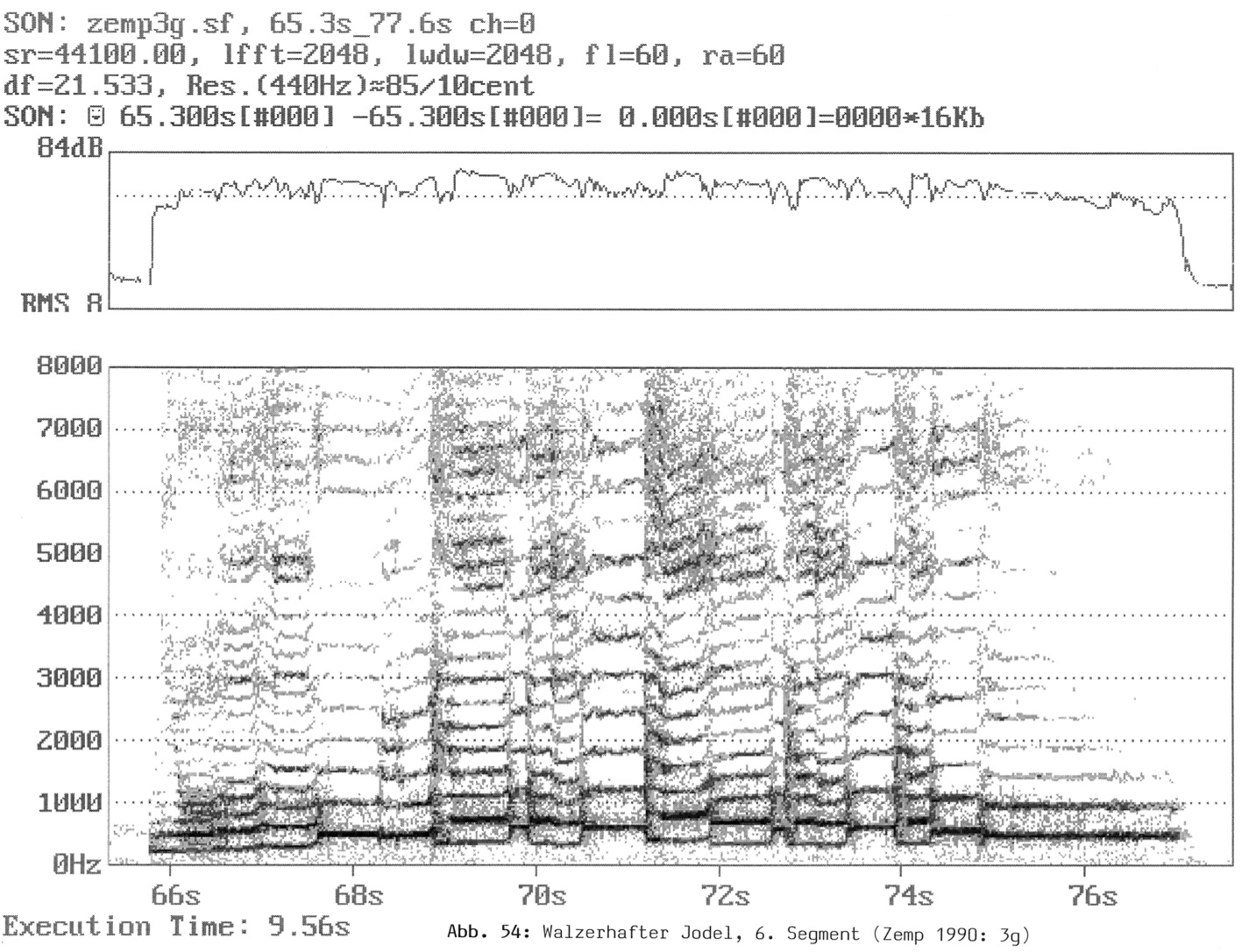
Schlußbemerkungen
In der statistischen Untersuchung publizierter Transkriptionen wurden Verdachtsmomente gewonnen, daß die Muotataler Jüüzli dieselben Taktschemata wie die Tanzmusik aufweisen (Walzer, Ländler, Mazurka, geradtaktige Tänze). Diese Verdachtsmomente beziehen sich gleichermaßen auf die regulärtaktig wie auch auf die taktwechselnd und taktlos transkribierten Jüüzli. Für die Richtigkeit dieser Hypothese lieferte die spektrographische Analyse dreier Jodelinterpretationen weitere Indizien auf der Ebene der Organisation des Pulses (binär bzw. ternär); auf der Ebene des Taktes (3/4‐ oder geradtaktig) wurde sie allerdings beim dritten Teil eines Juuz kontraindiziert durch Eigenheiten der Phrasierung und des Melodieverlaufs einer der beiden spektrographierten Varianten sowie durch den Harmonieverlauf einer mehrstimmigen Fassung. Es wurde sodann die – gewagt erscheinende – Vermutung aufgestellt, daß dieser Jodelteil ursprünglich die tanzmusikhafte Form gehabt hatte, jedoch im Überlieferungsprozeß harmonisch und metrisch umgedeutet worden war.All diese Hypothesen und Vermutungen zu erhärten, bleibt dem noch unveröffentlichten zweiten Teil dieser Arbeit vorbehalten. Gelingt es, das Abweichende historisch auf Schemakonformes zurückzuführen, dann wird der Blick frei für eine neue Entstehungstheorie des Muotataler Jodelrepertoires (und des alpenländischen Jodelrepertoires überhaupt): Es sind die harmonisch-metrischen Schemata der Tanzmusik, an die sich der Jodel formal anlehnt. Ihrer tanzmusikalischen Form enthoben, haben die Taktschemata zwar noch das Orientierende einer Hörgewohnheit, aber nicht mehr das Bindende eines Konzepts. Der Variantenbildungsprozeß vermag daher auch das Metrum zu erfassen, ursprünglich nach dem Vorbild der Tanzmusik geschaffene Jodelmelodien wandeln ihre metrische Form: abhanden kommende Töne, hinzugefügte Töne, verlängerte oder verkürzte Töne, metrische Umdeutung, harmonische Umdeutung mit metrischer Auswirkung. Als Ursachen kommen in Frage: atemtechnisch bedingte Verkürzung, Weglassen von Redundantem (Ton‐ und Motivwiederholung), Überflüssigwerden von Unwichtigerem, Einfügung von Atempausen, Umdeutung von Dissonanzen zu Konsonanzen, Anpassung einer alten Melodie an einen neuen Musikstil, in anderen Jodellandschaften auch die Umdeutung von gedehnten in gezählte Zeiten. Das im Vergleich zur Tanzmusik langsamere Jodeltempo ermöglicht es zudem, das Gefühl für die Regelmäßigkeit der Schwerstzeiten-Abfolge zu verlieren und erleichtert so die metrische Variantenbildung.
Diese Theorie, zu der das nötige Belegmaterial noch nachzureichen wäre, müßte auf die alpenländische Jodelforschung noch tiefergreifende Auswirkungen haben 195 als der in den Vorbemerkungen geforderte ethnomethodische Zugang und die im Theoriekapitel angeregte Überprüfung auf potentielle metrische Mehrdeutigkeit. Die Jodelforschung dürfte sich dann nicht darauf beschränken, ein Verständnis der rezenten Konzepte und der historischen Formen zu erlangen, sie müßte auch die hinter den Veränderungen und Umdeutungen stehenden Kräfte aufspüren.
196Anhang
1. Bericht über ein Älplerfest in Schwyz, das laut den Angaben von Peter Betschart im September 1855 stattfand. Quelle ist eine Fotokopie in der Sammlung Betschart
*)
*) In dieser Fotokopie, von der ich mir eine Fotokopie machte, sind die Wörter Wettkämpfe
, Alphornblasen und Jodeln
sowie Alphornblasen.
und Jodeln.
mit breiten Filzstift farbig überstrichen und daher auf meiner Fotokopie schlecht leserlich.
Schweiz﹘Erzähler. Das müßte noch verifiziert werden.[Wahrscheinlich:
Schweizerischer Erzähler I. Erschien vom 14. Dezember 1854 bis 12. Juli 1856 als Wochenblatt in Schwyz. Druck: Ambros Eberle. Redaktion: Josef Balthasar Ulrich, https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=282133 Ausgabe vom 29. Oktober 1855]
2. Liste der Jodlerfeste, an denen Anton Büeler teilnahm, nebst den Bewertungen von Büelers Jodelvortrag durch die Kampfrichter. Quelle sind Fotokopien aus den Festberichten der Jodlerfeste, die mir Anton Büeler und Peter Betschart dankenswerterweise zur Verfügung stellten.
197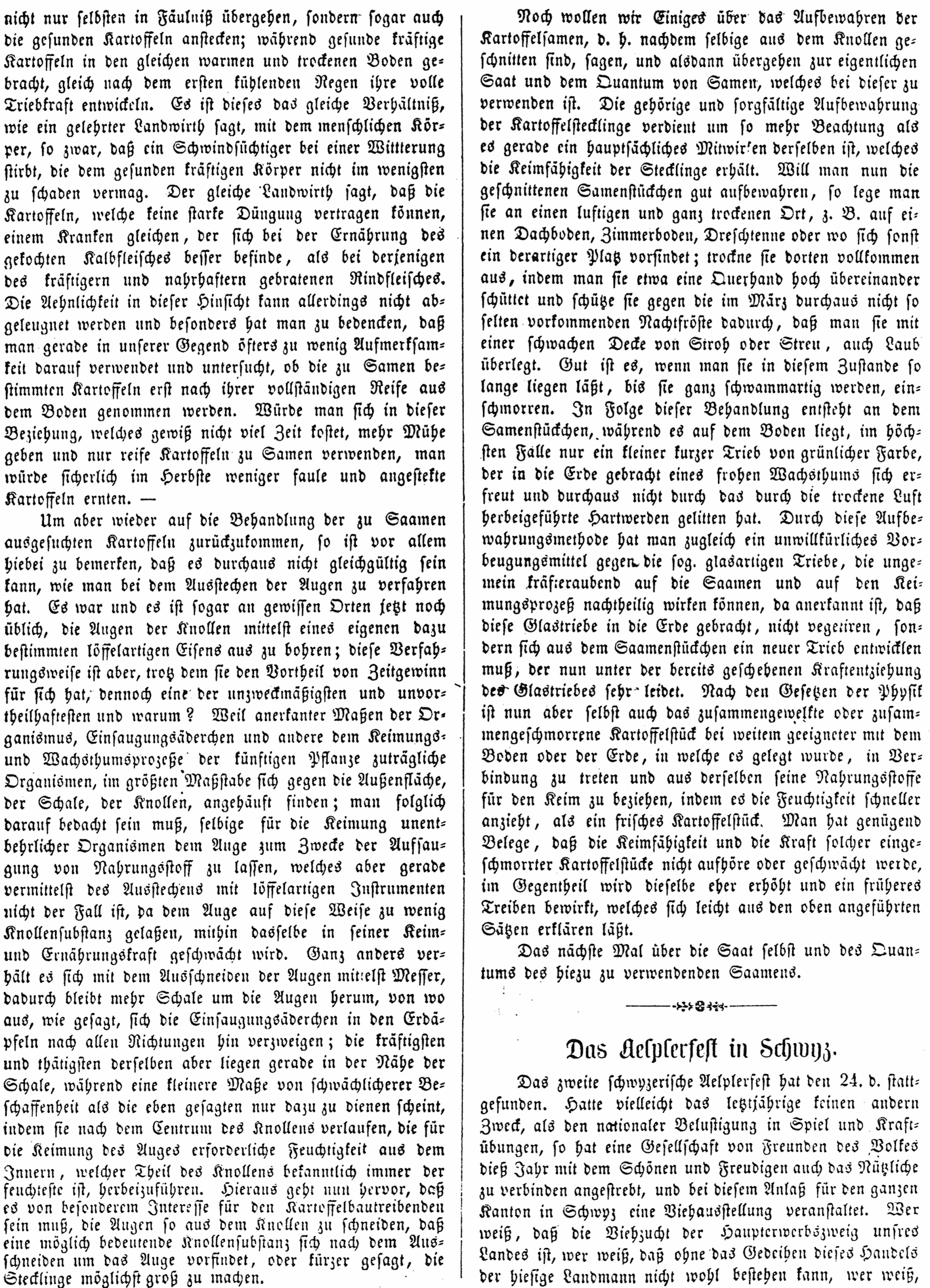
317 [...] Das Aelplerfest in Schwyz. Das zweite schwyzerische Aelplersest hat den 24. d. stattgefunden. Hatte vielleicht das letztjährige keinen andern Zweck, als den nationaler Belustigung in Spiel und Kraftübungen, so hat eine Gesellschaft von Freunden des Volkes dieß Jahr mit dem Schönen und Freudigkeit auch das Nützliche zu verbinden angestrebt, und bei diesem Anlaß für den ganzen Kanton in Schwyz eine Viehausstellung veranstaltet. Wer weiß, daß die Viehzucht der Haupterwerbszweig unsres Landes ist, wer weiß, daß ohne das Gedeihen dieses Handels der hiesige Landmann nicht wohl bestehen kann, wer weiß,

318 daß der Welschlandhandel schon so viele schöne Sennten gleichsam spurlos verzehrt, und manchen wohlhabenden Bauer ruinirt hat, so darf man das Streben, die Viehzucht zuheben und den Viehandel allwärts zu erweitern, nur gut und höchst verdankenswerth nennen. Durch die Aussetzung von Preisen für Kühe, Stiere und Rinder werden die betreffenden Viehbesitzer wohl ermuntert, die Viehraxe soviel möglich immer zu veredeln; durch die Einführung eines alljährlich wiederkehrenden größern Viehmarktes aber dürfte dann eben der Absatz des Viehes ermöglichen und der Handel befördert werden, ohne daß die gefahrvollenBergfahrtenin’s Welschland nöthig würden. Daß die h. Regierung, die Oberallmeindkorporation und der Bezirksrath Schwyz sich je mit 100 Fr. an diesem wohlthätigen Untemehmen betheiliget haben, wird Niemand tadeln. Verhehlen wir es also nicht, daß der dem Aelplerfest vorangestellte Zweck ein folgenreicher sein dürfte. Der Anfang ist gemacht und wie wir allseitig vernommen, hat derselbe großen Erwartungen entsprochen. Die Hofmatt war mit sehr schönem Vieh im weiten Kreise umstellt. – Jn der That, dieser Anblick, so viehisch er war, hat uns mehr erfreut, als Kränze, prunkende Kostüme und allerhand Zieraden und doch dienten auch diese zur Verschönerung des Festes und zum Empfang der lieben Besucher aus vielen Gauen der Schweiz. Gegen zwölf Uhr erfolgte die Preise-Vertheilung, woran die bekranzten Kühe, Stiere und Rinder im langen Zuge über den Dorfplatz hingeführt wurden. Nach zwöf Uhr begannen die Wettkämpfe im Laufen Springen, Klettern, Sackgumpen, Steinstossen, Alphornblasen und Jodeln, Schwingen unf Häggeln. Da bereits Jedermann weiß, wie das Ding zugeht so können wir uns kurz fassen und zwar um so kürzer, weil das Schwingen, der wichtigste und sehenswertheste Wettkampf, an einigen Mißgriffen gescheitert hat. Wir sahen dieses Mißlingen nicht gerne und zwar ganz besonders derFremdenwegen, d. h. um jener ehrenden Besucher willen aus andern Kantonen. Die wackern Schwinger aus Luzern und Unterwalden kamen gewiß nicht darum nach Schwyz um statt einen verdienten Preis heimzutragen, ihr Geld verzehren zu müssen. Ein Anderes und Mehreres aber ist derEhrenpunkt.– Es frägt sich nicht darum, ob unser Styger siege und so die Schwyzer ehre, es handelt sich um unpartheiische Handhabung der Schwingregeln, wenn man will und wünscht, daß Bürger anderer Kantonen uns besuchen, und ein jeweiliges Aelplerfest erhöhen. Das unsichere und die Unterwaldner und Luzerner begünstigende Interpretiren des Experten war eben auch geeignet, die Schwyzer anfzureizen. Solche Zwiste sind übrigens in Obwalden und und Bern an Schwingen öfter vorgekommen. Mit etwas mehr Energie und Sachkenntnis hätte das Comite es vielleicht dahin gebracht, daß Styger und fein Combattant von Unterwalden nach Bernermanier sich nochmals gefaßt und auf ein gegebenes Zeichen den Wettkampf begonnen hätten. Allein weil Styger sah, daß er von seinem Gegner und vielleicht noch von zweien und namentiich Wohmann sehr wahrscheinlich regelgerecht geworfen worden wäre, so wollte ihm die Fortsetzung nicht mehr behagen. Nun gut – dann konnte aber das Comite am Ende das Schwingen auch ohne Styger beenden lassen. Erfahrung bringt Wissenschaft. Wir dürfen daher für gewiß annehmen, daß ein nächstes Aelplerfest diesen Mißgriffen sicherlich abhelfen wird – durch geeignete Handhabung der Schwingregeln. Die Preisevertheilung an die übrigen Wettkämpfer erfolgte in folgender Weise: Preisliste. 1. Viehansstellung. Prämien erhielten: I. Für Zuchtstiere. Bernardin Fäßler aus Iberg, der kleinere. dt. dt. Balz Aufdermaur von Schwyz. Gemeinderath Marty am Großenstein. Xaver Rüedi von Morschach. II. Für Kühe. a.Bergkühe. Franz Joseph Waser in Schwyz. Gebrüder Schmid in Schwyz. Hauptmann Bürgi in Art. Jakob Bücheler in Seewen. Bernardin Fäßler aus Iberg. Jakob Bücheler in Seewen· b. Heimkühe. Dominik Märchi im Ried bei Schwyz. Martin Amstutz von Schwyz. Strafanstalt des Kantons. Thomas Reichmuth von Schwyz. III. Für trächtige Rinder: Hauptmann Bürgi in Art. Meinrad Styger von Rothenthurm. Landammann Kündig in Schwyz. Alois Janser am Urmiberg. Dominik Strübi in Ingenbohl. 2. In den Spielen. Laufen. 1) Carl Styger; 2) Aug. Ceberg, beide von Morschach. » « · » Springen. Carl Styger. Steinstoßen. 1) Carl Szyger, den großen Stein; 2) Franz Carl Stygek, mittlern Stein; 3) Felix Reichmuth von Schwyz, kleinen Stein. Sackgumpen l) Karl Laimhacher von Schwyz 2) Alois Gwerder ans Muotathal; 3) Carl Dom. Tchhümperli dito. Häggeln. l) Carl Styger; 2) Frz. Carl. Schuler von Rothenthurm. Klettern. l) Peter Blaser von Seewen; 2) Alois Hospenthaler von Schwyz (Dorfbach); 3) Jos. M. Kyd von Ingenbohl (Urmiberg); 4) Joseph Aufdermaur von Schwyz (Obermatt); 5) Fidel Inderbitzi von Ibach. Alphornblasen. 1) Karl Kamer von Art; 2) Gemeindebeschreiber Holdener von Iherg; 3) Melchior Euer von Schwyz (Oberdorf); 4) Xaver Kothing von Schwyz. Jodeln. 1) Karl Deck von Schwyz; 2) Marianna Schuler von Art (Roßberg); 3) Joseph Lienhard Brägenzer von Brunnen; 4) Alois Bürgler von Illgau. Karl Suter von Muotathal wurde extra ein Preis zur Anfmunterung zuerkannt. Wenn auch in den Stunden der Viehausstellung nur wenige Stück verkauft wurden, so hat der Markt doch in den zwei folgenden Tagen guten Erfolg gehabt. Nebst einzelnen Stücken sind bereits vier ganze Senten zu großen
Jodlerfeste, an denen Anton Büeler teilnahm:
Bei der Befragung am 18. 4. 1996 sagte Büeler, daß er auf den ersten drei Jodlerfesten je einen Muotataler Juuz, 1967 und 1968 je einen Nidwaldner Jodel und in den darauffolgenden Jahren wiederum Muotataler Juuzli vorgetragen hat
| 1964 | Z | Schwyz |
| 1965 | E | Thun |
| 1966 | Z | Horw |
| 1967 | Z | Kerns |
| 1968 | E | Winterthur |
| 1969 | Z | Schüfheim |
| 1970 | Z | Buochs |
| 1971 | E | Fribourg |
| 1972 | Z | Luzern |
| 1973 | Z | Ruswil |
| 1974 | Z | Altdorf |
| 1975 | E | Aarau |
| 1976 | Z | Sarnen |
| 1977 | Z | Schötz |
| 1978 | E | Schwyz |
| 1979 | Z | Willisau |
| 1980 | Z | Küssnacht |
| 1981 | E | Burgdorf |
| 1982 | Z | Stans |
| 1983 | Z | Einsiedeln |
| 1984 | E | St. Gallen |
| 1985 | Z | Sursee |
| 1986 | Z | Zug |
| 1987 | E | Brig |
| ? 1988 | Z | Alpnach |
| ? 1989 | Z | Dagmarsellen |
| 1990 | E | Solothurn |
| 1991 | Z | Engelberg |
E = Eidgenössisches Jodlerfest.
Bewertung von Anton Büelers Vortrag in Festberichten von Jodler Festen
[Von Hermann Fritz fotokopiert aus Dokumenten im Besitz von Anton Büeler (siehe S. 165)]

Bühler Anton, Ennetmoos Naturjodel Dieser echte Muotathaler-Jodel hätte doch etwas anders gestaltet werden dürfen. Wenn auch die Kirchentonart (Phrygisch) auf die eine Entstehungsquelle hinweist, so darf doch beim Jodeln eine gewisse Frische und Freude nicht fehlen.Ob hier ein gewisses Lampenfieber mitgewirkt hat? schreibt einer meiner Kameraden. Auch an der Tongebung darf noch gehörig gearbeitet werden, dann wird es ein andermal noch besser gehen.
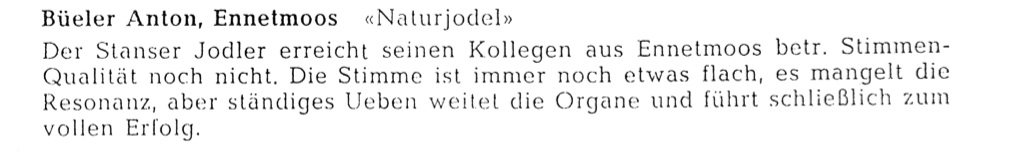
Büeler Anton, Ennetmoos NaturjodelDer Stanser Jodler erreicht seinen Kollegen aus Ennetmoos betr. Stimmen-Qualität noch nicht. Die Stimme ist immer noch etwas flach, es mangelt die Resonanz, aber ständiges Ueben weitet die Organe und führt schließlich zum vollen Erfolg.
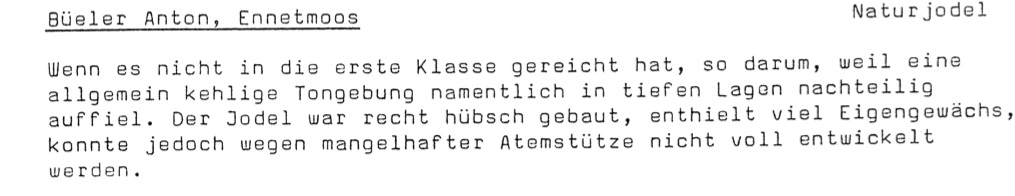
Büeler Anton, Ennetmoos Naturjodel Wenn es nicht in die erste Klasse gereicht hat, so darum, weil eine allgemein kehlige Tongebung namentlich in tiefen Lagen nachteilig auffiel. Der Jodel war recht hübsch gebaut, enthielt viel Eigengewächs konnte jedoch wegen mangelhafter Atemstütze nicht voll entwickelt werden.
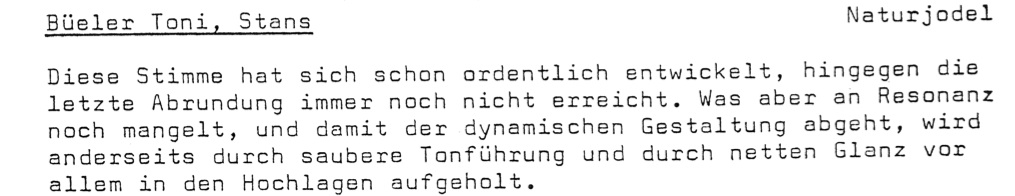
Büeler Toni, Stans Naturjodel Diese Stimme hat sich schon ordentlich entwickelt, hingegen die letzte Abrundung immer noch nicht erreicht. Was aber an Resonanz noch mangelt, und damit der dynamischen Gestaltung abgeht, wird anderseits durch saubere Tonführung und durch netten Glanz vor allem in den Hochlagen aufgeholt.
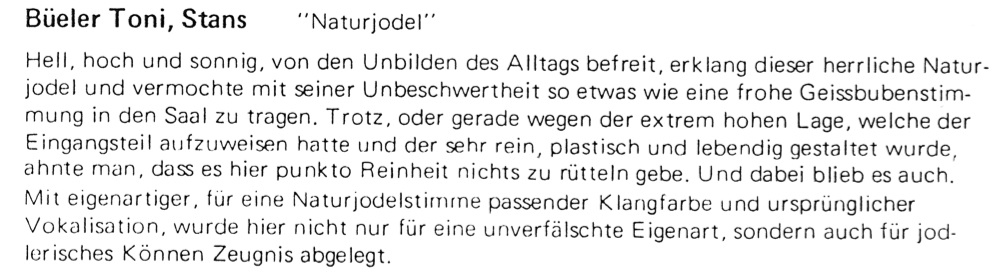
Büeler Toni, Stans NaturjodelHell, hoch und sonnig, von den Unbilden des Alltags befreit, erklang dieser herrliche Naturjodel und vermochte mit seiner Unbeschwertheit so etwas wie eine frohe Geissbubenstimmung in den Saal zu tragen. Trotz, oder gerade wegen der extrem hohen Lage, welche der Eingangsteil aufzuweisen hatte und der sehr rein, plastisch und lebendig gestaltet wurde, ahnte man, dass es hier punkto Reinheit nichts zu rütteln gebe. Und dabei blieb es auch. Mit eigenartiger, für eine Naturjodelstimme passender Klangfarbe und ursprünglicher Vokalisation, wurde hier nicht nur für eine unverfälschte Eigenart, sondern auch für jodlerisches Können Zeugnis abgelegt.
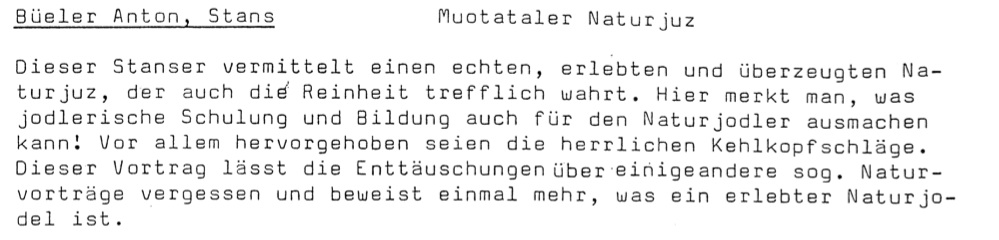
Büeler Anton, Stans Muotataler Naturjuz Dieser Stanser vermittelt einen echten, erlebten und überzeugten Naturjuz, der auch die Reinheit trefflich wahrt. Hier merkt man, was jodlerische Schulung und Bildung auch für den Naturjodler ausmachen kann! Vor allem hervorgehoben seien die herrlichen Kehlkopfschläge. Dieser Vortrag lässt die Enttäuschungen über einige andere sog. Naturvorträge vergessen und beweist einmal mehr, was ein erlebter Naturjodel ist.
Z 1970 Buochs: Festbericht war mir nicht zugänglich.

Büeler Anton, Stans Muotataler Bücheljuz Die junge elastische Stimme bewältigt diesen einmaligen Naturjodel bravourös, womit der Jodler die Scharte des letztjährigen Unterverbandsfestes in Buochs in echter Jodlermanier wieder auswetzt. Frisch und natürlich rollt der 1. Teil über die Lippen. Die schnellen kugeligen Tonwiederholungen des 2. Teiles offenbaren gekonnte Zungenschlagtechnik und eine vorzügliche Atemstütze, während der langsam beginnende Schlussteil mit den originellen, charakteristischen Tonsprüngen und den eingestreuten Natur-Fa die seltene Reinheit der Darbietung besonders hervorhebt.
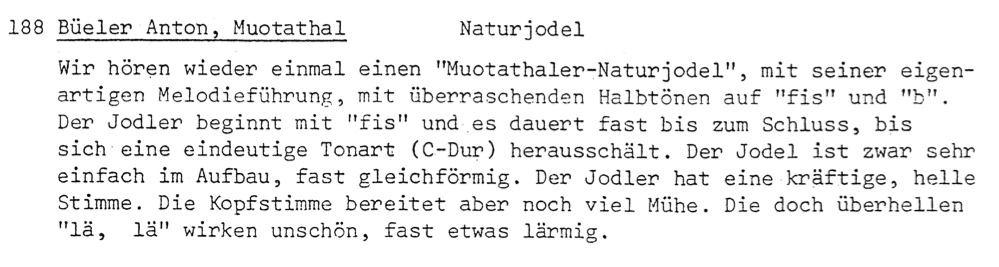
188Büeler Anton, Muotathal Naturjodel Wir hören wieder einmal einenMuotathaler-Naturjodel, mit seiner eigenartigen Melodieführung, mit überraschenden Halbtönen auffisundb. Der Jodler beginnt mitfisund es dauert fast bis zum Schluss, bis sich eine eindeutige Tonart (C-Dur) herausschält. Der Jodel ist zwar sehr einfach im Aufbau, fast gleichförmig. Der Jodler hat eine kräftige, helle Stimme. Die Kopfstimme bereitet aber noch viel Mühe. Die doch überhellenlä, läwirken unschön, fast etwas lärmig.

Büeler Anton, Hinterthal Naturjodel Ein versierter Jodler bringt uns einen urwüchsigen, originellen Muotataler-Jutz zu Gehör, welcher fast ausschliesslich aus Tönen der Naturtonreihe aufgebaut ist, gespickt mit dem Halbtonschrittcis﹣d(übermässige Quart ﹣ reine Quint = Natur-Fa). Originell ist auch der Schluss auf der Quint. Die schönen Kehlkopfschläge wissen ganz besonders zu gefallen. Note 1
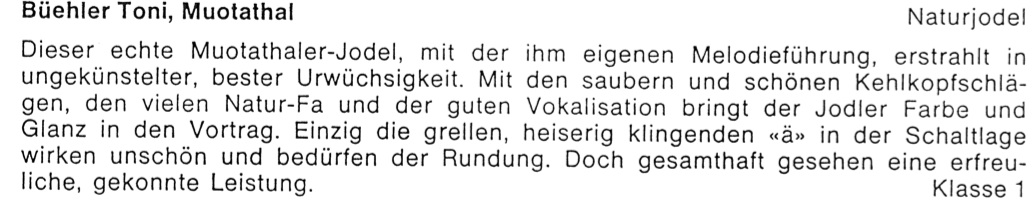
Büehler Toni, Muotathal Naturjodel Dieser echte Muotathaler-Jodel, mit der ihm eigenen Melodieführung, erstrahlt in ungekünstelter, bester Urwüchsigkeit. Mit den saubern und schönen Kehlkopfschlägen, den vielen Natur-Fa und der guten Vokalisation bringt der Jodler Farbe und Glanz in den Vortrag. Einzig die grellen, heiserig klingendenäin der Schaltlage wirken unschön und bedürfen der Rundung. Doch gesamthaft gesehen eine erfreuliche, gekonnte Leistung. Klasse 1
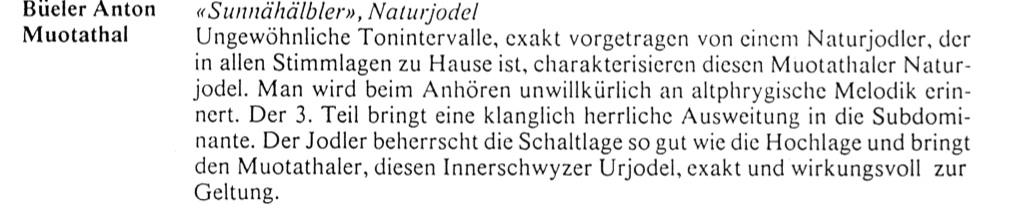
Büeler Anton
MuotathalSunnähälbler, Naturjodel Ungewöhnliche Tonintervalle, exakt vorgetragen von einem Naturjodler, der in allen Stimmlagen zu Hause ist, charakterisieren diesen Muotathaler Naturjodel. Man wird beim Anhören unwillkürlich an altphrygische Melodik erinnert. Der 3. Teil bringt eine klanglich herrliche Ausweitung in dic Subdominante. Der Jodler beherrscht die Schaltlage so gut wie die Hochlage und bringt den Muotathaler, diesen Innerschwyzer Urjodel, exakt und wirkungsvoll zur Geltung.

Büeler Anton, Muotathal Naturjodel(ohne Begleitung) Mit reifer und sehr beweglicher Tongebung windet sich die bergklare Stimme durch das Labyrinth eigenwilliger Melodieführung im urwüchsigen Muotathaler Jutz. Der Gehalt der drei eindrücklichen Teile wird durch ansprechende Differenzierung in Tempo und Tonstärke zum Ausdruck gebracht. Die ganze Zwickmühle kapriziöser Tonschritte vermag der harmonischen Standfestigkeit nichts anzuhaben. Klasse 1
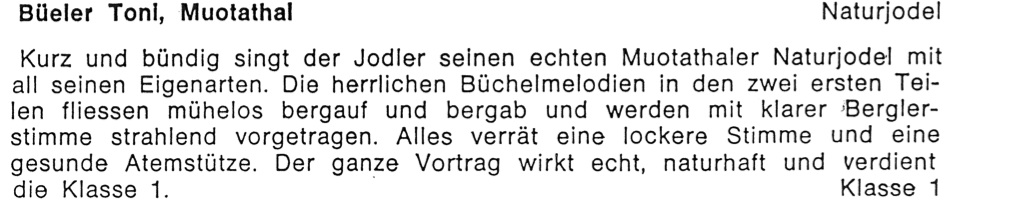
Büeler Toni, Muotathal Naturjodel Kurz und bündig singt der Jodler seinen echten Muotathaler Naturjodel mit all seinen Eigenarten. Die herrlichen Büchelmelodien in den zwei ersten Teilen fliessen mühelos bergauf und bergab und werden mit klarer Berglerstimme strahlend vorgetragen. Alles verrät eine lockere Stimme und eine gesunde Atemstütze. Der ganze Vortrag wirkt echt, naturhaft und verdient die Klasse 1. Klasse 1

Büeler Anton, Muotathal NaturjodelFür den Nichtkenner bestimmt ein nicht leicht zu verstehendes Tongebilde. Mit bestechender Sicherheit wurden die vielen Natur-Fa gemeistert, sie nötigten uns vollste Anerkennung ab. Mit der auffallend hellen Vokalisation bildeten sie die Stilelemente dieses wirklich echten Naturjodels. Die ureigenen, auf Kurzthematik aufgebauten Teile zeichnen ein Abbild des zerklüfteten Heimattales und lassen uns würzige Bergluft atmen.
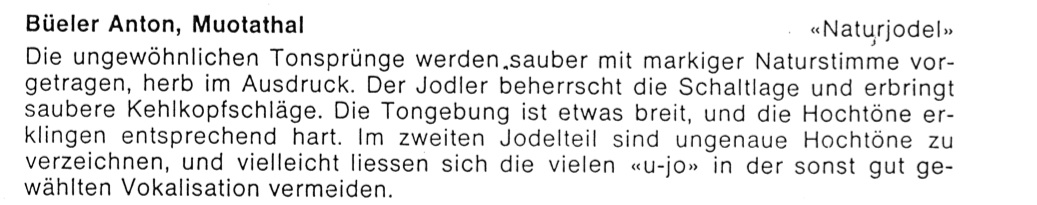
Büeler Anton, Muotathal NaturjodelDie ungewöhnlichen Tonsprünge werden_sauber mit markiger Naturstimme vorgetragen, herb im Ausdruck. Der Jodler beherrscht die Schaltlage und erbringt saubere Kehlkopfschläge. Die Tongebung ist etwas breit, und die Hochtöne erklingen entsprechend hart. Im zweiten Jodelteil sind ungenaue Hochtöne zu verzeichnen, und vielleicht liessen sich die vielenu﹣join der sonst gut gewählten Vokalisation vermeiden.
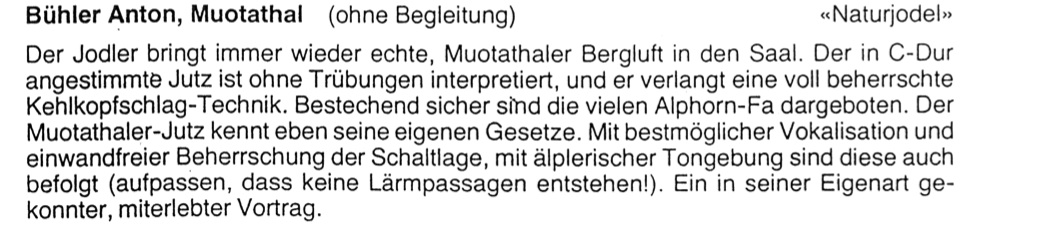
Büeler Anton, Muotathal (ohne Begleitung)NaturjodelDer Jodler bringt immer wieder echte, Muotathaler Bergluft in den Saal. Der in C-Dur angestimmte Jutz ist ohne Trübungen interpretiert, und er verlangt eine voll beherrschte Kehlkopfschlag-Technik. Bestechend sicher sind die vielen Alphorn-Fa dargeboten. Der Muotathaler-Jutz kennt eben seine eigenen Gesetze. Mit bestmöglicher Vokalisation und einwandfreier Beherrschung der Schaltlage, mit älplerischer Tongebung sind diese auch befolgt (aufpassen, dass keine Lärmpassagen entstehen!). Ein in seiner Eigenart gekonnter, mlterlebter Vortrag.
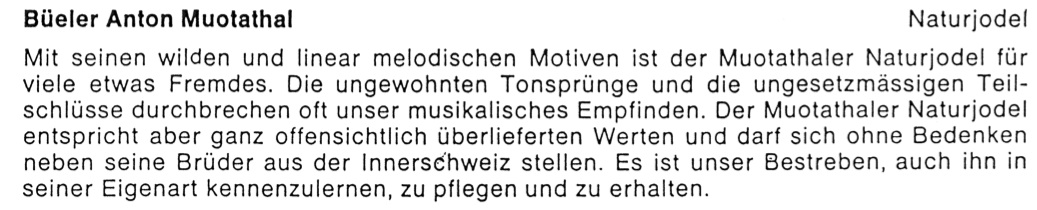
Büeler Anton, Muotathal Naturjodel Mit seinen wilden und linear melodischen Motiven ist der Muotathaler Naturjodel br viele etwas Fremdes. Die ungewohnten Tonsprünge und die ungesetzmässigen .Teilschlüsse durchbrechen oft unser musikalisches Empfinden. Der Muotathaler Naturjodel entspricht aber ganz offensichtlich überlieferten Werten und darf sich ohne Bedenken neben seine Brüder aus der Innerschweiz stellen. Es ist unser Bestreben, auch ihn in seiner Eigenart kennenzulernen, zu pflegen und zu erhalten.
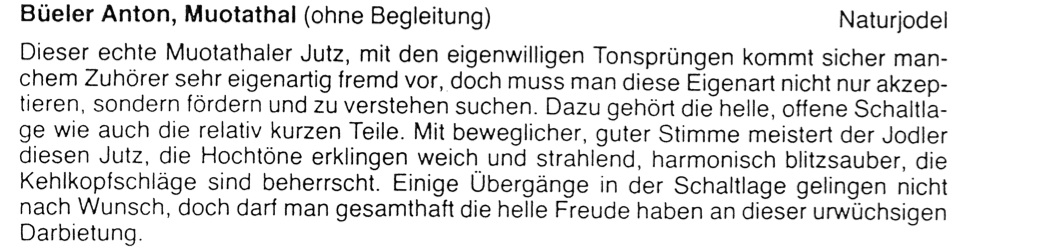
Büeler Anton, Muotathal (ohne Begleitung)Naturjodel Dieser echte Muotathaler Jutz, mit den eigenwilligen Tonsprüngen kommt sicher manchem Zuhörer sehr eigenartig fremd vor, doch muss man diese Eigenart nicht nur akzeptieren, sondern fördern und zu verstehen suchen. Dazu gehört die helle, offene Schaltlage wie auch die relativ kurzen Teile. Mit beweglicher, guter Stimme meisten der Jodler diesen Jutz, die Hochtöne erklingen weich und strahlend, harmonisch blitzsauber, die Kehlkopfschläge sind beherrscht. Einige Übergänge in der Schaltlage gelingen nicht nach Wunsch, doch darf man gesamthaft die helle Freude haben an dieser urwüchsigen Darbietung.
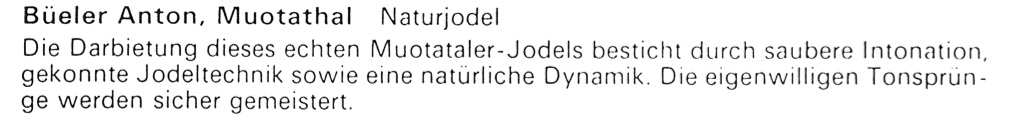
Büeler Anton, Muotathal Naturjodel Die Darbietung dieses echten Muotataler-Jodels besticht durch saubere Intonation, gekonnte Jodeltechnik sowie eine natürliche Dynamik. Die eigenwilligen Tonsprünge werden sicher gemeistert.
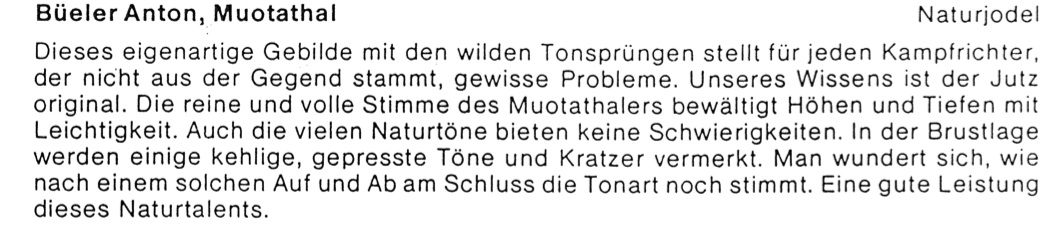
Büeler Anton, Muotathal Naturjodel Dieses eigenartige Gebilde mit den wilden Tonsprüngen stellt für jeden Kampfrichter, der nicht aus der Gegend stammt, gewisse Probleme. Unseres Wissens ist der Jutz original. Die reine und volle Stimme des Muotathalers bewältigt Hohen und Tiefen mit Leichtigkeit. Auch die vielen Naturtöne bieten keine Schwierigkeiten. In der Brustlage werden einige kehlige, gepresste Töne und Kratzer vermerkt. Man wundert sich, wie nach einem solchen Auf und Ab am Schluss die Tonart noch stimmt. Eine gute Leistung dieses Naturtalents.
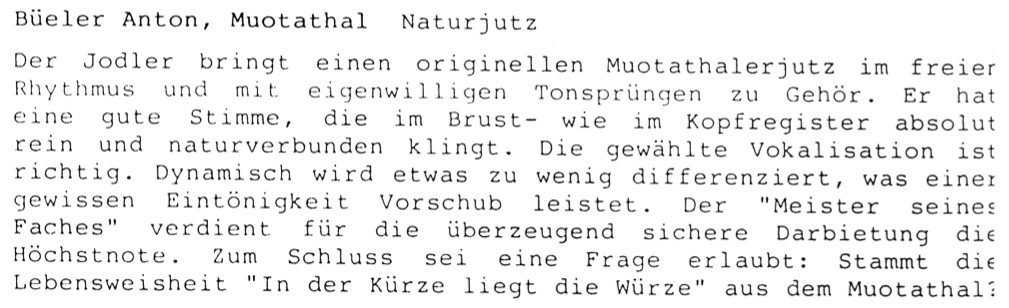
Büeler Anton, Muotathal Naturjutz Der Jodler bringt einen originellen Muotathalerjutz im freier Rhythmus und mit eigenwilligen Tonspringen zu Gehör. Er hat eine gute Stimme, die im Brust‐ wie im Kopfregister absolut rein und naturverbunden klingt. Die gewählte Vokalisation ist richtig. Dynamisch wird etwas zu wenig differenziert, was einer gewissen Eintönigkeit Vorschub leistet. DerMeister seines Fachesverdient für die überzeugend sichere Darbietung Die Höchstnote. Zum Schluss sei eine Frage erlaubt: Stammt die LebensweisheitIn der Kürze liegt die Würzeaus dem Muotathal.
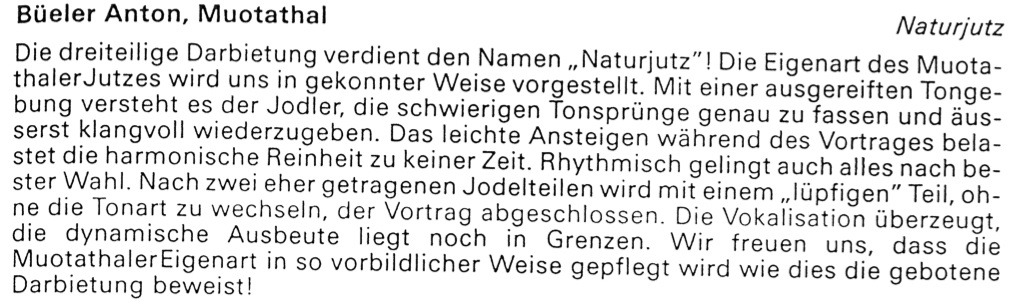
Büeler Anton, Muotathal Naturjutz Die dreiteilige Darbietung verdient den NamenNaturjutz! Die Eigenart des Muotathaler Jutzes wird uns in gekonnter Weise vorgestellt. Mit einer ausgereiften Tongebung versteht es der Jodler, die schwierigen Tonsprünge genau zu fassen und äusserst klangvoll wiederzugeben. Das leichte Ansteigen während des Vortrages belastet die harmonische Reinheit zu keiner Zeit. Rhythmisch gelingt auch alles nach bester Wahl. Nach zwei eher getragenen Jodelteilen wird mit einemlüpfigenTeil, ohne die Tonart zu wechseln, der Vortrag abgeschlossen. Die Vokalisation überzeugt, die dynamische Ausbeute liegt noch in Grenzen. Wir freuen uns, dass die Muotathaler Eigenart in so vorbildlicher Weise gepflegt wird wie dies die gebotene Darbietung beweist! 1987 Brig; Klasse 1Büeler Anton, Muotathal NaturjutzSeinen 3-teiligen Muotathaler mit den ihm eigenen skurrilen Tonsprüngen belebt der Naturjutzer mit klar abgestuften Tempounterschieden und berglerisch grellen Kehlkopfschlägen. In den explosiv-knalligen Schaltlagetönen treten zwar mitunter Anzeichen einer heisrig-belegten Stimme auf. Der belebte 3. Teil gefällt durch seinen Ideenreichtum und die unbeschwerte, natürliche Freude am Jutzen.
Z 1988 Alpnach: Festbericht war mir nicht zugänglich.
Z 1989 Dagmarsellen: Festbericht war mir nicht zugänglich.
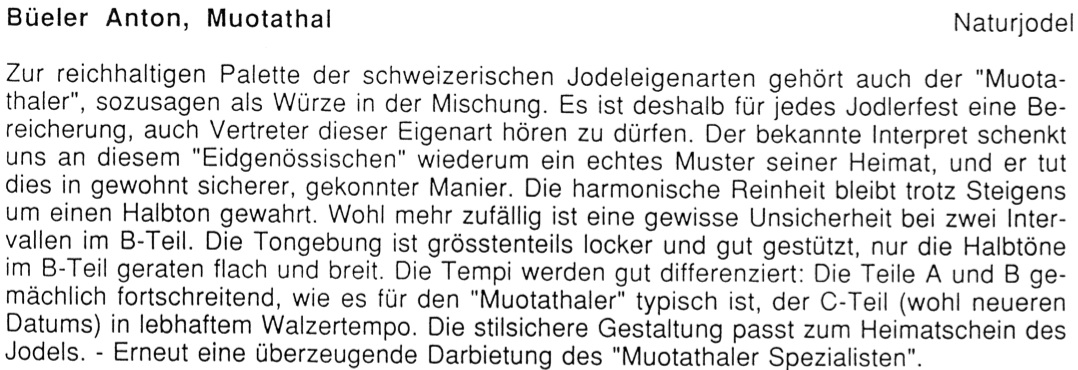
Büeler Anton, Muotathal Naturjodel Zur reichhaltigen Palette der schweizerischen Jodeleigenarten gehört auch derMuotathaler, sozusagen als Würze in der Mischung. Es ist deshalb für jedes Jodlerfest eine Bereicherung, auch Vertreter dieser Eigenart hören zu dürfen. Der bekannte Interpret schenkt uns an diesemEidgenössischenwiederum ein echtes Muster seiner Heimat, und er tut dies in gewohnt sicherer, gekonnter Manier. Die harmonische Reinheit bleibt trotz Steigens um einen Halbton gewahrt. Wohl mehr zufällig ist eine gewisse Unsicherheit bei zwei Intervallen im B-Teil. Die Tongebung ist grösstenteils locker und gut gestützt, nur die Halbtöne im B-Teil geraten flach und breit. Die Tempi werden gut differenziert: Die Teile A und B gemächlich fortschreitend, wie es für denMuotathalertypisch ist, der C-Teil (wohl neueren Datums) in lebhaftem Walzertempo. Die stilsichere Gestaltung passt zum Heimatschein des Jodels. – Erneut eine überzeugende Darbietung desMuotathaler Spezialisten.
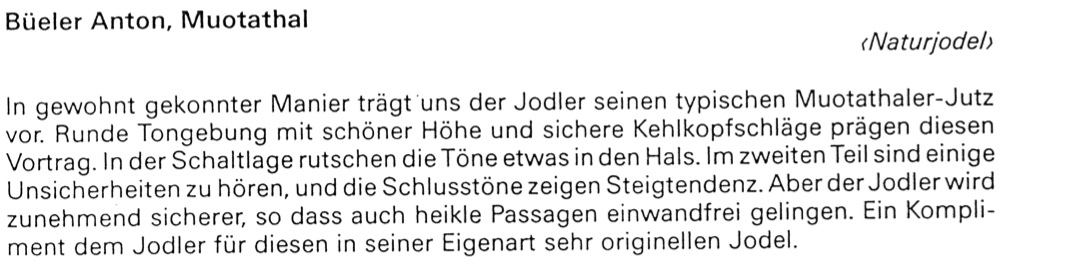
Büeler Anton, Muotathal ‹Naturjodel› In gewohnt gekonnter Manier trägt uns der Jodler seinen typischen Muotathaler-Jutz vor. Runde Tongebung mit schöner Höhe und sichere Kehlkopfschläge prägen diesen Vortrag. In der Schaltlage rutschen die Töne etwas in den Hals. Im zweiten Teil sind einige Unsicherheiten zu hören, und die Schlusstöne zeigen Steigtendenz. Aber der Jodler wird zunehmend sicherer, so dass auch heikle Passagen einwandfrei gelingen. Ein Kompliment dem Jodler für diesen in seiner Eigenart sehr originellen Jodel.
Bibliographie:
- Abraham, Otto und Erich Moritz von Hornbostel
- 1909
Vorschläge für die Transkription exotischer Melodien.
Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 11/1 (Berlin): 1-25.
- 1909
- Anderson, J. R.
- 1989 Kognitive Psychologie. (Heidelberg)
- Bachmann﹘Geiser, Brigitte
- 1996 Kommentar im Beiheft zur CD
Schweizer Volksmusik. Tag der Schweizer Volksmusik.
ZYT 4532. P & C Zytglogge Verlag.
- 1996 Kommentar im Beiheft zur CD
- Bartok, Bela
- 1959 Slovenske ludove piesne (Slowakische Volkslieder) Bd. 1 (Bratislava).
- Bartók, Bela und A. B. Lord
- 1951 Serbo-Croatian Folk Songs. (Columbia University Studies in Musicology VII. New York).
- Baumann, Max Peter
- 1976 Musikfolklore und Musikfolklorismus. Eine ethnomusikologische Untersuchung zum Funktionswandel des Jodels (Winterthur).
- Bengtsson, Ingmar
- 1977
Rhythm Research in Uppsala.
Music, Room, and Acoustics. (Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music 17. Stockholm): 19﹣56.
- 1977
- Bengtsson, Ingmar und Alf Gabrielsson
- 1983
Analysis and Synthesis of Musical Rhythm.
In J. Sundberg: Studies of Music Performance. (Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music 39. Stockholm): 27﹣60.
- 1983
- Betschart, Peter
- 1981
Der Muotataler-Juuz.
Bärgfrüelig. Musikalisch-volkskundliche Zeitschrift der Eidgenössischen Jodler-Dirigenten-Vereinigung 12/3: 3﹣27.
- 1981
- Blümml, Emil Karl
- 1901
Karl Hermann Prahl und dessen Anschauungen über das Volkslied.
Das deutsche Volkslied 3 (Wien): 132 ff.
- 1901
- Dalcher, Peter und Stefan M. Fuchs, Ephrem Holdener, Elvira Jäger, Viktor Weibel
- 1994 Die Mundarten des Kanton Schwyz. Fünf Aufsätze über die ältern und jüngern Schwyzer Dialektverhältnisse. (Schwyzer Hefte 61).
- Dieth, Eugen
- 1986 Schwyzertütschi Dialäktschrift. Dieth-Schreibung. 2. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Christian Schmid﹘Cadalbert. (Aarau; Frankfurt am Main; Salzburg).
- Danckert, W.
- 1939 Das europäische Volkslied.
207
- Elschek, Oskar
- 1990
Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung.
In Oskar Elschek: Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen: 21﹣30.
- 1990
- Födermayr, Franz
- 1990
Spezielle Rhythmusgestaltung in der österreichischen Volksmusik. Ein methodischer Ansatz.
In Musicologica Slovaca. Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen, hrsg. von Oskar Elschek (Bratislava): 223﹣238.
- 1990
- Födermayr, Franz und Werner A. Deutsch
- 1994 Analytische Grundlagen zu einer Typologie des Jodelns. Klanganalyse. Systematische Musikwissenschaft Il/2 (Bratislava): 255﹣272.
- Fritz, Hermann
- 1988
Kontinuostimmen. Ein Beitrag zur Typologie volkhafter Mehrstimmigkeit in Österreich.
Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 36/37 (Wien): 30﹣70. - 1990
Interpretatonsweisen der Jodler im salzburgischen Ennstal.
Die Volksmusik im Lande Salzburg II. (Schriften zur Volksmusik 13. Wien): 39﹣50. - 1993
Zur Ländlerhandschrift 1928 des Franz Jobstmann in Jeutendorf.
In Walter Deutsch: Corpus musicae popularis Austriacae 1. Niederösterreich. St. Pölten und Umgebung: 398﹣400. - 1994
Untersuchungen über Volksmusik‐ und Volksliedbegriffe.
Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 42/43 (Wien): 92﹣144.
- 1988
- Gabrielsson, Alf
- 1981
Music psychology – a survey of problems and current research activities.
Basic Musical Functions and Musical ability. (Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music 32. Stockholm).
- 1981
- 1986
Some Recent Trends in Music Psychology.
Musicologia Austriaca 6: 137﹣155. - Gaßmann, Alfred Leonz
- 1906 Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 4. Basel).
- 1936 Zur Tonpsychologie des Schweizer Volksliedes. (Zürich).
- 1961 Was unsere Väter sangen. Volkslieder und Volksmusik vom Vierwaldstättersee, aus der Urschweiz und dem Entlebuch. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 42. Basel).
- Graf, Walter
- 1975
Sonagraphische Untersuchungen, mit Beispielen aus dem deutschsprachigen Volksgesang.
In Rolf Wilhelm Brednich, Lutz Röhrich und Wolfgang Suppan (Hg.), Handbuch des Volksliedes 2 (München): 583﹣622.
- 1975
- Haid, Gerlinde
- INFOLK.Informationssystem für Volksliedarchive in Österreich. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes (Wien): 81﹣216.
208
- Helman, Zofia
- 1988
Von Heinrich Schenkers analytischer Methode bis zur generativen Theorie der tonalen Musik.
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 19/2 (Zagreb): 181﹣195.
- 1988
- Kappeler, Th.
- 1956
Der Toggenburger Jodel.
Toggenburger Heimat-Jahrbuch 16: 123﹣128.
- 1956
- Klusen, Ernst
- 1969 Volkslied. Fund und Erfindung (Köln).
- Kubik, Gerhard
- 1973
Verstehen in afrikanischen Musikkulturen.
In P. Faltin und H.-P. Reinecke: Musik und Verstehen (Köln): 171﹣188. - 1983
Kognitive Grundlagen afrikanischer Musik
In Artur Simon: Musik in Afrika (Berlin): 327﹣400.
- 1973
-
Leibold, Rudolf
- 1936
Akustisch-motorischer Rhythmus in früher Kindheit. Eine strukturpsychologische Studie
. Arbeiten zur Entwicklungspsychologie. Hrsg. Felix Krueger. (Achtzehntes Stück. Abhandlungen der sächsischen staatlichen Forschungsinstitute. Forschungsinstitut für Psychologie Nr. 67). (München).
- 1936
- Lerdal, F. und R. Jackendoff
- 1983 A Generative Theory of Tonal Music. (Cambridge, Mass. – London).
- Leuthold, Heinrich J.
- 1972
Der Naturjodel in der Innerschweiz.
50 Jahre Zentralschweizerischer Jodlerverband 1922﹣1972. Jubiläumsschrift, hrsg. vom Zentralschweizerischen Jodlerverband (Luzern): 71﹣80. - 1981 Der Naturjodel in der Schweiz. Wesen. Entstehung. Charakteristik. Verbreitung (Altdorf)
- 1985
Naturjodel und Jodellied.
Volksmusik in der Schweiz (Zürich): 84﹣101.
- 1972
- Lubej, Emil
- 1992
Musikalische Transkription – computerunterstützt.
Sommerakademie Volkskultur 1992. Dokumentation (Wien): 104﹣107.
- 1992
- Manser, Johann
- 1979 Heemetklang us Innerrhode. (Appenzell).
- Meier, John
- 1987/1906 Kunstlied und Volkslied in Deutschland (Halle a. 5.).
- 1906 Kunstlieder im Volksmunde (Halle a. 5.).
- Pommer, Josef
- 1912
Meine Definition des Begriffes
Das deutsche Volkslied 14 (Wien): 99 f.Volkslied
.
- 1912
- Rotter, Kurt
- 1912 Der Schnadahüpfl-Rhythmus. (Berlin).
- Scheutz, Hannes
- 1985 Strukturen der Lautveränderung. Variationslinguistische Studien zur Theorie und Empirie sprachlicher Wandlungsprozesse am Beispiel des Mittelbairischen von Ulrichsberg/Oberösterreich. (Schriften zur deutschen Sprache in Österreich. Wien).
- Schlittgen, Rainer
- 1995 Einführung in die Statistik. Analyse und Modellierung von Daten. (München, Wien).
209
- Sichardt, Wolfgang
- 1936/37
Eine volkskundlich-musikwissenschaftliche Forschungsreise in der Schweiz.
Deutsche Tonkünstlerzeitung 33 (Mainz): 182﹣184. - 1937
Altgermanisches Musiziergut im alpenländischen Jodler. Eine Forschungsreise im Schweizer Alpengebiet.
Allgemeine Musikzeitung 64/5 (Berlin): 52﹣53. - 1939 Der alpenländische Jodler und der Ursprung des Jodelns. (Schriften zur Volksliedkunde und völkerkundli
schen Musikwissenschaft II. Berlin)
- 1936/37
- 1962 Der Volksgesang in der Altmark von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. (Berlin).
- 1990
Aspekte des Rhythmischen am Beispiel europäischer Volksmusik.
In Oskar Elschek: Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen. (Bratislava): 31﹣42.
- 1818/1843/1906 Österreichische Volkslieder mit ihren Singweisen. (Leipzig).
- 1981 Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. (München/Zürich).
- 1990
Jüüzli
. Jodel du Muotatal. (Beiheft zur gleichnamigen CD. Le Chant du Monde LDX 274716).
Filmographie:
- Zemp, Hugo und Peter Betschart
- 1987 Serie Jüüzli aus dem Muotatal, bestehend aus vier Filmen:
Juuzen und jodeln (50 Min.),
Kopfstimme. Bruststimme (32 Min.),
Die Hochzeit von Susanna und Joseph (25 Min.)
Glattalp (30 Min.).
1983﹣84 gefilmt, 1987 erstaufgeführt. Koproduktion C.N.R.S. (:Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) und Ateliers d'ethnomusicologie, Geneve.
- 1987 Serie Jüüzli aus dem Muotatal, bestehend aus vier Filmen:
Discographie:
1979 Jüüzli
. Jodel du Muotatal. Hrsg. Hugo Zemp. Collection C.N.R.5./ Musee de l'Homme. LDX 74716.
CD 1979/90 Jüüzli
. Jodel du Muotatal. Hrsg. Hugo Zemp. Collection C.N.R.S./ Musee de l'Homme. Le Chant du Monde LDX 274716.
CD 1996 Schweizer Volksmusik. Tag der Schweizer Volksmusik. P & C Zytglogge Verlag. ZYT 4532.
210CD 1993 Muotitaler Friinacht. 26 dienigi alti Tänzli (live). ARVE Records.
CD 7 Die urchigä Muotithaler. 17 Volksmusikgruppen aus dem Muotatal. COREMA Records 391 108.
CD 1990 Trio Bürgler﹘Rickenbacher mit Dominik Marty. Illgauer Ländlermusig. COREMA Records 390 093.
1984 Ländlertrio Echo vom Roßbärg. Gast: Pragelchörli Muotathal. Oergelihuus LPO 8424.
1983 Urchigs us em Muotathal. Tell Record TLP 5343.
1974? Schwyz. Schallplatten helvetia HL 208. phonag.
1984 Lüpfigi Volksmusig us em Ried – Muotathal – Bisisthal. EMI Records AG 13 C 1763511.
1983 Volkstümliches Schwyz. Tell Record TLP 8202.
1978 Am Eidgenössischen Jodlerfäscht z Schwyz. Helvetia HL 272 Phonag.
1974? Am Eidgenössischen Schwingfäscht z Schwyz. Helvetia HL 205 Phonag.
1981? Am Eidgenössische Jodlerfäscht. Tell Record TLA 12﹣13.
1985 Aelplerchilbi. Oergelihuus LPO 8599.
1983 Das Urchigscht us dr Schwiiz. Orgelihuus LPO 199.
1963/69 Stöckmärcht im Ybrig. Schwyzerörgeli-Duo Druosbärg-Büeblä. EMI 13 C 062-33514
1987 A Gruess us em Ybrig. COREMA 287 068.
1987 Betschart-Buebä. Uf dr Sunnäterrassä z' Illgau. EMI 13 C 7484581.
1989 Firabig-Stimmig
. COREMA 289085.
1985 Bi üs z' Illgau. Tonstudio Max Lussi, Basel. 574.
1986 Öppis Gfreuts us Illgau. Trio Bürgler –Rickenbacher mit Dominik Marty. COREMA 286056.
Schellackplatten:
Gegen Morge zue – Schottisch.
A luschtigi Sennechilbi – Potpourri.
Ländlerkapelle Echo vom Mythen
, Schwyz (Mit Jodel).
His Master's Voice. The Gramophone CO.LTD. 30-3758 und 30-3759.
Kat. Nr. F:K: 96
Schwingfest auf dem Stoos – Ländler (H. Lott), mit Jodel und Alphorn.
Im Heuet – Schottisch (H. Lott).
Stimmungskapelle Lott & Schmidig. Ibach – Schwyz. Columbia ZZ 145
(CZ 538).
De Schwyzerbur, Ländler.
Muetathaler Aelplerchilbi.
Die fidelen Muetathaler (Gebt. Gwerder, Kappeler und Gebr. Lott)
(mit Jodel und Gesang). VOX. Bestell-Nr. 1647. Matriz.-Nr. 505 und 504
Auf Urlaub! Marsch-Polka.
Alpabfahrt vom Stoos (Alpenscenerie) mit Jodel, Glocken und Herdengeläut.
Ländlerkapelle Echo vom Mythen
1919. ELITE RECORD 2021 und 2025.
Stubete. Schottisch von Schuler Xaver.
Ingebohler Senne﹘Ghilbi mit Jodler von Geschwister Schuler und Betschart.
Ländlerkapelle Geisser Altdorf. Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft
Katalog﹘Nr. B 40350 und B 40349. Bestell-Nr. 14516.
Curriculum Vitae:
Hermann FRITZ[Eine kurze Textpassage wurde aus Datenschutzgründen nicht in die Online-Ausgabe übernommen]
Ich wurde am 21. Nov. 1954 in Linz geboren, mein Vater ist Magistratsbeamter, meine Mutter Volkssschullehrerin. Im Alter von zehn Jahren begann ich am Brucknerkonservatorium Linz Violine zu lernen, zwei Jahre später zusätzlich Klavier. Nach vier Jahren Volksschule, vier Jahren Hauptschule und vier Jahren Musisch-Pädagogischem Realgymnasium ging ich 1974 nach Wien. Dort studierte ich Tonsatz und Komposition bei Erich Urbanner an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (1974-1976) und sowie Geschichte und Mathematik (Lehramtsstudium) an der Universität Wien (1974-1978). Diese Studien habe ich nicht abgeschlossen. Ab 1977 machte ich das Lehramtsstudium für Violine an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien und am Brucknerkonservatorium in Linz, das ich 1982 mit der Lehramtsprüfung abschloß. Seither arbeite ich als freischaffender Musiker (Geiger und Komponist).
Im Schuljahr 1983/1984 war ich Violinlehrer an der Städtischen Musikschule Wels. 1985-1990 arbeitete ich am Österreichischen Volksliedarchiv in Wien, meine Aufgaben waren Transkription, Feldforschung und archivalische Forschung. Als Musiker und als Übermittler von Musik aus Archivbeständen war ich invol- viert in die österreichische Bordunmusikrenaissance. In diese Zeit fallen auch meine ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Von 1989 bis 1994 war ich an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Mozarteum in Salzburg als Lehrbeauftragter tätig (Übungen "Volksmusik in
Österreich" an der Abteilung für Musikpädagogik). Seit 1995 hatte ich in
den Sommersemestern am Institut für Musikwissenschaft der Universität Innsbruck
einen Lehrauftrag für Musiktranskription (Proseminar). Wegen dieser
Entwicklung meiner beruflichen Tätigkeit begann ich im Wintersemester 1994
Musikwissenschaft zu studieren an der Universität Wien. Im jetztigen Sommersemester
habe ich am Institut für Musikwissenschaft einen weiteren Lehrauftrag:
Schallanalyse (Übungen).